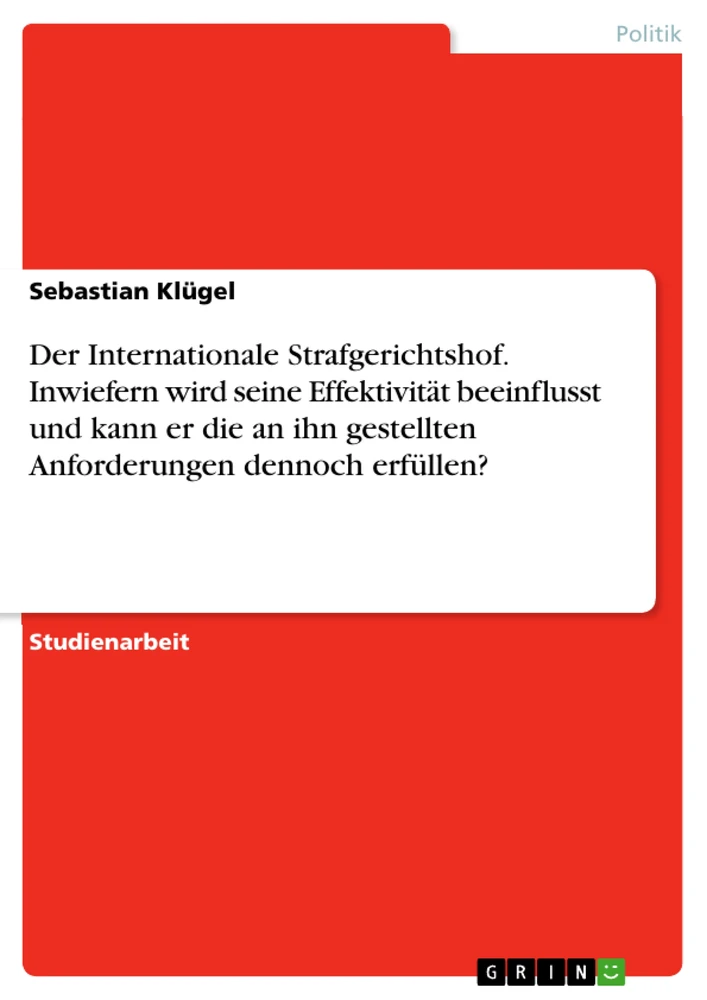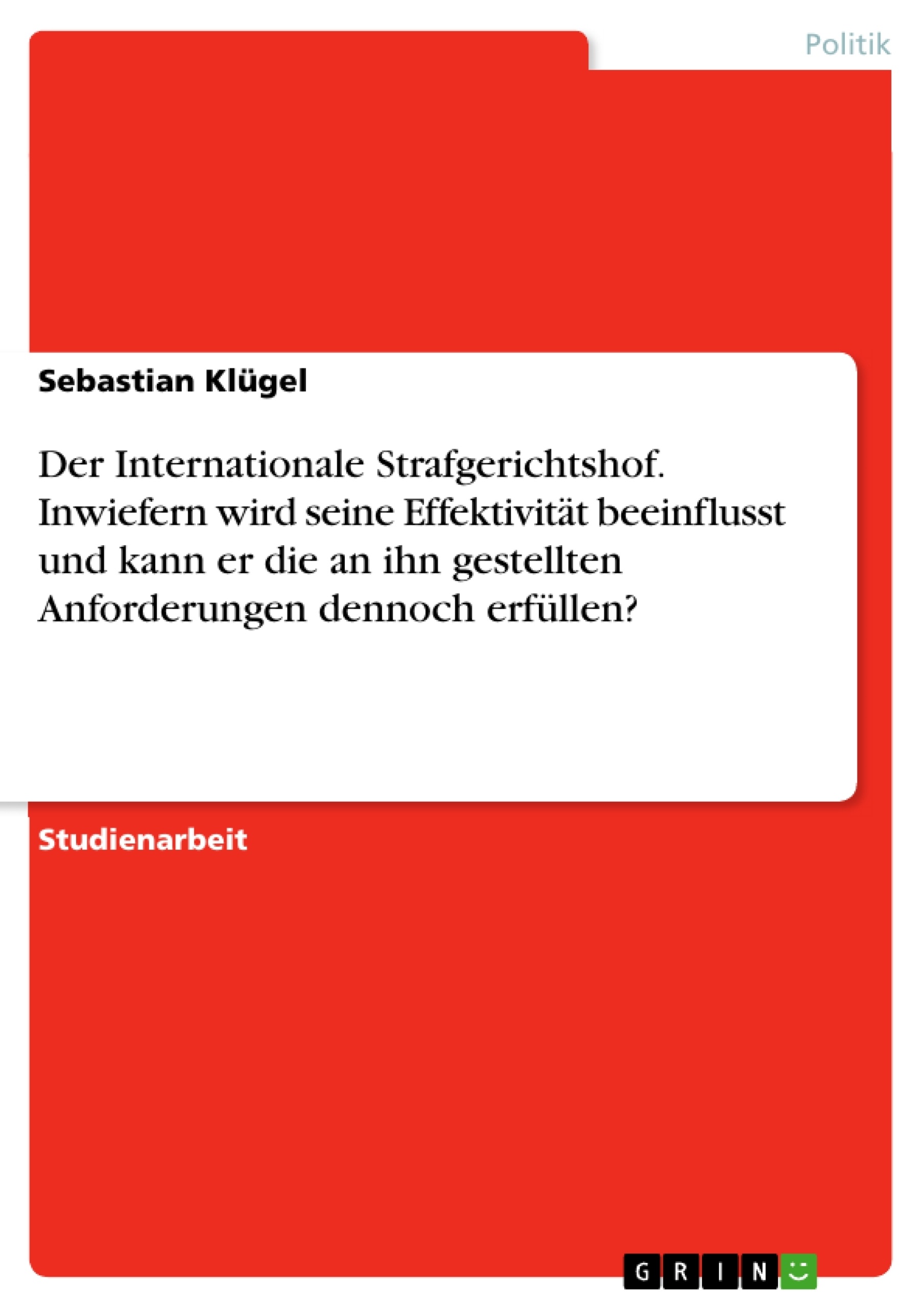In meiner folgenden Arbeit werde ich einen kurzen Überblick geben über das ‚Römische Statut‘ und im Weiteren auf den Prozess der Strafverfolgung und ihre Effektivität durch den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) eingehen. Der Schwerpunkt meiner Arbeit soll auf der Ablehnenden Haltung der mächtigen Staaten gegenüber des IStGH liegen und inwiefern er unter dieser Prämisse die an ihn gestellten Anforderungen erfüllen kann.
Die Entstehung des Internationalen Strafgerichtshofes wie wir ihn heute kennen war ein langwieriger Prozess und möglich gemacht wurde dies auch nur durch die Historie des vergangenen 20. Jahrhunderts. Doch schon frühen Mittelalter wurde, mittels der kirchlichen Strafgewalt von Päpsten über Kriegsverbrecher geurteilt. Weiter führt uns die Geschichte zu Augustinus, der den ‚gerechten Krieg‘ proklamierte und damit das Prinzip, dass ein Krieg nur aus gerechten Gründen geführt werden darf. Von hoher Wichtigkeit in diesem Entwicklungsprozess ist die Entstehung des Kriegsvölkerrecht und hierbei ist insbesondere ein Name zu nennen: Hugo Grotius (1583 – 1645). In seinem berühmtesten Werk ‚de iure belli ac pacis‘ unterscheidet er zwischen dem ‚Recht zum Krieg‘ und dem ‚Recht im Krieg‘. Auch im Krieg muss das Recht vorherrschen.
Die großen Meilensteine in dieser Entwicklung waren die Gründung des Internationalen Roten Kreuzes, die erste Genfer Konvention von 1864 und die Haager Friedenskonferenzen von 1899 und 1907, in deren Konsequenz der Einsatz von besonders grausamen Arten der Kriegsführung verboten wurde. Den großen Durchbruch im Völkerstrafrecht gab es allerdings erst nach Beendigung des zweiten Weltkrieges mit dem Beginn der Nürnberger Prozesse und der parallel ablaufenden Prozesse in Tokyo. Hier sieht man den ersten Fall einer überstaatlichen Gerichtsbarkeit mit einer entsprechenden Verurteilung der Angeklagten. Obwohl an diesen ad hoc Prozessen durchaus auch scharfe Kritik erlaubt ist, bilden sie doch den Grundstein für die Errichtung eines ständigen Internationalen Strafgerichtshof. Was als nächstes folgte war die Erstellung eines Statuts auf dessen Grundlage Urteile gefällt werden können. Dies erfolgte in enger Kooperation der Vereinten Nationen mit der International Law Commission. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Geschichte des Völkerstrafrechts und der Entstehung des IStGH
- Das Römische Statut
- Die Strafverfolgung
- Anerkennung durch die internationale Staatengemeinschaft und Kooperation
- Der IStGH und der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
- Die Ablehnung des IStGH durch die USA
- Kann der IStGH seinen Anforderungen gerecht werden
- Die Zukunft des IStGH
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) und untersucht dessen Effektivität. Sie analysiert die Geschichte des Völkerstrafrechts und die Entstehung des IStGH, beleuchtet den Prozess der Strafverfolgung und dessen Herausforderungen sowie die Haltung wichtiger Staaten wie der USA gegenüber dem IStGH. Die Arbeit geht der Frage nach, ob der IStGH seinen Anforderungen gerecht werden kann und welche Rolle der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in diesem Kontext spielt.
- Die Geschichte des Völkerstrafrechts und die Entstehung des IStGH
- Die Strafverfolgung durch den IStGH und die Herausforderungen der Kooperation mit Staaten
- Der Einfluss des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen auf den IStGH
- Die Ablehnung des IStGH durch die USA und deren Folgen
- Die Effektivität des IStGH im Kontext der internationalen Politik und Rechtsprechung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Geschichte des Völkerstrafrechts und der Entstehung des IStGH
Das Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung des Völkerstrafrechts, beginnend mit der kirchlichen Strafgewalt im Mittelalter und der Entwicklung des Kriegsvölkerrechts durch Hugo Grotius. Es beschreibt die Meilensteine der internationalen Rechtsentwicklung, wie die Gründung des Internationalen Roten Kreuzes, die Genfer Konventionen und die Haager Friedenskonferenzen. Der Fokus liegt auf der Entstehung des IStGH und der Verabschiedung des Römischen Statuts, das die Grundlage für dessen Aufgaben und Befugnisse bildet. Das Kapitel erklärt die wichtigsten Inhalte des Römischen Statuts, wie die Definition der schwersten Verbrechen, die Gerichtsbarkeit und die Zusammenarbeit mit Vertragsstaaten.
1.2 Die Strafverfolgung
Dieses Kapitel schildert den Prozess der Strafverfolgung am Beispiel der Demokratischen Republik Kongo. Es erläutert die Schritte der Ermittlungen und die erste Anklageerhebung durch den IStGH. Der Fokus liegt auf der Bedeutung der internationalen Anerkennung und Kooperation für die Effektivität des Gerichtshofs. Das Kapitel beleuchtet die Herausforderungen der Kooperation mit Staaten, die das Römische Statut nicht unterzeichnet haben und die Rolle des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen im Kontext der Strafverfolgung.
1.2.1 Anerkennung durch die internationale Staatengemeinschaft und Kooperation
Dieses Kapitel befasst sich mit der Bedeutung der Anerkennung des IStGH durch die Staatengemeinschaft und der Notwendigkeit der Zusammenarbeit zwischen dem Gerichtshof und seinen Mitgliedsstaaten. Es analysiert die Verpflichtungen der Vertragsstaaten zur Kooperation, die Herausforderungen im Umgang mit Nicht-Vertragsstaaten und die mögliche Einflussnahme des Sicherheitsrates auf die Zusammenarbeit.
1.2.2 Der IStGH und der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Das Kapitel untersucht das komplexe Verhältnis zwischen dem IStGH und dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Es zeigt die Überschneidung der Aufgabenfelder und die Einflussmöglichkeiten des Sicherheitsrates auf den Gerichtshof, wie die Möglichkeit der eigenen Anklageerhebung oder die Aussetzung von Ermittlungen. Die Arbeit beleuchtet die mögliche indirekte Einflussnahme des Sicherheitsrates durch die Auferlegung von Verpflichtungen an Mitgliedsstaaten, die im Widerspruch zum Römischen Statut stehen können.
1.2.3 Die Ablehnung des IStGH durch die USA
Dieses Kapitel analysiert die Ablehnung des Römischen Statuts durch die USA und deren Folgen für die Effektivität des IStGH. Es beleuchtet die Gründe für diese Ablehnung, wie den Schutz der eigenen Soldaten vor Strafverfolgung und den Einfluss auf die internationale Rechtsprechung. Das Kapitel diskutiert die Reaktion der US-Regierung auf das Römische Statut, wie die Verabschiedung des American Servicemembers‘ Protection Act und die Verhandlung von bilateralen Abkommen zur Verhinderung der Auslieferung von US-Soldaten.
1.3 Kann der IStGH seinen Anforderungen gerecht werden
Das Kapitel untersucht die Frage, ob der IStGH seinen Anforderungen gerecht werden kann und ob seine Effektivität ausreicht, um seinen Aufgaben gerecht zu werden. Es analysiert die Indikatoren für eine effektive Arbeit des Gerichtshofs, wie die Kontrolle über die Gerichtsbarkeit und die Angeklagten, die Kooperation mit den Mächten und die Integrität der Verfahren. Die Arbeit zeigt die Abhängigkeit des IStGH von der Zusammenarbeit mit seinen Mitgliedsstaaten und den Einfluss des Sicherheitsrates auf die Effektivität des Gerichtshofs.
Schlüsselwörter
Völkerstrafrecht, Internationaler Strafgerichtshof (IStGH), Römisches Statut, Strafverfolgung, internationale Staatengemeinschaft, Kooperation, Sicherheitsrat, Vereinte Nationen, USA, Effektivität, Unabhängigkeit, Ad-hoc Gerichte, Rechtsprechung, Internationale Justiz
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Römische Statut?
Das Römische Statut ist die völkerrechtliche Grundlage des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH), das dessen Aufgaben, Befugnisse und die Zusammenarbeit mit Staaten regelt.
Warum lehnen die USA den Internationalen Strafgerichtshof ab?
Die USA befürchten politisch motivierte Anklagen gegen ihre eigenen Soldaten und lehnen eine überstaatliche Gerichtsbarkeit ab, die ihre nationale Souveränität einschränken könnte.
Welche Rolle spielt der UN-Sicherheitsrat für den IStGH?
Der Sicherheitsrat kann Fälle an den IStGH überweisen, aber auch Ermittlungen für ein Jahr aussetzen, was zu einer politischen Beeinflussung der Justiz führen kann.
Was war der Meilenstein der Nürnberger Prozesse?
Die Nürnberger Prozesse bildeten den Grundstein für das moderne Völkerstrafrecht, da erstmals eine überstaatliche Gerichtsbarkeit Individuen für Kriegsverbrechen verurteilte.
Kann der IStGH seine Aufgaben ohne die USA erfüllen?
Die Effektivität ist eingeschränkt, da der IStGH auf die Kooperation der Weltmächte angewiesen ist, um Haftbefehle zu vollstrecken und Beweise zu sichern.
- Arbeit zitieren
- Sebastian Klügel (Autor:in), 2015, Der Internationale Strafgerichtshof. Inwiefern wird seine Effektivität beeinflusst und kann er die an ihn gestellten Anforderungen dennoch erfüllen?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/370403