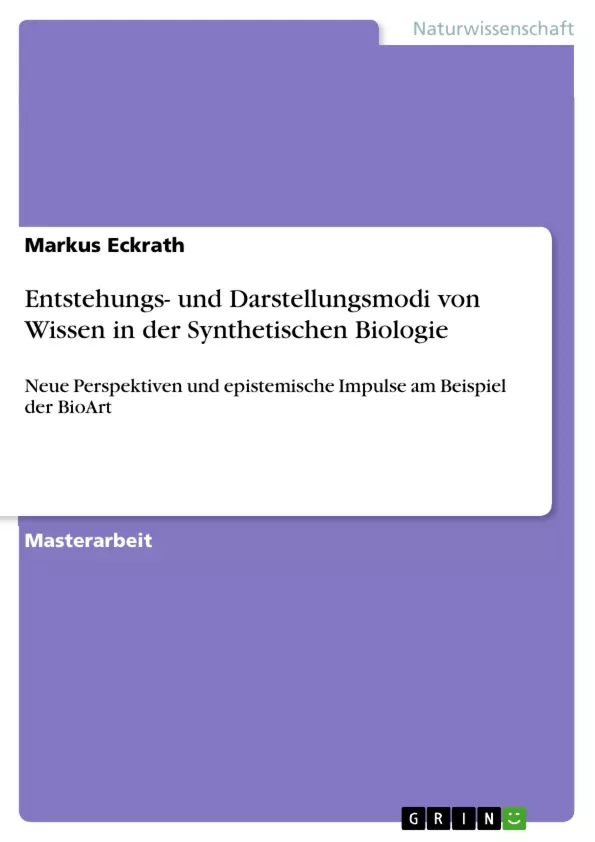Der Fokus der vorliegenden Arbeit soll auf der Kommunikation und Zirkulation von Wissen im Rahmen der Synthetischen Biologie liegen. Im Mittelpunkt des Interesses stehen die Darstellungsstrategien, Redeweisen und Visualisierungstechniken, die im Zuge dieser Wissensform zur Anwendung gebracht werden. Ausgehend von der Beobachtung, dass sich in Form einer »Do-it-yourself-Biologie« und einer kunstforschenden BioArt-Szene zwei gestaltungsfreudige Wissensformationen gebildet haben, die sich dem Selbstverständnis nach jenseits des institutionalisierten Wissenschaftsbetriebes positionieren, lässt sich die dieser Arbeit zugrundeliegende Fragestellung entwickeln. Das vorrangige Ziel soll darin bestehen, den Einfluss jener Formationen auf die Entstehungs- und Darstellungsmodi von Wissen (und Wissenschaft) hinsichtlich der Synthetischen Biologie zu untersuchen und diese Impulse und neuen Perspektiven aus einem medien- und kulturwissenschaftlichen Blickwinkel heraus einzuordnen. Die damit einhergehende Analyse bedarf einer Auseinandersetzung mit weiteren zentralen Aspekten: Inwiefern unterscheiden sich die Darstellungs- und Popularisierungsstrategien der DIY-Bewegung sowie der BioArt von einer »konventionellen« Wissenschaftskommunikation? Worauf beruht das Innovationsmoment dieser Ansätze? Was tragen diese Formen auf welchen Ebenen konkret bei? Brechen sie mit den Strukturen des etablierten Wissenschaftsbetriebes und verändern sie dessen Gesicht oder ordnen sich die Amateurbiologen und Biokünstler vielmehr den forschungspolitischen Zielen und Zwecken unter? Und wie bezieht eine Öffentlichkeit zu diesen Entwicklungen Stellung?
In etymologischer Hinsicht hat sich der Begriff der Synthetischen Biologie als durchaus wandelbar erwiesen. Der oftmals zitierte begriffliche Ursprung in der »Biologie Synthétique« des französischen Biologen Stéphane Leduc Anfang des 20. Jahrhunderts hat demzufolge nur noch wenig mit dem heutigen Selbstverständnis einer unter diesem Terminus verhandelten Wissenschaftsdisziplin gemein. Während vor allem in der Gentechnik das Modifizieren und Manipulieren seit den 1960er-Jahren die wesentliche Triebfeder in den Biowissenschaften darstellte, so rückte in den vergangenen zwei Dekaden das Herstellen als eine neue »Biokulturtechnik« in den Blickpunkt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. SYNTHETISCHE BIOLOGIE: DIMENSIONEN EINER WISSENSFORM
- 2.1 DEFINITION(EN), MERKMALE, ANWENDUNGEN, VERFAHREN
- 2.2 DER INGENIEURWISSENSCHAFTLICHE BLICK AUF LEBENSPROZESSE
- 2.3 FORSCHUNGSÖKONOMIE UND DO-IT-YOURSELF-BEWEGUNG
- 2.4 KRITISCHE POSITIONEN AUS NATURWISSENSCHAFTLICHEM BLICKWINKEL
- 3. DIE GESELLSCHAFTLICHE RAHMUNG: ÖFFENTLICHKEIT, ETHIK, LEBEN
- 3.1 ÖFFENTLICHKEIT, AKZEPTANZ UND DAS ERBE DER GENTECHNIK
- 3.2 KONTROVERSE ASPEKTE UND SPANNUNGSFELDER IN ETHISCHER HINSICHT
- 3.3 DER LEBENSBEGRIFF UND DIE BEDEUTUNG DER MACHBARKEIT VON LEBEN
- 4. KOMMUNIKATION VON WISSEN UND WISSENSCHAFT IM RAHMEN DER SYNTHETISCHEN BIOLOGIE
- 4.1 DARSTELLUNGSSTRATEGIEN ZWISCHEN VERHEIBUNG UND MENETEKEL
- 4.2 JUGENDLICHER DIY-GEIST UND DIE ENTWICKLUNG NEUER FORMATE DER WISSENSKOMMUNIKATION
- 4.3 METAPHERN ALS KOMMUNIKATIONSMEDIEN UND PRODUKTIVE VORSTELLUNGSWELTEN
- 5. NEUE IMPULSE: ENTSTEHUNG UND DARSTELLUNG VON WISSEN AM BEISPIEL DER BIOART
- 5.1 NEUE KULTURTHEORETISCHE PERSPEKTIVEN ALS KÜNSTLERISCHER SCHAFFENSRAUM
- 5.2 BIO-KUNST ZWISCHEN ÄSTHETIK UND EPISTEMOLOGIE
- 5.3 ANALYSE EXEMPLARISCHER BIOART-PROJEKTE
- 5.4 REZEPTIONSMODI UND HALTUNGEN ZUR BIO-KUNST
- 5.5 MIKROPERFORMATIVITÄT UND DER EINSATZ VON KÖRPERSPUREN
- 6. FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Kommunikation und Zirkulation von Wissen im Rahmen der Synthetischen Biologie. Im Fokus stehen die Darstellungsstrategien, Redeweisen und Visualisierungstechniken, die im Zuge dieser Wissensform zur Anwendung kommen. Die Arbeit analysiert den Einfluss neuer Wissensformationen, wie der "Do-it-yourself-Biologie" und der BioArt, auf die Entstehungs- und Darstellungsmodi von Wissen und Wissenschaft. Dabei werden die Innovationsmomente dieser Ansätze, ihre Beiträge auf verschiedenen Ebenen und ihre Beziehung zum etablierten Wissenschaftsbetrieb untersucht.
- Die Bedeutung der "Do-it-yourself-Biologie" und der BioArt für die Wissenskommunikation
- Die Rolle von Metaphern und Vorstellungen in der Kommunikation der Synthetischen Biologie
- Die kulturtheoretischen Perspektiven und ästhetischen Aspekte der BioArt
- Der Einfluss der BioArt auf die Wissenskommunikation und die Epistemologie
- Die Rezeption der BioArt und ihre Beziehung zur wissenschaftlichen Sphäre
Zusammenfassung der Kapitel
Die ersten beiden Kapitel erörtern fachspezifische Gegebenheiten und grundlegende Zusammenhänge in der Synthetischen Biologie, um den Untersuchungsgegenstand in der Folge angemessen verhandeln zu können. Kapitel 3 skizziert das diskursive Feld der Synthetischen Biologie, einschließlich ethischer Implikationen, der Bedeutung von Öffentlichkeit und alltagsweltlicher Vorstellungen von Leben. Kapitel 4 untersucht die Inszenierung und Popularisierung von Wissen und Wissenschaft, wobei konventionelle Kommunikationsstrategien sowie die Rolle der Amateurbiologie in der Entwicklung neuer Formate der Wissensvermittlung beleuchtet werden. Das fünfte Kapitel widmet sich der BioArt und analysiert ihren kulturtheoretischen Rahmen, ihre Beiträge zur Wissenskommunikation und die Möglichkeiten, die sie für die Epistemologie eröffnet.
Schlüsselwörter
Synthetische Biologie, Do-it-yourself-Biologie, BioArt, Wissenskommunikation, Darstellungsstrategien, Metaphern, Kulturtheorie, Ästhetik, Epistemologie, Rezeption, Öffentlichkeit, Ethik.
- Citar trabajo
- Markus Eckrath (Autor), 2017, Entstehungs- und Darstellungsmodi von Wissen in der Synthetischen Biologie, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/370497