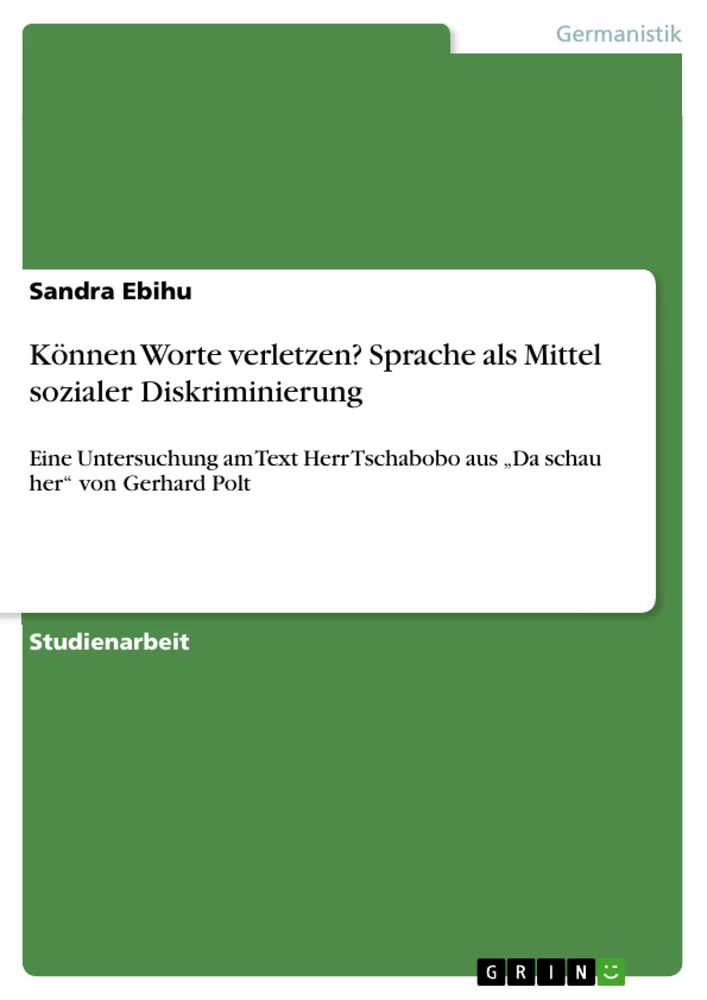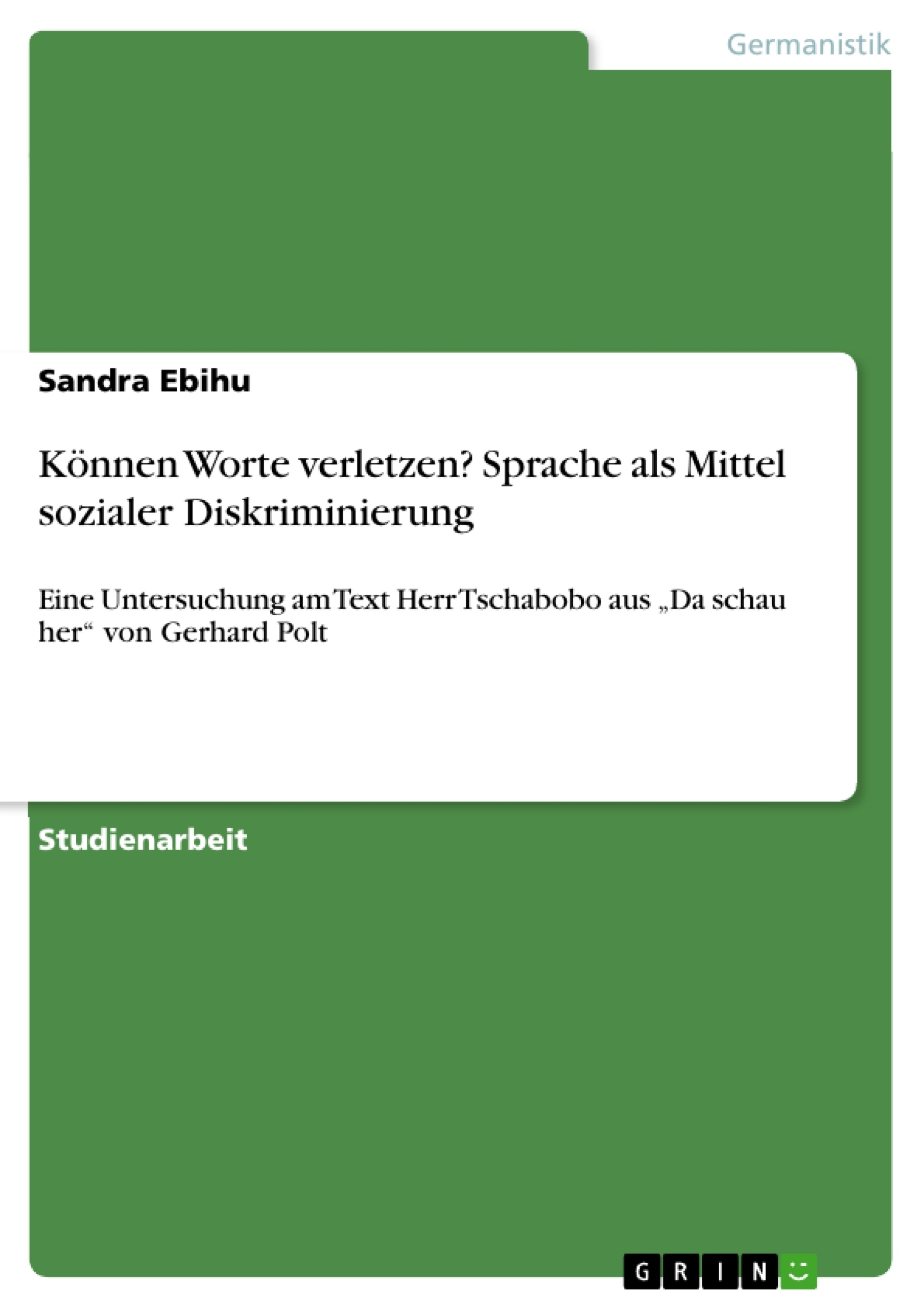Unsere heutige Gesellschaft befindet sich in einer Zeit in der bestimmte Gruppierungen, Handlungen und Geschehnisse vorurteilsbehaftet sind. Obwohl wir in einer scheinbar offenen multikulturellen Welt leben, stehen wir uns durch unsere angeborenen menschlichen Eigenschaften wie Egoismus, Einseitigkeit und Behäbigkeit oft selbst unbewusst oder auch bewusst für einen offenen gesellschaftlichen Blick im Weg. Dies kann sich offensichtlich durch Handlungen und Gesten, aber auch durch sprachliches Handeln widerspiegeln. Die Diskriminierung einer Person oder Gruppe wird oft nicht bewusst wahrgenommen. Durch einzelne Worte und Sprachmuster lassen wir uns dazu verleiten, zu kategorisieren, zu bewerten und zu verurteilen. Dies liegt in unserer menschlichen Struktur. Die Auswirkung einzelner Worte zeigt sich dabei nicht sofort, sondern offenbart sein Potenzial meist erst nach geraumer Zeit, wenn das gesprochene Wort schon lange verhallt ist. Diesen Aspekt nimmt Klemperer in seinem Zitat auf und regt somit zum Nachdenken an. Sprache spielt eine entscheidende Rolle in unserem Umgang mit anderen Menschen. Sie dient der Kommunikation, ohne derer unser Leben kaum vorstellbar erscheint. Sind wir uns bewusst über die geheime Botschaft unserer Worte? Viel zu oft werden umgangssprachlich im Alltag Wörter verwendet, deren versteckte Bedeutung dazu geeignet sind zu diskriminieren, ohne dass wir es merken und erkennen.
Diese Arbeit beschäftigt sich demnach mit der Frage, wie Sprache dazu geeignet sein kann, zu diskriminieren. Dabei soll zu Beginn eine kurze Definition zum Begriff Diskriminierung gegeben werden. Anschließend werden bestimmte sprachliche Mittel aufgezeigt, welche in diskriminierender Absicht verwendet werden können. Im Anschluss daran stellt sich die Frage welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, um diskriminierendes Sprechen überhaupt zu erkennen? Um die Frage, wie Worte verletzende Wirkung durch unbewusste oder bewusste Sprache haben können, wird als Untersuchungsgegenstand der Text von Gerhard Polt Herr Tschabobo herangezogen. Anhand von Textbeispielen werden die verschiedenen Dimensionen und Funktionen sozialer Diskriminierung in der Sprache aufgezeigt und dargestellt. Abschließend soll ein Fazit über die gewonnen Erkenntnisse gezogen werden.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Definition Diskriminierung
- III. Untersuchungsgegenstand sozialer Diskriminierung nach C. F. Graumann und M. Wintermantel
- 1. Sprache im Fokus diskriminierender Wirkung
- 2. Das Individuum im Fokus diskriminierender Wirkung
- IV. Soziale Diskriminierung - eine Untersuchung anhand des Textes „Herr Tschabobo“ von Gerhard Polt
- 1. Die Szene
- 2. Sprachliche Mittel sozialer Diskriminierung am Textbeispiel
- 3. Analyse einzelner auffälliger Phasen der Szene
- 3.1. Die Anfangsszene
- 3.2. Die Sprecher
- 3.3. Die Minderheit
- V. Fazit und Ausblick
- VI. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, wie Sprache als Mittel sozialer Diskriminierung eingesetzt werden kann. Ziel ist es, die diskriminierende Wirkung von Sprache aufzuzeigen und zu analysieren, welche sprachlichen Mittel hierfür verwendet werden. Der Fokus liegt auf der unbewussten oder bewussten Verwendung von Worten, die verletzende Wirkung haben können.
- Definition und Verständnis von Diskriminierung
- Sprachliche Mittel sozialer Diskriminierung
- Analyse diskriminierenden Sprechens anhand des Textes „Herr Tschabobo“
- Die Rolle von Stereotypen und Vorurteilen
- Wirkung von Sprache auf das Individuum
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der diskriminierenden Wirkung von Sprache. Sie verweist auf die allgegenwärtige Präsenz von Vorurteilen in unserer Gesellschaft und betont die oft unbewusste Natur diskriminierenden Verhaltens. Victor Klemperers Zitat über die unterschwellige Wirkung von Worten dient als Ausgangspunkt für die Untersuchung. Die Arbeit skizziert den Aufbau und die Methodik, die zur Beantwortung der Forschungsfrage eingesetzt werden.
II. Definition Diskriminierung: Dieses Kapitel liefert eine umfassende Definition des Begriffs „Diskriminierung“, beginnend mit seiner etymologischen Wurzel im Lateinischen. Es wird der Unterschied zwischen der wertfreien Bedeutung von „trennen“ oder „unterscheiden“ und der heutigen Bedeutung von „herabwürdigen“ und „benachteiligen“ herausgestellt. Der Kapitel beleuchtet die kognitiven Aspekte von Diskriminierung und argumentiert, dass Unterscheidungen an sich nicht böswillig sind, sondern ein natürlicher Prozess des Wahrnehmens und Kategorisierens darstellen.
III. Untersuchungsgegenstand sozialer Diskriminierung nach C. F. Graumann und M. Wintermantel: Dieses Kapitel beleuchtet den theoretischen Rahmen der Untersuchung. Es werden die Herausforderungen bei der Analyse sozialer Diskriminierung, insbesondere die enge Verknüpfung mit Stereotypen und Vorurteilen, diskutiert. Die Bedeutung von Sprache als Untersuchungsgegenstand für soziale Diskriminierung wird hervorgehoben, wobei die Kritik an der einseitigen Betrachtung von Sprache lediglich als Werkzeug betont wird. Der Kapitel betont die Notwendigkeit, Sprache als eigenständigen Untersuchungsschwerpunkt zu betrachten, um ihren diskriminierenden Charakter umfassend zu erfassen.
IV. Soziale Diskriminierung - eine Untersuchung anhand des Textes „Herr Tschabobo“ von Gerhard Polt: Dieses Kapitel analysiert Gerhard Polts Text „Herr Tschabobo“ um die verschiedenen Dimensionen und Funktionen sozialer Diskriminierung in der Sprache aufzuzeigen. Es werden die sprachlichen Mittel untersucht, die zur Diskriminierung beitragen, und es wird eine detaillierte Analyse der Szene und ihrer verschiedenen Phasen durchgeführt, inklusive der Rolle der Sprecher und der Darstellung der Minderheit. Der Fokus liegt auf der Entdeckung und Erläuterung der sprachlichen Mechanismen, die zur sozialen Diskriminierung beitragen.
Schlüsselwörter
Soziale Diskriminierung, Sprache, Diskriminierendes Sprechen, Vorurteile, Stereotype, Gerhard Polt, Herr Tschabobo, Interkulturelle Kommunikation, Kommunikation, Analyse, Textanalyse.
Häufig gestellte Fragen zu "Herr Tschabobo" und sozialer Diskriminierung
Was ist der Hauptgegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht, wie Sprache als Mittel sozialer Diskriminierung eingesetzt werden kann. Der Fokus liegt auf der Analyse der diskriminierenden Wirkung von Sprache und der verwendeten sprachlichen Mittel, sowohl bewusst als auch unbewusst.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition von Diskriminierung, sprachliche Mittel sozialer Diskriminierung, eine Analyse diskriminierenden Sprechens anhand des Textes „Herr Tschabobo“ von Gerhard Polt, die Rolle von Stereotypen und Vorurteilen und die Wirkung von Sprache auf das Individuum.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Definition Diskriminierung, Untersuchungsgegenstand sozialer Diskriminierung nach Graumann und Wintermantel, Soziale Diskriminierung anhand von "Herr Tschabobo", Fazit und Ausblick sowie Literaturverzeichnis. Jedes Kapitel behandelt einen Aspekt der Thematik, beginnend mit einer Einführung in das Thema und der Definition von Diskriminierung, über die theoretischen Grundlagen bis hin zur Analyse von "Herr Tschabobo" und einem abschließenden Fazit.
Welche Methodik wird in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit verwendet eine textanalytische Methode, um die diskriminierende Wirkung von Sprache in Gerhard Polts Text „Herr Tschabobo“ zu untersuchen. Sie analysiert die sprachlichen Mittel und die Szene im Detail, um die Mechanismen sozialer Diskriminierung aufzuzeigen.
Welche Rolle spielt der Text "Herr Tschabobo" in der Arbeit?
Der Text „Herr Tschabobo“ dient als Fallbeispiel, um die theoretischen Konzepte der sozialen Diskriminierung und der Rolle der Sprache darin zu illustrieren. Die Arbeit analysiert die sprachlichen Mittel in dem Text, die zur Diskriminierung beitragen, und untersucht die Szene detailliert, inklusive der Rolle der Sprecher und der Darstellung der Minderheit.
Welche Definition von Diskriminierung wird verwendet?
Die Arbeit bietet eine umfassende Definition von Diskriminierung, die sowohl die etymologische Wurzel als auch den Unterschied zwischen der wertfreien Bedeutung von „trennen“ oder „unterscheiden“ und der heutigen Bedeutung von „herabwürdigen“ und „benachteiligen“ beleuchtet. Dabei werden auch die kognitiven Aspekte von Diskriminierung betrachtet.
Welche theoretischen Ansätze werden berücksichtigt?
Die Arbeit bezieht sich auf die theoretischen Ansätze von C.F. Graumann und M. Wintermantel zur sozialen Diskriminierung. Sie diskutiert die Herausforderungen bei der Analyse sozialer Diskriminierung und die Bedeutung von Sprache als Untersuchungsgegenstand.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Das Fazit und der Ausblick der Arbeit werden im Kapitel V präsentiert und fassen die Ergebnisse der Analyse zusammen. Es ist zu erwarten, dass die Arbeit die diskriminierende Wirkung von Sprache belegt und die verwendeten sprachlichen Mittel benennt. Ein Ausblick auf weitere Forschungsfragen ist ebenfalls denkbar.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Soziale Diskriminierung, Sprache, Diskriminierendes Sprechen, Vorurteile, Stereotype, Gerhard Polt, Herr Tschabobo, Interkulturelle Kommunikation, Kommunikation, Analyse, Textanalyse.
- Quote paper
- Sandra Ebihu (Author), 2015, Können Worte verletzen? Sprache als Mittel sozialer Diskriminierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/370621