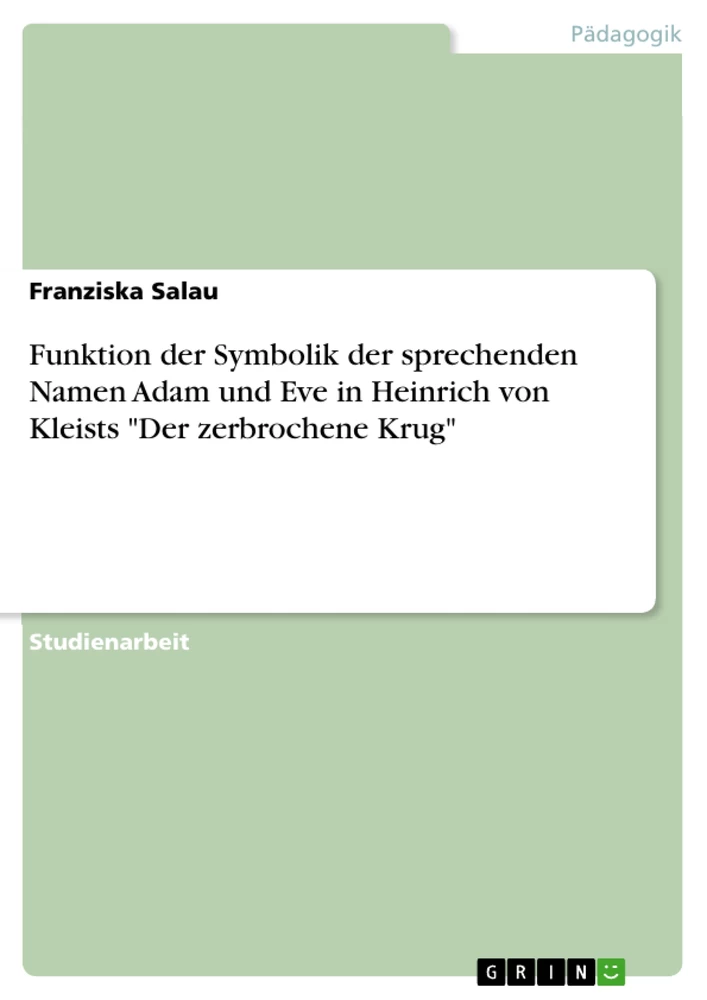In meiner Hausarbeit beschäftige ich mich mit der Fragestellung, ob die Symbolik der sprechenden Namen von Adam und Eve in Heinrich von Kleists „Der zerbrochene Krug“ und der auf sie bezogenen Gegenstände auf ihre eigentlichen charakterlichen Eigenschaften schließen lassen. Helfen sie uns demnach bei der Findung der Wirklichkeit innerhalb des Prozesses um den goldenen Krug?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sprechender Name Adam
- Der Sündenfall
- Die Symbolik des Klumpfußes
- Die Symbolik der Perücke
- Sprechender Name Eve
- Der zerbrochene Krug: Eves Mädchenehre und die Hochzeit
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Frage, ob die Symbolik der sprechenden Namen Adam und Eve in Heinrich von Kleists "Der zerbrochene Krug" und der auf sie bezogenen Gegenstände auf ihre eigentlichen charakterlichen Eigenschaften schließen lassen. Der Fokus liegt auf der Analyse dieser Symbolik und ihrer Bedeutung für das Verständnis der "Wirklichkeit" innerhalb des Prozesses um den goldenen Krug.
- Die Bedeutung von Symbolen in Kleists Dramen
- Die Symbolik der sprechenden Namen Adam und Eve
- Die Verbindung zwischen biblischen Motiven und den Charakteren
- Die Rolle der Objekte im Stück als Sinnbilder
- Die Konstruktion der "Wirklichkeit" durch Andeutungen und Symbole
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Fragestellung der Hausarbeit vor und erläutert die Bedeutung von Symbolen in der Literatur. Sie zeigt, wie Kleist mit Metaphern und Symbolen die Wirklichkeit verschleiert und verschiedene Ebenen erzeugt.Sprechender Name Adam
Dieses Kapitel untersucht den sprechenden Namen Adam als Hauptfigur des Stückes. Es wird auf den biblischen Bezug des Namens und seine symbolische Bedeutung eingegangen. Darüber hinaus werden Adams widersprüchliches Verhalten und seine Ausreden in Bezug auf den "Sündenfall" analysiert.Der Sündenfall
Dieser Abschnitt setzt den Fokus auf die biblischen Bezüge des Stückes und untersucht die Parallelen zwischen dem biblischen Sündenfall und Adams Verhalten im Stück. Es wird darauf hingewiesen, dass Adam, anders als in der Bibel, nicht erlöst wird, sondern als Sünder dargestellt bleibt.Die Symbolik des Klumpfußes
Hier wird die symbolische Bedeutung von Adams Klumpfuß beleuchtet. Der Klumpfuß wird als Zeichen für Adams Kreatürlichkeit und seine Unvollkommenheit interpretiert.Schlüsselwörter
Der zerbrochene Krug, Heinrich von Kleist, sprechende Namen, Adam und Eve, biblische Symbolik, Sündenfall, Klumpfuß, Perücke, Wirklichkeit, Metapher, Symbol, Andeutung, Lügennetz, Moral, Gericht, Recht, Gerechtigkeit, Verführung.
- Arbeit zitieren
- Franziska Salau (Autor:in), 2015, Funktion der Symbolik der sprechenden Namen Adam und Eve in Heinrich von Kleists "Der zerbrochene Krug", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/370738