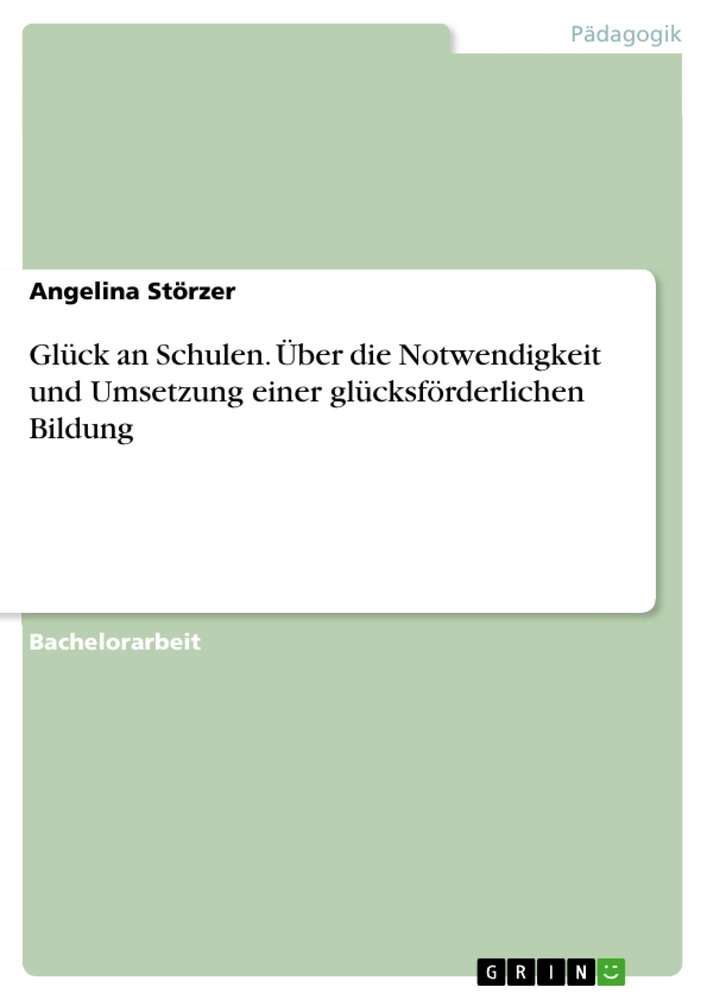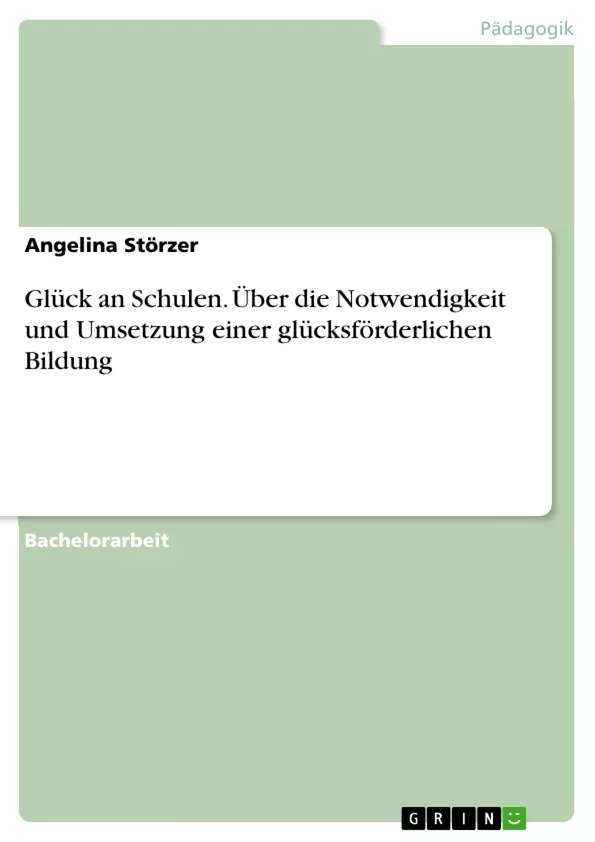"Kinder sollen glücklich sein – heute schlägt sich dieses Postulat in unzähligen Ratgebern nieder […] und niemand kann dem Postulat so recht widersprechen." (Oelkers 2011) Doch was genau ist mit "glücklich sein" gemeint und wie kann man Kindern das beibringen? Diese Fragen sind aufgrund der Annahme, dass Glück auf unterschiedliche Weise begriffen werden kann, nicht einfach zu beantworten. Schulen haben zweifellos einen wichtigen und umfangreichen Bildungsauftrag. Jedoch ist fraglich, ob es auch ihre Aufgabe sein soll, Kinder glücklich zu machen. Der Psychologe Martin Seligman (2011) nennt zwei Gründe, warum Wohlbefinden an Schulen gelehrt werden sollte: "die gegenwärtige Flut von Depression und die nur dem Anschein nach vorhandene Zunahme von Glück während der letzten beiden Generationen." Außerdem stellt er fest, "dass größeres Wohlbefinden das Lernen fördert, was ein traditionelles Ziel der Erziehung ist" (ebd.).
In dieser Bachelorarbeit werde ich mich mit den folgenden Forschungsfragen befassen:
1. Warum sollten Schüler Kompetenzen zum Glücklich-sein an Schulen erlernen?
2. Wie können Schulen das Glück der Schüler erhöhen?
Um diese Fragen beantworten zu können, werde ich zunächst die Bedeutung des Begriffs "Glück" darstellen. Danach erläutere zwei seit der Antike bestehenden Sichtweisen auf das Glück – den Hedonismus und den Eudaimonismus. Diese verschiedenen Ansätze bringt der Psychologe und Begründer der positiven Psychologie Martin Seligman in seiner Theorie des Wohlbefindens (PERMAModell) zusammen. Zudem werde ich diskutieren, inwieweit Geld glücklich macht und ob auch unsere Gene eine Rolle beim Glücksempfinden spielen. Warum immer mehr Menschen an psychischen Störungen leiden und wie man dem entgegenwirken kann, möchte ich im nächsten Schritt erläutern. Anschließend stelle ich im zweiten Teil der Arbeit das "Schulfach Glück" von Ernst Fritz-Schubert vor und untersuche, ob dieses Konzept möglicherweise ausreicht, um Schüler glücklicher zu machen. Im nächsten Schritt lege ich die Kritikpunkte am deutschen Schulsystem dar, welche für das Glücksempfinden der Schüler hinderlich sind.
Abschließend gehe ich noch auf das Konzept der Montessori-Pädagogik ein, welches in Deutschland an vielen Alternativschulen angeboten wird. Hier prüfe ich, inwieweit das Konzept Schüler glücklicher machen kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Über das Glück
- 2.1. Zum Glücksbegriff
- 2.2. Eudaimonismus versus Hedonismus
- 2.2.1. Eudaimonismus
- 2.2.2. Hedonismus
- 2.2.3. Lust und Tugend – Zusammenspiel statt Gegensatz
- 2.3. Erkenntnisse aus der Positiven Psychologie
- 2.3.1. Das PERMA-Modell nach Martin Seligman
- 2.3.2. Genetische Aspekte des Glücks
- 2.3.3. Macht Geld glücklich?
- 2.4. Anpassungs-Diskrepanz zwischen Steinzeit-Gehirn und Kulturwelt
- 2.5. Zusammenfassung
- 3. Glück in der Bildung
- 3.1. Effekte von Glückserleben auf kognitive Fähigkeiten
- 3.2. Schulfach Glück
- 3.2.1. Evaluation
- 3.2.2. Bewertung
- 3.3. Schulkritik
- 3.4. Die Montessori-Pädagogik
- 3.4.1. Studie von Rathunde & Csikszentmihalyi
- 3.4.2. Bewertung
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Notwendigkeit und Umsetzung glücksförderlicher Bildung an Schulen. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, warum Schüler Kompetenzen zum Glücklichsein erlernen sollten und wie Schulen das Glück ihrer Schüler erhöhen können. Hierfür werden verschiedene Glückskonzepte, der Einfluss von Faktoren wie Genetik und sozioökonomischem Status auf das Glück, sowie pädagogische Ansätze zur Förderung des Wohlbefindens beleuchtet.
- Definition und verschiedene Konzepte von Glück (Hedonismus, Eudaimonismus)
- Einflussfaktoren auf das Glück (Genetik, sozioökonomischer Status)
- Der Zusammenhang zwischen Glück und kognitiven Fähigkeiten
- Pädagogische Ansätze zur Glücksförderung (Schulfach Glück, Montessori-Pädagogik)
- Kritik am deutschen Schulsystem hinsichtlich des Glücksempfindens von Schülern
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der glücksförderlichen Bildung ein und stellt die zentrale Frage nach der Rolle von Schulen bei der Förderung des Schülerglücks. Ausgehend von der These, dass Glück mehrdimensional verstanden werden muss, werden die Forschungsfragen der Arbeit formuliert: Warum sollten Schüler Kompetenzen zum Glücklichsein an Schulen erlernen? Wie können Schulen das Glück der Schüler erhöhen? Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit und benennt die im Folgenden behandelten Aspekte, wie unterschiedliche Glückskonzepte, pädagogische Ansätze und Kritikpunkte am bestehenden Schulsystem.
2. Über das Glück: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit dem vielschichtigen Begriff des Glücks. Es werden Schwierigkeiten bei der Definition von „Glück“ im Deutschen aufgezeigt und verschiedene Glückskonzepte, insbesondere Hedonismus und Eudaimonismus, gegenübergestellt. Der Hedonismus, der auf der Maximierung von Lust und Vergnügen basiert, wird dem Eudaimonismus gegenübergestellt, der Tugendhaftigkeit und die Entfaltung des eigenen Potenzials als Schlüssel zum Glück betrachtet. Das Kapitel integriert Erkenntnisse aus der positiven Psychologie, insbesondere das PERMA-Modell von Seligman, und diskutiert den Einfluss von Faktoren wie Genetik und sozioökonomischem Status auf das subjektive Wohlbefinden. Die Frage nach dem Verhältnis von Glück und Zufriedenheit wird ebenfalls thematisiert.
3. Glück in der Bildung: Das Kapitel widmet sich der konkreten Umsetzung von Glücksförderung im Bildungskontext. Es untersucht den Einfluss des Glückserlebens auf kognitive Fähigkeiten und stellt das Konzept des „Schulfachs Glück“ von Ernst Fritz-Schubert vor. Eine kritische Auseinandersetzung mit dem deutschen Schulsystem hinsichtlich seiner Auswirkungen auf das Glücksempfinden der Schüler folgt. Abschließend wird die Montessori-Pädagogik als alternatives pädagogisches Konzept vorgestellt und hinsichtlich ihres Potenzials zur Glücksförderung bewertet. Dabei werden Studien zu diesem Thema herangezogen und die Ergebnisse kritisch diskutiert.
Schlüsselwörter
Glück, Glücksforschung, Hedonismus, Eudaimonismus, Positive Psychologie, PERMA-Modell, Bildung, Schule, Schülerwohlbefinden, Montessori-Pädagogik, Schulkritik, Wohlbefinden, Lebenszufriedenheit.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Glücksförderung in der Bildung
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht die Notwendigkeit und Umsetzung glücksfördernder Bildung an Schulen. Sie befasst sich mit der Frage, warum Schüler Kompetenzen zum Glücklichsein erlernen sollten und wie Schulen das Glück ihrer Schüler erhöhen können. Dafür werden verschiedene Glückskonzepte, der Einfluss von Faktoren wie Genetik und sozioökonomischem Status auf das Glück sowie pädagogische Ansätze zur Förderung des Wohlbefindens beleuchtet.
Welche Glückskonzepte werden behandelt?
Die Arbeit vergleicht vor allem Hedonismus und Eudaimonismus. Hedonismus wird als Maximierung von Lust und Vergnügen definiert, während Eudaimonismus Tugendhaftigkeit und die Entfaltung des eigenen Potenzials als Schlüssel zum Glück betrachtet. Zusätzlich wird das PERMA-Modell der Positiven Psychologie von Martin Seligman berücksichtigt.
Welche Einflussfaktoren auf das Glück werden untersucht?
Die Arbeit untersucht den Einfluss von genetischen Faktoren und dem sozioökonomischen Status auf das subjektive Wohlbefinden der Schüler. Der Zusammenhang zwischen Glück und kognitiven Fähigkeiten wird ebenfalls beleuchtet.
Welche pädagogischen Ansätze zur Glücksförderung werden vorgestellt?
Die Arbeit präsentiert das Konzept des „Schulfachs Glück“ und die Montessori-Pädagogik als alternative pädagogische Konzepte zur Glücksförderung. Studien zu diesen Ansätzen werden kritisch diskutiert.
Wie wird das deutsche Schulsystem kritisch betrachtet?
Die Arbeit enthält eine kritische Auseinandersetzung mit dem deutschen Schulsystem und seinen Auswirkungen auf das Glücksempfinden der Schüler. Es werden Schwachstellen aufgezeigt und Verbesserungspotenziale diskutiert.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über das Glück (inkl. Hedonismus, Eudaimonismus und positiver Psychologie), ein Kapitel über Glück in der Bildung (inkl. Schulfach Glück und Montessori-Pädagogik) und ein Fazit.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Glück, Glücksforschung, Hedonismus, Eudaimonismus, Positive Psychologie, PERMA-Modell, Bildung, Schule, Schülerwohlbefinden, Montessori-Pädagogik, Schulkritik, Wohlbefinden, Lebenszufriedenheit.
Welche Forschungsfragen werden in der Arbeit behandelt?
Die zentralen Forschungsfragen sind: Warum sollten Schüler Kompetenzen zum Glücklichsein an Schulen erlernen? Und: Wie können Schulen das Glück der Schüler erhöhen?
Welche Zusammenfassung der Kapitel bietet die Arbeit?
Die Arbeit bietet Kapitelzusammenfassungen, die jeweils die Kernaussagen und die behandelten Aspekte jedes Kapitels prägnant zusammenfassen.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Pädagogen, Bildungswissenschaftler, Studenten und alle, die sich für die Förderung des Wohlbefindens von Schülern und die Gestaltung eines glücksförderlichen Bildungssystems interessieren.
- Quote paper
- Angelina Störzer (Author), 2016, Glück an Schulen. Über die Notwendigkeit und Umsetzung einer glücksförderlichen Bildung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/370771