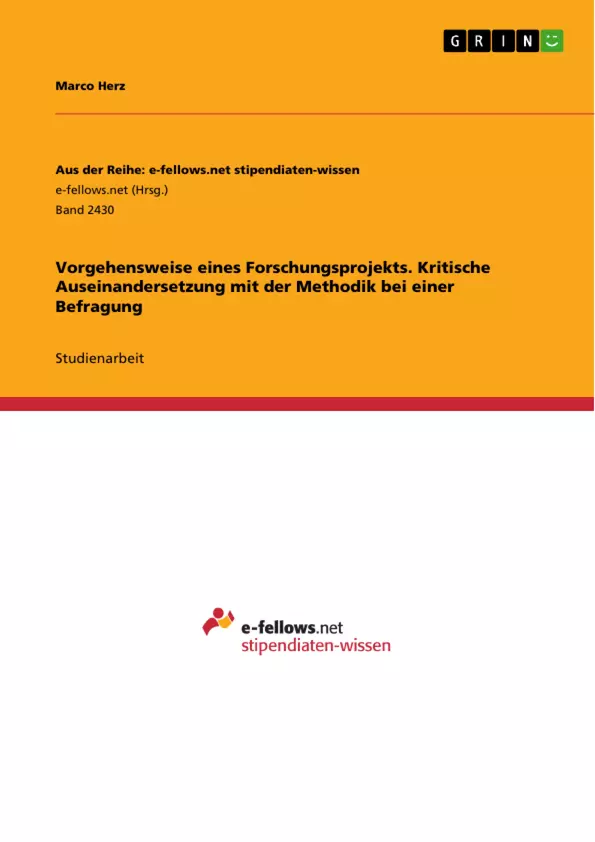Das Betrachtungsobjekt dieses Assignments ist das Forschungsprojekt einer empirischen Sozialforschung mitsamt der innewohnen Prozesse und Methoden. Dies vor dem Hintergrund der Analyse und Optimierung eines Fallbeispiels zu einer Online-Befragung.
In jüngster Vergangenheit häuft sich Kritik an den Medien, in welcher ihnen subjektive Berichterstattung oder gar „Fake News“ vorgeworfen wird. Gemäß einer Studie des Statistischen Bundesamtes sind fast 70 Prozent der Befragten im Jahr 2016 solche Falschmeldungen aufgefallen. Ein solcher Verlust der Glaubwürdigkeit des Journalismus kann dadurch entstehen, dass die Medien häufig nur einen Ausschnitt der Realität darstellen, der nicht verallgemeinert werden sollte. Im Unterschied dazu ist bei einem Forschungsprojekt die Glaubwürdigkeit sehr wichtig, diese wird erreicht indem eine vorgegebene Fragestellung anhand ausgewählter Methoden objektiv beantworten wird, so dass dies zu keinen Fehlschlüssen oder Verallgemeinerungen führt.
Neben dem Aspekt der Glaubwürdigkeit in der Forschung ist es für eine Wissensgesellschaft wie Deutschland auch essentiell Forschungsprojekte möglichst effektiv und effizient zu gestalten, um im Wettbewerb bestehen zu können und Steuergelder möglichst zielführend einzusetzen. Die Relevanz wird durch den Anstieg der öffentlichen Ausgaben für Hochschulen bestätigt. Diese sind seit dem Jahr 2000 von rd. 16,2 Mrd. Euro auf 28,6 Mrd. Euro in 2015 gestiegen, was einen Anstieg von über 75 Prozent darstellt.
Eine Methode der Datenerhebung, deren Verbreitung in der Vergangenheit durch das Internet stark zugenommen hat, ist die (Online-)Befragung. Diese Art der Datenerhebung wird kommerziell vor allem von Marktforschungsunternehmen durchgeführt. Auch hier hat in der Vergangenheit ein starkes Wachstum stattgefunden, welches das Interesse an solchen Forschungsmethoden und –projekten widerspiegelt. So hat sich der weltweite Umsatz von Marktforschungsunternehmen von 2010 bis 2015 um fast ein 30 Prozent auf 44 Mrd. US-Dollar gesteigert.
Die vorgenannten Aspekte zeugen somit von einer gesteigerten gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Relevanz der Auseinandersetzung mit Forschungsprojekten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Relevanz des Themenaspektes
- Ziele und Aufbau
- Begriffsdefinition
- Forschung
- Projekt
- Das Forschungsprojekt
- Planung des Forschungsprojekts
- Erhebungsverfahren und Auswertung des Forschungsprojekts
- Die Fallstudie
- Kritische Analyse
- Optimierungsansätze
- Schlussteil
- Fazit
- Kritische Würdigung
- Ausblick und kritische Faktoren
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Ausarbeitung befasst sich mit der Vorgehensweise eines Forschungsprojekts, insbesondere der kritischen Auseinandersetzung mit der Methodik bei einer Befragung. Das Ziel ist es, ein theoretisches Fundament für den Themenkomplex Forschungsprojekt zu schaffen und dieses anschließend anhand einer Fallstudie zu untersuchen und zu optimieren.
- Relevanz von Forschungsprojekten in der Wissensgesellschaft
- Effektive und effiziente Gestaltung von Forschungsprojekten
- Bedeutung der Glaubwürdigkeit in Forschungsprojekten
- Steigende Bedeutung von Online-Befragungen in der Forschung
- Kritische Analyse der Methodik bei Befragungen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 behandelt die Relevanz des Themenaspektes und die Ziele sowie den Aufbau der Ausarbeitung. Kapitel 2 definiert die zentralen Begriffe „Forschung" und „Projekt" und stellt verschiedene Arten von Forschung und Projektdefinitionen vor. Kapitel 3 erläutert die Planung eines Forschungsprojektes und die Methoden der Datenerhebung sowie deren Auswertung. Kapitel 4 analysiert die Fallstudie und identifiziert Optimierungspotentiale.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter dieser Arbeit umfassen Forschungsprojekt, empirische Sozialforschung, Methodik, Befragung, Online-Befragung, Fallstudie, kritische Analyse, Optimierungsansätze, Glaubwürdigkeit, Effizienz, Wissensgesellschaft, Datenerhebung, Auswertung.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Glaubwürdigkeit in der Forschung so wichtig?
Um Fehlschlüsse und unzulässige Verallgemeinerungen zu vermeiden und sich klar von subjektiver Berichterstattung oder "Fake News" abzugrenzen.
Welche Vorteile bietet eine Online-Befragung?
Sie ist kosteneffizient, erreicht schnell eine große Anzahl an Teilnehmern und ermöglicht eine automatisierte Datenerfassung.
Was sind die Phasen eines Forschungsprojekts?
Ein Projekt umfasst die Planung (Fragestellung, Hypothesen), die Datenerhebung, die Auswertung und die kritische Interpretation der Ergebnisse.
Was wird in der Fallstudie kritisch analysiert?
Die Arbeit untersucht methodische Fehler bei einer konkreten Online-Befragung und entwickelt Ansätze zur Optimierung der Datengüte.
Wie hat sich der Markt für Marktforschung entwickelt?
Der weltweite Umsatz stieg zwischen 2010 und 2015 um fast 30 % auf 44 Mrd. US-Dollar, was die wachsende Bedeutung datenbasierter Entscheidungen zeigt.
- Quote paper
- Marco Herz (Author), 2017, Vorgehensweise eines Forschungsprojekts. Kritische Auseinandersetzung mit der Methodik bei einer Befragung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/370832