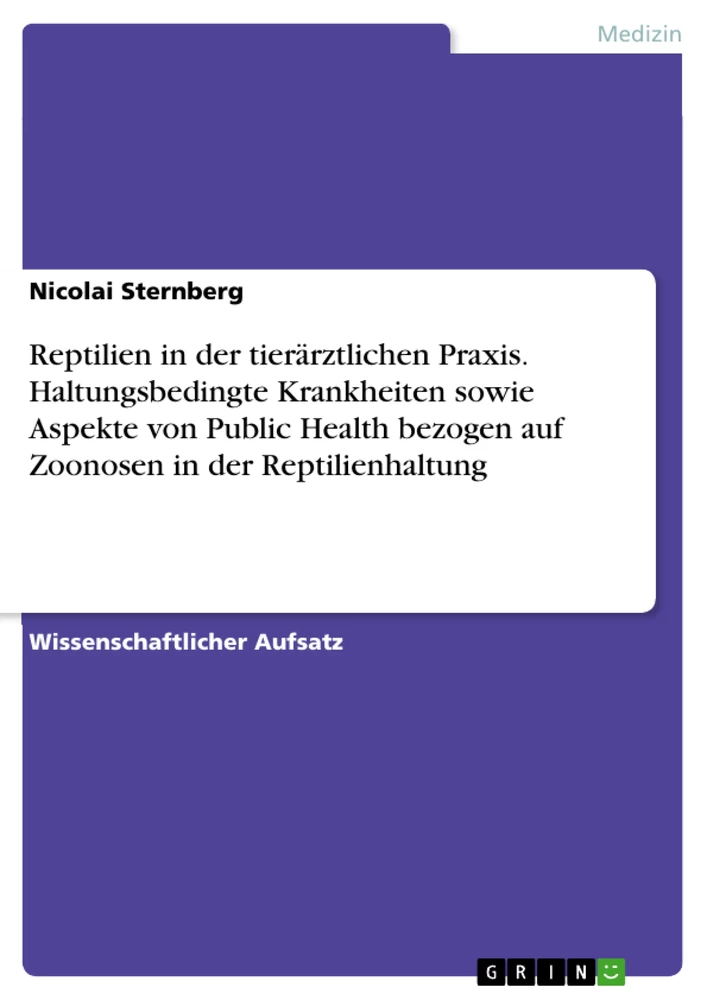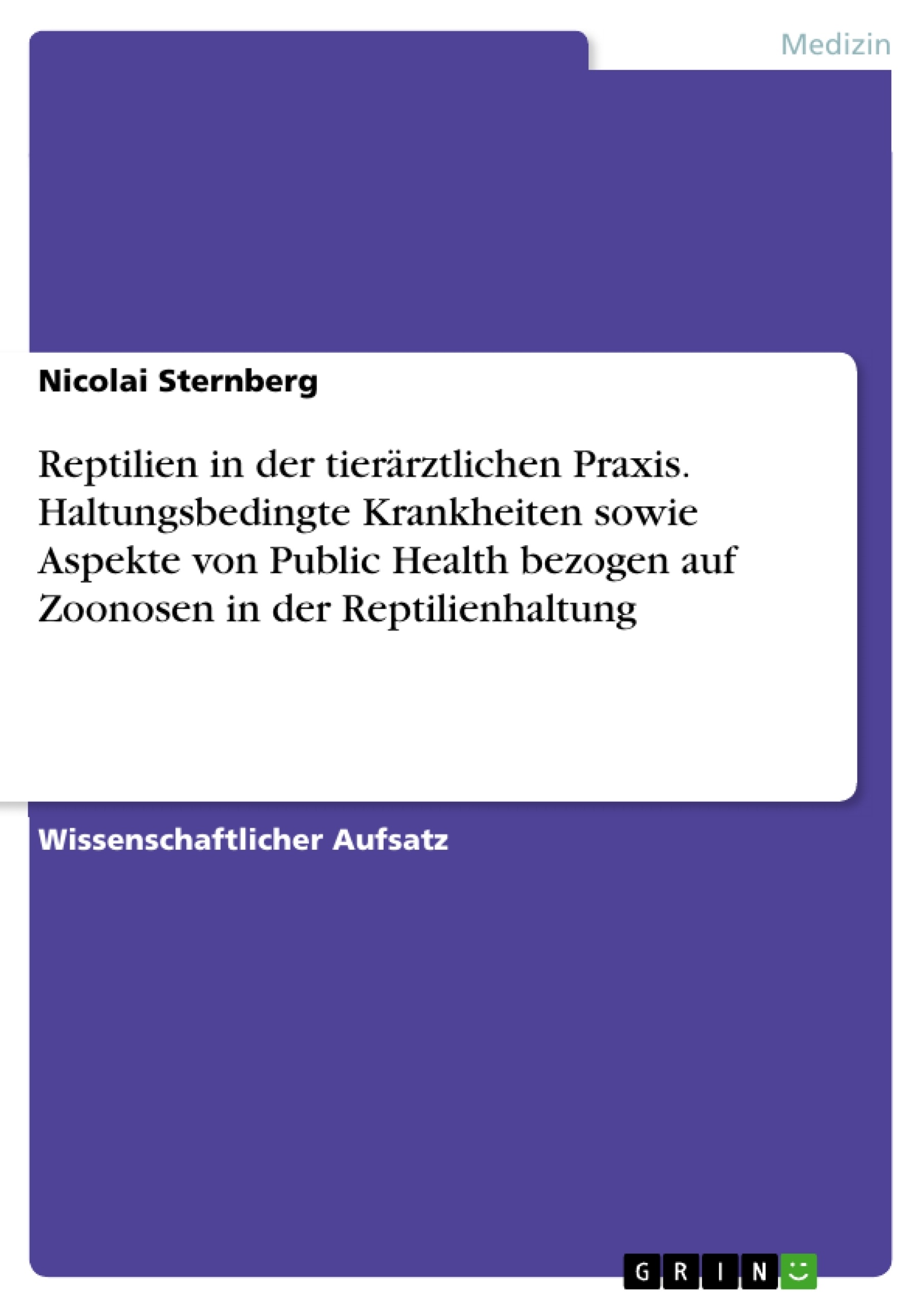In diesem Werk soll das Thema Reptilien als Patienten in der alltäglichen tierärztlichen Praxis im Hinblick auf Vorstellungsgründe und vor allem auf haltungsbedingte Krankheitsursachen und zoonotischen Gesichtspunkten behandelt werden.
Da die Klasse Reptilia einen großen Umfang an Spezies umfasst, sollen in dieser Arbeit lediglich auf einige Spezies, die häufig in der tierärztlichen Praxis vorgestellt werden, eingegangen werden. Auch sollen Gesichtspunkte von Public Health angesprochen werden, hier werden vor allem potentielle Zoonoseerreger behandelt, welche auch Gegenstand immer wiederkehrenden öffentlichen Diskussionen darstellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Reptilien in menschlicher Obhut
- Taxonomie
- Häufig gehaltene Spezies
- Vorstellungsgründe und haltungsbedingte Krankheitsursachen
- Chelonia (Schildkröten)
- Metabolic bone disease:
- Gicht:
- Hypervitaminose A:
- Jodmangel:
- Hypovitaminose A:
- Hypovitaminose-E:
- SCUD (Septicaemic cutaneous ulcerative disease):
- Pneumonie:
- Sauria (Echsen)
- Metabolic bone disease bei Echsen:
- Haltungsfehler beim Leguan:......
- Biẞverletzungen:
- Serpentes (Schlangen)
- Gicht bei Riesenschlangen:.........
- Thiaminmangel:
- Biotinmangel:....
- Häutungsprobleme/Blisterdisease….........
- Chelonia (Schildkröten)
- Public Health: Zoonotische Aspekte bei der Haltung von Reptilien in menschlicher Obhut
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Werk befasst sich mit Reptilien als Patienten in der tierärztlichen Praxis, wobei der Fokus auf Vorstellungsgründe, haltungsbedingte Krankheitsursachen und zoonotischen Aspekten liegt. Im Vordergrund stehen häufig in der Praxis präsentierte Reptilienarten wie europäische Landschildkröten, nordamerikanische Wasserschildkröten, Agamen, Leguane, Lidgeckos und Riesenschlangen. Die Arbeit konzentriert sich auf Krankheitsursachen, die durch falsche Haltung und Ernährung entstehen. Die artgerechte Haltung von Reptilien ist ein zentrales Thema, da diese durch Haltungsfehler und falsche Ernährung viele Krankheiten entwickeln können.
- Haltungsbedingte Krankheitsursachen bei Reptilien
- Zoonotische Aspekte bei der Haltung von Reptilien
- Vorstellung häufiger Reptilienarten in der tierärztlichen Praxis
- Prophylaxemedizin in der Reptilienhaltung
- Bedeutung der Ernährung für die Gesundheit von Reptilien
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt das Thema des Werkes vor und erläutert den Fokus auf Reptilien als Patienten in der tierärztlichen Praxis. Sie definiert den Umfang der Arbeit und benennt die relevanten Spezies, die behandelt werden. Besonderes Augenmerk liegt auf haltungsbedingten Krankheitsursachen, die durch falsche Haltung und Ernährung entstehen.
Reptilien in menschlicher Obhut
Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Taxonomie der Reptilien und beschreibt die häufigsten Spezies, die in der tierärztlichen Praxis vorgestellt werden. Die Kapitel 2.1 und 2.2 liefern wichtige Informationen über die Klassifizierung, die Haltung und die Ernährung der gängigen Reptilienarten.
Vorstellungsgründe und haltungsbedingte Krankheitsursachen
Dieses Kapitel behandelt die häufigsten haltungsbedingten Erkrankungen, die bei Schildkröten, Echsen und Schlangen auftreten können. Es beschreibt verschiedene Krankheitsbilder wie Metabolic bone disease, Gicht, Hypervitaminose A, Jodmangel, Hypovitaminose A, Hypovitaminose-E, SCUD, Pneumonie sowie Biẞverletzungen bei Echsen. Auch Häutungsprobleme/Blisterdisease bei Schlangen werden behandelt.
Schlüsselwörter
Reptilien, tierärztliche Praxis, Vorstellungsgründe, haltungsbedingte Krankheiten, Ernährung, Zoonosen, Schildkröten, Echsen, Schlangen, Metabolic bone disease, Gicht, Hypervitaminose A, Jodmangel, Hypovitaminose A, Hypovitaminose-E, SCUD, Pneumonie, Häutungsprobleme, Blisterdisease, Prophylaxemedizin, artgerechte Haltung, öffentliche Diskussion.
Häufig gestellte Fragen
Welche Reptilienarten werden am häufigsten in der tierärztlichen Praxis behandelt?
In der tierärztlichen Praxis werden vor allem europäische Landschildkröten, nordamerikanische Wasserschildkröten, Agamen, Leguane, Lidgeckos und Riesenschlangen vorgestellt.
Was sind die Hauptursachen für Krankheiten bei Reptilien in Heimtierhaltung?
Die meisten Erkrankungen bei Reptilien entstehen durch Fehler in der Haltung und eine falsche Ernährung.
Was versteht man unter der "Metabolic Bone Disease" bei Reptilien?
Die Metabolic Bone Disease (MBD) ist eine häufige haltungsbedingte Stoffwechselerkrankung der Knochen, die insbesondere bei Schildkröten und Echsen auftritt.
Welche zoonotischen Risiken bestehen bei der Reptilienhaltung?
Reptilien können potenzielle Zoonoseerreger übertragen, was im Rahmen von Public Health ein wichtiges Thema in der öffentlichen Diskussion darstellt.
Welche spezifischen Mangelerscheinungen können bei Schlangen auftreten?
Bei Schlangen werden häufig Thiaminmangel, Biotinmangel sowie Häutungsprobleme wie die Blisterdisease beobachtet.
Warum ist Prophylaxemedizin bei Reptilien so wichtig?
Da viele Krankheiten auf vermeidbare Haltungsfehler zurückzuführen sind, dient die Prophylaxe der Sicherstellung einer artgerechten Haltung und Ernährung.
- Quote paper
- Nicolai Sternberg (Author), 2017, Reptilien in der tierärztlichen Praxis. Haltungsbedingte Krankheiten sowie Aspekte von Public Health bezogen auf Zoonosen in der Reptilienhaltung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/370858