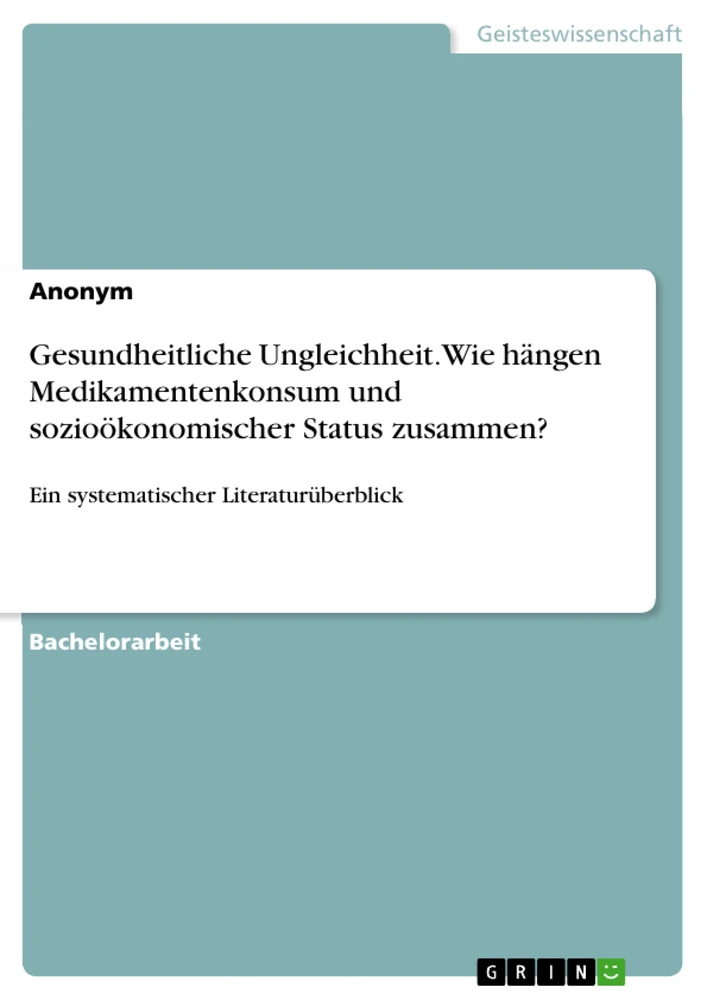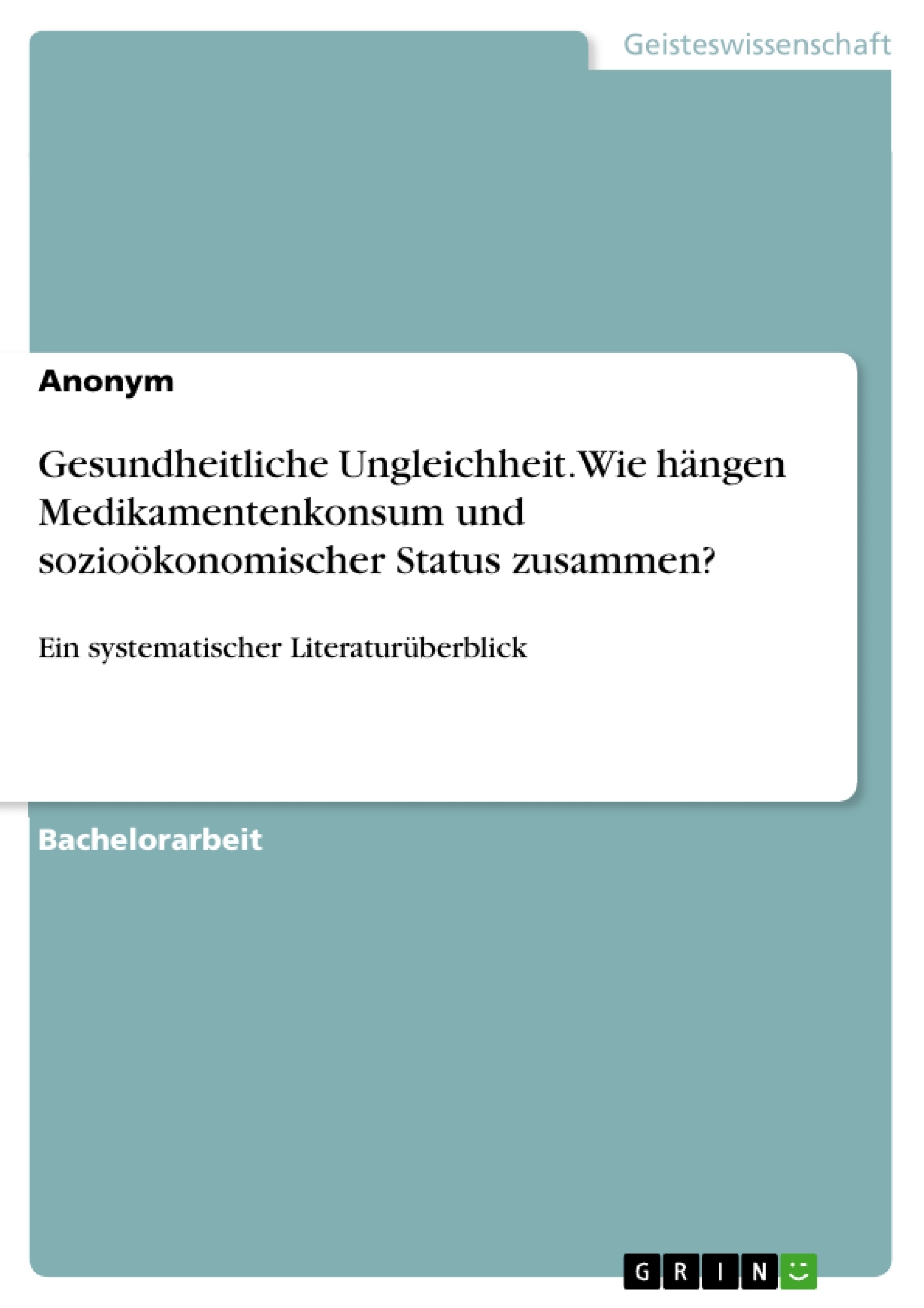Diese Arbeit soll einen Überblick über vorhandene empirische Evidenz zum Zusammenhang zwischen Medikamentenkonsum und sozialem Status schaffen. In diesem Sinne stehen folgende Forschungsfragen im Mittelpunkt der Arbeit: Erstens „Welche empirische Evidenz liegt vor, die einen Zusammenhang zwischen Medikamentenverbrauch und sozioökonomischen Status untersucht?“ und zweitens „Welche Ungleichheiten können aufgrund dieser vorliegenden Evidenz in der Medikamentennutzung nach sozioökonomischem Status der Nutzer/inn/en festgestellt werden?“
Vorab erfolgt eine kurze Erörterung der grundlegenden Begriffe im Zusammenhang mit gesundheitlicher Ungleichheit und verschiedener theoretischer Erklärungsansätze für dieses Phänomen. Folgend auf eine detaillierte Beschreibung der Vorgehensweise wird ein Rahmen zum Verständnis des Zusammenhanges zwischen sozialem Status und Arzneimittelgebrauch geschaffen.
In Form einer systematischen Literaturrecherche wurden empirische Studien, deren Forschungsinteressen sich mit obigen Forschungsfragen decken, identifiziert und im Anschluss nach Forschungsschwerpunkten gegliedert und diskutiert. Zielsetzung der Arbeit ist es, einen soliden Überblick über die internationale Evidenz zu dieser Thematik zu schaffen, welcher zusätzlich anhand einer tabellarischen Übersicht präsentiert wird. Letztendlich werden Schlussfolgerungen aus der Analyse der Literatur gezogen und weiterer Forschungsbedarf aufgezeigt.
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung
- Einführung
- Gesundheitliche Ungleichheit und deren Ursachen
- Wesentliche Begrifflichkeiten
- Ursachen gesundheitlicher Ungleichheit
- Methodik
- Einfluss des sozialen Status auf den Medikamentenkonsum – konzeptioneller Rahmen zur Wirkungsweise
- Medikamentenkonsum und sozialer Status – Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse der systematischen Literaturrecherche
- Überblick
- Allgemeine Medikamentennutzung bei Erwachsenen und Senioren
- Qualitätsunterschiede der Medikamente und Polypharmazie bei Erwachsenen und Senioren
- Medikamentennutzung bei Kindern und Jugendlichen
- Nutzung von Psychopharmaka und Kopfschmerztabletten
- Medikamentennutzung bei Patient/inn/en mit Herz-Kreislauferkrankungen und anderen Zivilisationskrankheiten
- Conclusio
- Anhang
- Tabellarischer Gesamtüberblick über identifizierte Studien
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Zusammenhang zwischen sozioökonomischem Status und Medikamentenkonsum. Ziel ist die Erstellung eines systematischen Literaturüberblicks über diesen Zusammenhang, insbesondere unter Berücksichtigung des Gesundheitszustandes in OECD-Staaten. Die Arbeit erforscht, ob und welche horizontalen Ungerechtigkeiten im Medikamentenkonsum nach sozioökonomischem Status bestehen.
- Empirische Evidenz zum Zusammenhang zwischen Medikamentenkonsum und sozioökonomischem Status
- Sozioökonomische Unterschiede in der Medikamentennutzung
- Rolle der Krankenversicherung und Selbstbeteiligung an Medikamentenkosten
- Einfluss von Bildung auf die Medikamentenwahl und -nutzung
- Potentielle Qualitätsunterschiede der Medikamente nach sozialem Status
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema der gesundheitlichen Ungleichheit und beleuchtet verschiedene theoretische Ansätze, die diese erklären. Anschließend werden die Methodik der systematischen Literaturrecherche und ein konzeptioneller Rahmen zum Verständnis des Einflusses des sozialen Status auf den Medikamentenkonsum vorgestellt. Die Kernteile der Arbeit befassen sich mit der Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse der identifizierten Studien, welche nach Forschungsschwerpunkten gegliedert sind. Zu den Themenbereichen gehören die allgemeine Medikamentennutzung bei Erwachsenen und Senioren, Qualitätsunterschiede der Medikamente und Polypharmazie, Medikamentennutzung bei Kindern und Jugendlichen, Nutzung von Psychopharmaka und Kopfschmerztabletten sowie Medikamentennutzung bei Patient/inn/en mit Herz-Kreislauferkrankungen und anderen Zivilisationskrankheiten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Zusammenhang zwischen sozialem Status und Medikamentenkonsum, insbesondere unter Berücksichtigung des Gesundheitszustandes in OECD-Staaten. Die Arbeit analysiert empirische Studien, die sich mit der Nutzung von Medikamenten verschiedener sozioökonomischer Gruppen befassen, und untersucht die Rolle von Faktoren wie Bildung, Einkommen, Krankenversicherungsschutz und Selbstbeteiligung an Medikamentenkosten.
Häufig gestellte Fragen
Wie hängen Medikamentenkonsum und sozialer Status zusammen?
Empirische Studien zeigen, dass der sozioökonomische Status (Einkommen, Bildung, Beruf) die Art, Häufigkeit und Qualität der genutzten Medikamente maßgeblich beeinflusst.
Gibt es Qualitätsunterschiede bei Medikamenten je nach sozialem Status?
Die Literaturrecherche deutet darauf hin, dass Personen mit höherem Status oft Zugang zu neueren oder teureren Präparaten haben, während einkommensschwächere Gruppen häufiger Basismedikamente nutzen.
Welchen Einfluss hat die Bildung auf die Medikamentennutzung?
Ein höheres Bildungsniveau korreliert oft mit einer gezielteren Medikamentenwahl und einer besseren Therapietreue (Adhärenz), aber auch mit einer kritischeren Haltung gegenüber unnötigem Konsum.
Wie wirkt sich die Selbstbeteiligung auf den Konsum aus?
Hohe Zuzahlungen oder Selbstbeteiligungen können dazu führen, dass Menschen mit niedrigem Einkommen notwendige Medikamente seltener erwerben oder die Behandlung vorzeitig abbrechen.
Gibt es Unterschiede bei der Nutzung von Psychopharmaka?
Die Arbeit untersucht spezifische Studien zur Nutzung von Psychopharmaka und Kopfschmerztabletten und stellt fest, dass hier deutliche soziale Gradienten in der Verschreibungspraxis vorliegen.
Was ist das Ziel dieser systematischen Literaturrecherche?
Ziel ist es, einen soliden Überblick über die internationale Evidenz (insbesondere in OECD-Staaten) zu schaffen und horizontale Ungerechtigkeiten in der Gesundheitsversorgung aufzuzeigen.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2013, Gesundheitliche Ungleichheit. Wie hängen Medikamentenkonsum und sozioökonomischer Status zusammen?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/370877