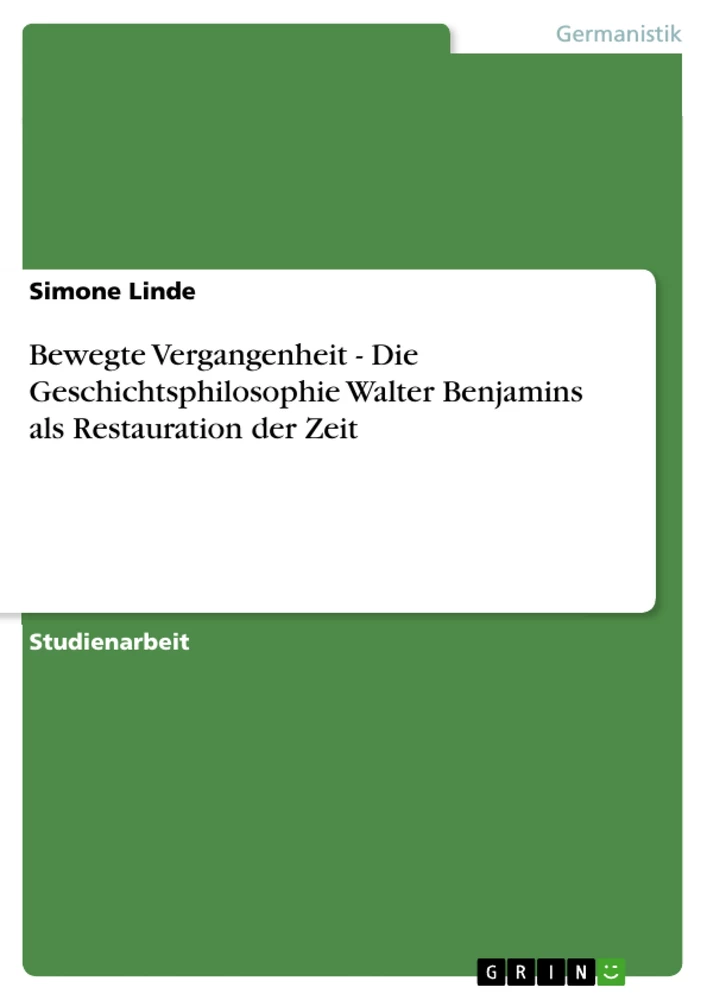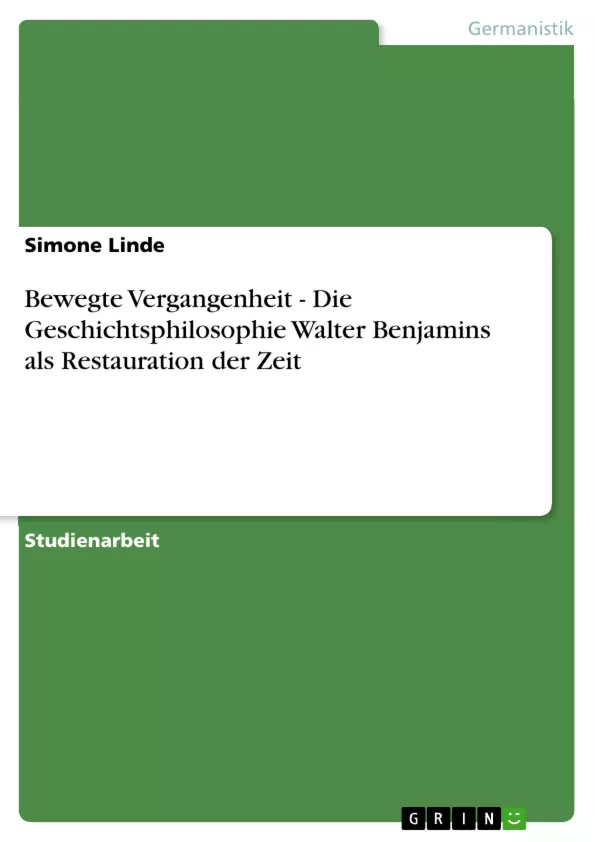Die Geschichtsphilosophie Walter Benjamins ist ein zentraler Punkt in seinem Gesamtwerk. Sie umfasst alle Bereiche, in denen Benjamin Untersuchungen angestellt hat - Sprachphilosophie, Medientheorie, Literaturkritik und Kulturwissenschaft – und integriert sie in ihren eigenen theoretischen Komplex. So kann sie als paradigmatisch für Benjamins Methode der Untersuchung gelten.
Benjamins Geschichtsphilosophie kehrt sich von der vorherrschenden Auffassung einer chronologischen Geschichtsschreibung ab, die in der Aufzählung von Geschehnissen besteht. Statt dessen versucht Benjamin eine Geschichtsschreibung zu schaffen, die die Objektivität durchbricht und die Erfahrung des einzelnen Individuums in den Mittelpunkt des geschichtlichen Verständnisses stellt.
Diese Theorie der Geschichte ist – wie jedes Geschichtskonzept - eng verbunden mit dem Zusammenhang zwischen Zeitverständnis und konkreten gesellschaftlichen Verhältnissen. Während die chronologische Geschichtsschreibung aber die eindimensionale Abfolge der Zeit als Grundprinzip nimmt, schafft Benjamin ein relatives Zeitverhältnis, welches sich von der Gegenwart her gründet. Dabei verbindet er materalistisches Gedankengut mit theologischen Grundmomenten zu einerrevolutionären, auf Erlösung gründenden Geschichtstheorie.
In der vorliegenden Arbeit wird untersucht, auf welche Weise die Zeit Benjamins Geschichtsphilosophie bedingt und in welcher Form sie von ihm verstanden wird.
Im ersten Teil stelle ich - ausgehend von Benjamins Verständnis der Vergangenheit als ungreifbarer, noch zu deutender Raum - die hermeneutischen Mittel dar, mit denen die Vergangenheit für die Gegenwart zu erschließen ist. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Benjamins Entwurf der Geschichte gegen die Auffassung einer Universalgeschichte. Ich zeige, wie Benjamin anstelle eines linearen Geschichtskontinuums durch das Zitat ein mehrdimensionales, durch Verbindungen gekennzeichnetes Spannungsfeld setzt, wodurch das Verständnis der Vergangenheit sich von der chronologischen Zeit löst.
Im zweiten Teil beschäftige ich mit der Erinnerungsästhetik Marcel Prousts, die Benjamin in seiner Erkenntnistheorie der Wahrnehmung beeinflußt hat. Ich zeige, inwieweit Benjamin Grundelemente der Proustschen Erinnerungsästhetik übernimmt, und sie modifiziert in seine Theorie überträgt. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Tatsache, dass Benjamin im Gegensatz zu Proust, der die Aufhebung der Zeit anstrebt, ein neues Verständnis von Zeit schafft.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hermeneutische Erschließung der Geschichte
- Dialektische Bilder
- Zitat
- Engel der Geschichte
- Das „Jetzt der Erkennbarkeit“ als Wahrheitsmoment - Verbindung zu Marcel Prousts Erinnerungsästhetik
- Mémoire involontaire und die Momente extra-temporels bei Proust
- Monade
- Erwachen
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Geschichtsphilosophie Walter Benjamins und untersucht, wie er die Zeit als ein zentrales Element in seinem Werk versteht. Sie analysiert Benjamins Ansatz, sich von einer traditionellen, chronologischen Geschichtsschreibung abzuwenden und stattdessen eine Geschichtsauffassung zu entwickeln, die die Erfahrung des Einzelnen in den Mittelpunkt stellt.
- Benjamins Kritik an der traditionellen Geschichtsschreibung
- Das Konzept der „Restauration der Zeit“ in Benjamins Geschichtsphilosophie
- Die Rolle der Erinnerung und des Zitates in der Erschließung der Vergangenheit
- Der Einfluss von Marcel Proust auf Benjamins Erinnerungsästhetik
- Die Verbindung von Materialismus und Theologie in Benjamins Geschichtsverständnis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung bietet einen Überblick über die zentrale Rolle der Geschichtsphilosophie im Werk von Walter Benjamin. Sie stellt fest, dass Benjamins Geschichtsauffassung von einer chronologischen Abfolge der Zeit abweicht und stattdessen die subjektive Erfahrung des Einzelnen in den Vordergrund stellt.
Kapitel 1 beleuchtet die hermeneutischen Mittel, mit denen Benjamin die Vergangenheit für die Gegenwart erschließt. Es diskutiert die Bedeutung von dialektischen Bildern und Zitaten für ein neues Verständnis der Geschichte, das sich von der linearen Zeitlichkeit löst.
Kapitel 2 beschäftigt sich mit der Verbindung zwischen Benjamins Geschichtsphilosophie und der Erinnerungsästhetik von Marcel Proust. Es analysiert, wie Benjamin Prousts Konzepte der „Mémoire involontaire“ und der „Momente extra-temporels“ in seine eigene Theorie überträgt und modifiziert.
Schlüsselwörter
Walter Benjamin, Geschichtsphilosophie, Zeit, Erinnerung, Zitat, dialektische Bilder, Marcel Proust, Erinnerungsästhetik, Materialismus, Theologie, Restauration der Zeit, Hermeneutik, Vergangenheit, Gegenwart.
Häufig gestellte Fragen
Was kritisiert Walter Benjamin an der traditionellen Geschichtsschreibung?
Benjamin lehnt eine rein chronologische Aufzählung von Ereignissen ab. Er möchte die Objektivität durchbrechen und die Erfahrung des Individuums ins Zentrum rücken.
Was sind „dialektische Bilder“?
Dies sind hermeneutische Mittel, mit denen die Vergangenheit für die Gegenwart erschlossen wird, indem ein spannungsreiches Verhältnis zwischen dem Damals und dem Jetzt erzeugt wird.
Welchen Einfluss hatte Marcel Proust auf Benjamin?
Benjamin übernahm Grundelemente von Prousts Erinnerungsästhetik, wie die „mémoire involontaire“ (unwillkürliches Erinnern), modifizierte sie jedoch für seine eigene Geschichtstheorie.
Wer ist der „Engel der Geschichte“?
Es ist ein zentrales Motiv in Benjamins Werk, das den Blick zurück auf die Trümmer der Vergangenheit richtet, während es von einem Sturm (dem Fortschritt) unaufhaltsam in die Zukunft getrieben wird.
Wie verbindet Benjamin Materialismus und Theologie?
In seiner Geschichtsphilosophie nutzt er theologische Begriffe wie „Erlösung“, um eine revolutionäre, materialistische Sicht auf die Geschichte zu begründen.
- Citar trabajo
- Simone Linde (Autor), 2000, Bewegte Vergangenheit - Die Geschichtsphilosophie Walter Benjamins als Restauration der Zeit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/3708