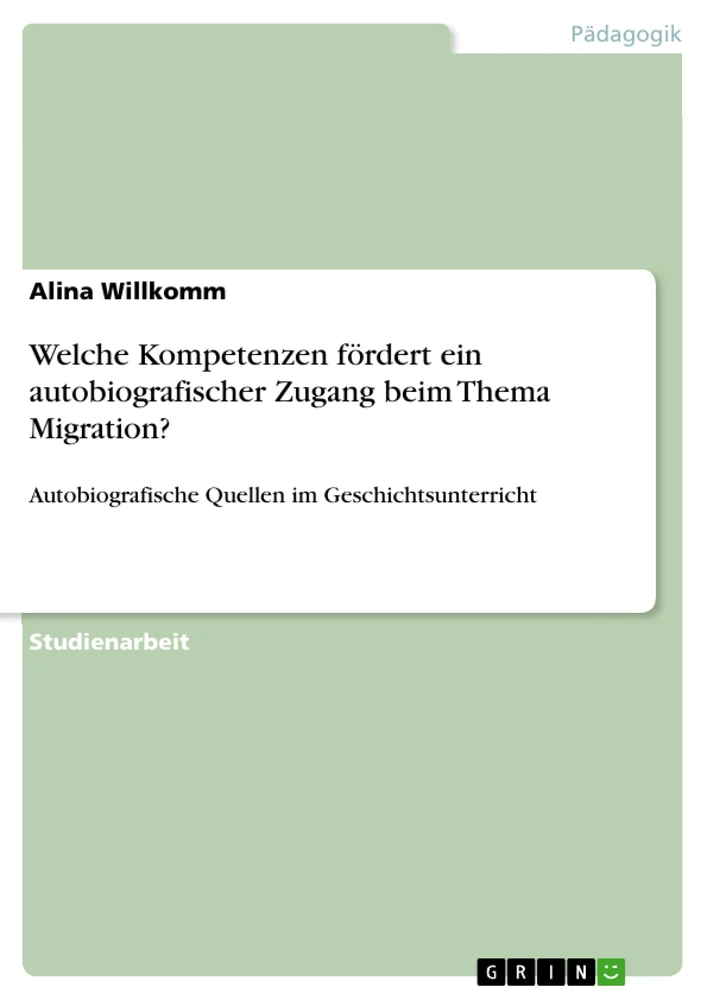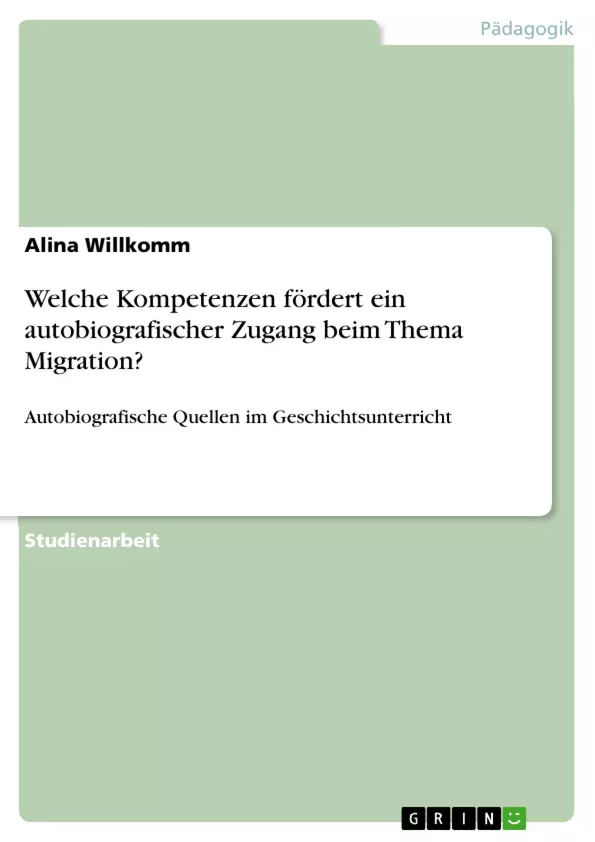Meine fiktive Unterrichtsstunde findet in der 9a des X-Gymnasiums statt. Die Schule befindet sich in X. Die Mehrzahl der Schüler dieser Klasse haben einen Migrationshintergrund. Die ,,a-Klassen“ dieser Schule sind zudem inklusiv. In der Klasse gibt es 28 Schülerinnen und Schüler, 16 davon kommen aus der Türkei, Syrien oder Tunesien. Die übrigen zwölf sind deutsche Kinder ohne Migrationshintergrund. Zwei der deutschen Kinder haben eine Lese-Rechtschreib-Schwäche und ein tunesischer Schüler ADHS. Grundsätzlich sind die Schüler dieser Klasse motiviert und geschichtlich interessiert, dennoch kommt es ab und an zu Auseinandersetzungen zwischen den deutschen Schülerinnen und Schülern mit den ausländischen Schülern. Dies ist generell ein Problem auf diesem Gymnasium, weswegen es in den Pausen auch immer zur Gruppenbildung kommt. Um genau dort anzusetzen, wird im Geschichtsunterricht das Thema Migration behandelt. Es passt zu der Lebenswelt der Schüler und soll ihnen einen reflektierten Blickwinkel auf ihren Umgang miteinander geben und dadurch die Klassengemeinschaft stärken.
In einer 9. Klasse erwarte ich einen regen Austausch zu dem Thema und erhoffe neue Erkenntnisse für die Schülerinnen und Schüler. Im besten Fall überdenken sie ihre aktuelle Einstellung zu dem Thema Migration, welches auch extrem durch die Flüchtlingskrise geprägt ist, und tauschen sich mit ihren ausländischen Klassenkameraden über deren eigenen Erfahrungen oder die ihrer Eltern und Großeltern aus. Aber nicht nur die deutschen Schülerinnen und Schüler sollen einen neuen Einblick in das Thema Migration bekommen, auch die ausländischen Schüler sollen erfahren, warum die deutschen eine ablehnende Haltung gegenüber den Migranten haben und ihnen dabei helfen eine neutrale Meinung zu bilden, damit die Klasse im besten Fall zu einer Gemeinschaft wird in der jeder den anderen akzeptiert wie er ist. Unabhängig von ihrer Herkunft.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung: Beschreibung der Lerngruppe.
- 2. Fachwissenschaftliche Analyse...
- 3. Didaktische Analyse.
- 3.1 Modell nach Klafki...
- 3.2 Modell nach Kösel, Reich und Voẞ
- 3.3 Modell nach Rüsen ......
- 3.4 Grundfragen der Unterrichtsplanung/Subjektorientierter Unterricht.
- 4. Planung...
- 4.1 Überblick/Einstieg....
- 4.2 Beginn der Gruppenarbeit .
- 4.3 Präsentation der Gruppenarbeit: Der Museumsrundgang
- 5. Fazit.
- 6. Literaturverzeichnis.......
- 7. Anhang/Tabellarischer Unterrichtsentwurf..
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Förderung von Kompetenzen im Geschichtsunterricht durch einen autobiografischen Zugang zum Thema Migration. Der Fokus liegt dabei auf der Gestaltung einer Unterrichtseinheit für eine 9. Klasse mit einem hohen Anteil an Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund. Die Arbeit beleuchtet die spezifischen Bedürfnisse und Herausforderungen dieser Lerngruppe im Kontext des Themas Migration und entwickelt einen didaktischen Ansatz, der die Interaktion und den Austausch innerhalb der Klasse fördert.
- Autobiografischer Zugang im Geschichtsunterricht
- Kompetenzförderung im Umgang mit dem Thema Migration
- Didaktische Konzepte und Modelle
- Integration und Inklusion in der Lerngruppe
- Entwicklung einer Unterrichtseinheit für die 9. Klasse
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Lerngruppe vor und beschreibt ihre spezifischen Merkmale, wie den hohen Anteil an Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund und die Inklusionsbedürfnisse. Sie erläutert die Relevanz des Themas Migration für die Lebenswelt der Schüler und die angestrebten Lernziele. Das zweite Kapitel befasst sich mit der fachwissenschaftlichen Analyse des Themas Migration und beleuchtet die historischen Einwanderungswellen und die Herausforderungen der Integration in Deutschland. Hierbei werden auch die unterschiedlichen Lebenslagen von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund und ihre besonderen Bedürfnisse im schulischen Kontext diskutiert. Das dritte Kapitel widmet sich der didaktischen Analyse und präsentiert verschiedene Modelle und Konzepte für den Geschichtsunterricht, wie das Modell nach Klafki, das Modell nach Kösel, Reich und Voẞ sowie das Modell nach Rüsen. Zudem werden die Grundfragen der Unterrichtsplanung und der Subjektorientierter Unterricht in Bezug auf das Thema Migration behandelt. Das vierte Kapitel beinhaltet die Planung einer Unterrichtseinheit, die verschiedene Phasen, wie den Einstieg, die Gruppenarbeit und die Präsentation, beinhaltet. Der Fokus liegt auf der Entwicklung eines interaktiven Lernformats, das den Schülerinnen und Schülern einen aktiven und reflektierten Umgang mit dem Thema Migration ermöglicht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen wie Migration, Geschichtsunterricht, Kompetenzförderung, autobiografischer Zugang, Integration, Inklusion, Unterrichtsplanung, didaktische Modelle und Lebenswelt der Schüler. Sie behandelt wichtige Aspekte der Integration von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund in den schulischen Kontext und erforscht die Rolle des Geschichtsunterrichts in der Förderung von Interkulturellem Verständnis und sozialer Kompetenz.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein autobiografischer Zugang im Geschichtsunterricht?
Dabei setzen sich Schüler mit persönlichen Lebensgeschichten (z.B. von Verwandten oder Zeitzeugen) auseinander, um historische Ereignisse wie Migration greifbarer zu machen.
Welche Kompetenzen werden beim Thema Migration gefördert?
Gefördert werden vor allem die historische Urteilskompetenz, Empathie, interkulturelles Verständnis und die Fähigkeit zur Selbstreflexion.
Wie kann Migration zur Stärkung der Klassengemeinschaft beitragen?
Durch den Austausch über eigene Herkunftsgeschichten lernen Schüler Verständnis für die Perspektiven anderer zu entwickeln und Vorurteile abzubauen.
Welche didaktischen Modelle eignen sich für die Unterrichtsplanung?
Die Arbeit bezieht sich auf Modelle nach Klafki (kategoriale Bildung), Rüsen (Geschichtsbewusstsein) sowie Kösel, Reich und Voß.
Wie geht man mit Inklusion und Diversität in solchen Klassen um?
Durch subjektorientierten Unterricht und differenzierte Gruppenarbeit können Schüler mit unterschiedlichen Voraussetzungen (z.B. LRS oder ADHS) individuell eingebunden werden.
- Arbeit zitieren
- Alina Willkomm (Autor:in), 2017, Welche Kompetenzen fördert ein autobiografischer Zugang beim Thema Migration?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/370911