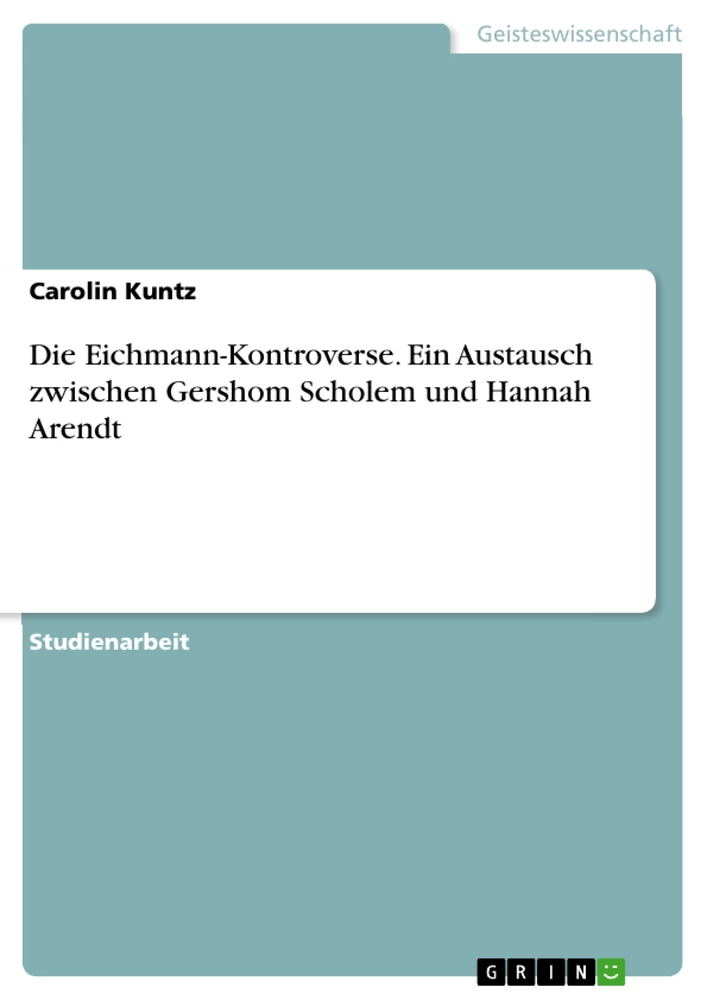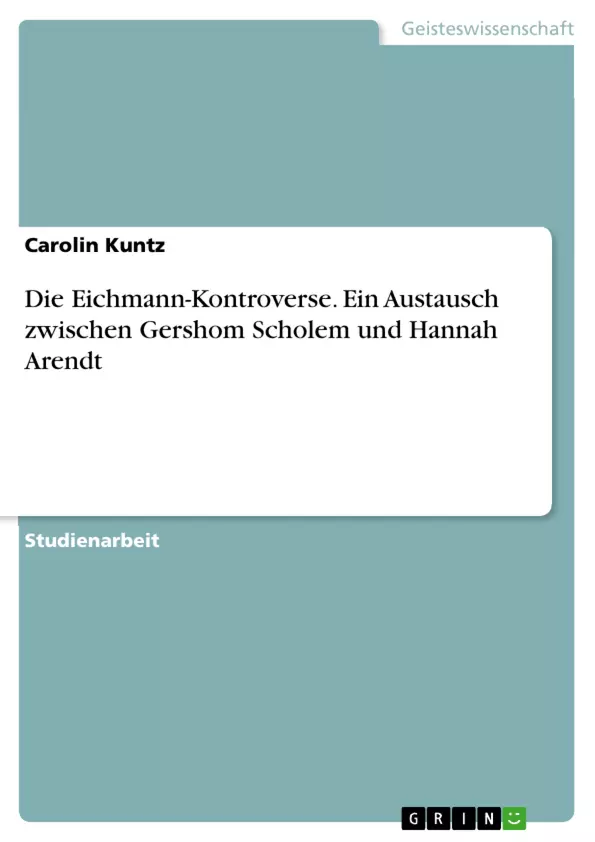Der Austausch zwischen dem Religionshistoriker Gershom Scholem und der politischen Denkerin Hannah Arendt ist in ihrem Briefwechsel aus dem Jahr 1963 dokumentiert. Über vier Briefe tauschen sich die Adressaten offen und freundlich miteinander aus, wobei man nur schwer von einem wahren Dialog sprechen kann. Im Zentrum steht dabei Arendts kurz zuvor erschienenes Buch "Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil" und der Eichmann-Prozess selbst.
Die voliegende Hausarbeit fasst zunächst die einzelnen Kritikpunkte und Repliken zusammen. Dabei wird die Thematik des Zeitpunkts des Arendt’schen Urteils bzw. Berichts näher untersucht. Als Ausgangspunkt hierfür dient Scholems These, diese Generation dürfe noch nicht über die Handlungen im Holocaust urteilen. Ziel ist es herauszuarbeiten, warum Arendt die Handlung des Urteilens ins Zentrum stellt. Ihr eigenes Urteil bringt sie — entgegen eigener Behauptung es handle sich lediglich um einen Prozessbericht — in Eichmann in Jerusalem klar zum Ausdruck.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1 Die Kritikpunkte
- 1.1 Kritik an der Person Arendts
- 1.2 Kritik an der Haltung Arendts
- 1.3 Kritik am Inhalt und am Zeitpunkt des Arendt'schen Urteils
- 2 Das Urteilen: Arendts Verständnis politischer Freiheit
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert den Briefwechsel zwischen Gershom Scholem und Hannah Arendt aus dem Jahr 1963. Im Zentrum steht Arendts Buch „Eichmann in Jerusalem: Ein Bericht von der Banalität des Bösen" und der Eichmann-Prozess. Die Arbeit untersucht die Kritikpunkte Scholems an Arendts Darstellung und zeigt auf, wie Arendt das Urteil als Handlung in den Vordergrund stellt, um die politische Freiheit zu verdeutlichen.
- Kritikpunkte Scholems an Arendts Buch „Eichmann in Jerusalem“
- Arendts Verständnis von politischer Freiheit durch das Urteil
- Die Bedeutung des Zeitpunkts des Arendt'schen Urteils
- Die Rolle des öffentlichen Meinungsaustauschs im politischen Raum
- Arendts eigene politische Freiheit durch ihr Urteil in „Eichmann in Jerusalem“
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Der Briefwechsel zwischen Scholem und Arendt fokussiert auf Arendts Buch „Eichmann in Jerusalem" und den Eichmann-Prozess. Die Arbeit untersucht die Kritikpunkte Scholems und Arendts Verständnis von politischer Freiheit durch das Urteil.
1 Die Kritikpunkte
Scholem kritisiert Arendt für ihre Darstellung des Eichmann-Prozesses, insbesondere für die angebliche Herunterspielung von Eichmanns Verantwortung und die Zuschreibung der Verantwortung an die Juden selbst. Die Kritikpunkte lassen sich in drei Bereiche unterteilen: Kritik an der Person Arendts, Kritik an ihrer Haltung und Kritik am Inhalt und Zeitpunkt ihres Urteils.
2 Das Urteilen: Arendts Verständnis politischer Freiheit
Arendt sieht im Urteil eine Handlung, die politische Freiheit ermöglicht. Durch die öffentliche Äußerung ihres Urteils in „Eichmann in Jerusalem" ermöglicht sie einen Meinungsaustausch im öffentlichen Raum und setzt ihre eigene politische Freiheit in die Tat um.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Eichmann-Kontroverse, den Briefwechsel zwischen Scholem und Arendt, Arendts Buch „Eichmann in Jerusalem", das Urteil als Handlung, politische Freiheit, öffentlicher Meinungsaustausch, und die Bedeutung des Zeitpunkts des Urteils.
Häufig gestellte Fragen
Was war der Anlass der Kontroverse zwischen Scholem und Arendt?
Auslöser war Hannah Arendts Buch „Eichmann in Jerusalem“ und ihr Bericht über die „Banalität des Bösen“ während des Eichmann-Prozesses 1961.
Was kritisierte Gershom Scholem an Arendts Werk?
Scholem kritisierte Arendts mangelnde Liebe zum jüdischen Volk („Herzensbeziehung“), ihre Haltung gegenüber den Judenräten und den Zeitpunkt ihres Urteils.
Warum ist das „Urteilen“ für Arendt so zentral?
Für Arendt ist das Urteilen eine Manifestation politischer Freiheit und die Voraussetzung für einen lebendigen öffentlichen Meinungsaustausch.
Ging es Arendt nur um einen Prozessbericht?
Obwohl sie behauptete, nur zu berichten, zeigt die Arbeit, dass sie durch ihr Werk ein klares politisches und moralisches Urteil fällte.
Welche Rolle spielt die „Banalität des Bösen“?
Dieser Begriff beschreibt Arendts Beobachtung, dass Eichmann kein „Dämon“ war, sondern ein gedankenloser Bürokrat, was Scholem als Herunterspielung empfand.
- Citation du texte
- Carolin Kuntz (Auteur), 2017, Die Eichmann-Kontroverse. Ein Austausch zwischen Gershom Scholem und Hannah Arendt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/370918