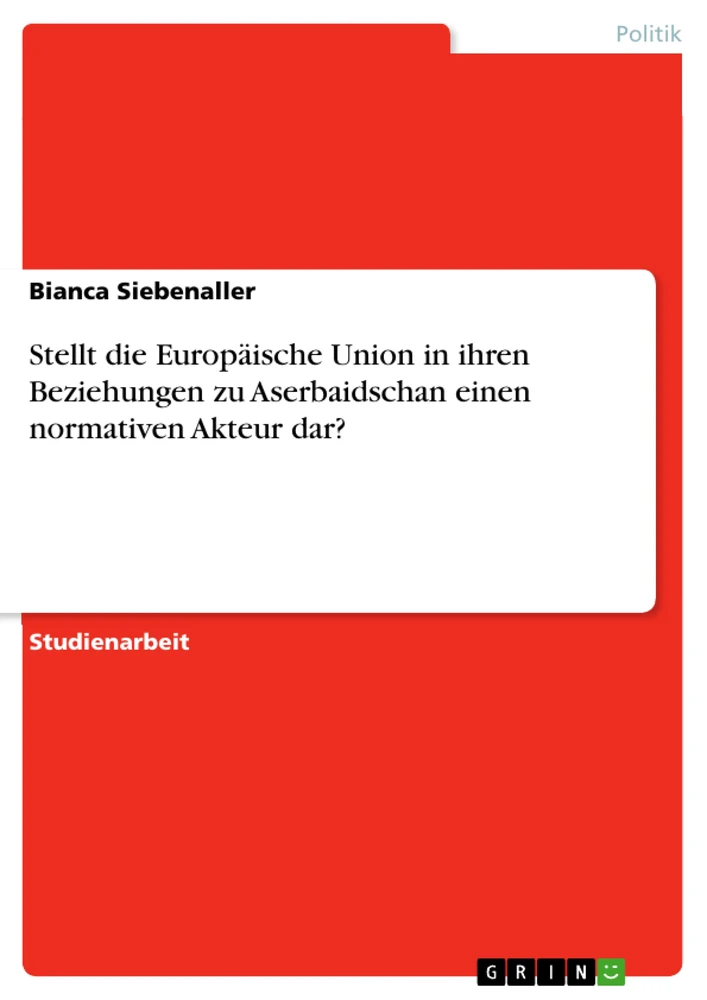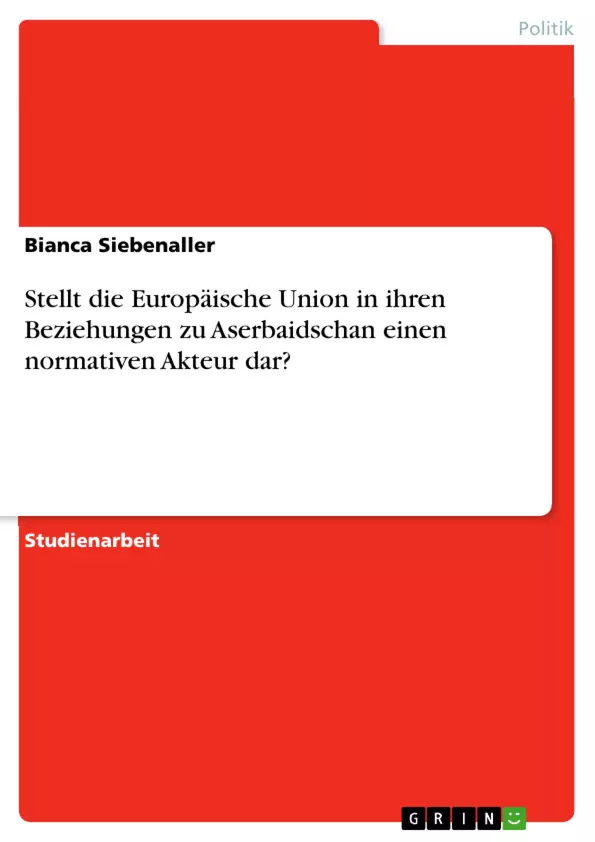In dieser Arbeit soll dargelegt werden, ob die EU im Rahmen der östlichen Partnerschaft in ihren Beziehungen zu Aserbaidschan die Qualität eines normativen Akteurs aufweist. Dabei geht es um die zentrale Frage, ob die EU ein genuin normatives Interesse in den Mittelpunkt der Beziehungen rückt, oder ob sich ein eigennütziges Motiv hinter den Handlungen verbirgt. Dazu wird im Folgenden zuerst eine kurze Einordnung des normativen Modells in die Theoriegeschichte vorgenommen, welches im Anschluss daran erläutert wird. Danach wird die methodische Herangehensweise der Untersuchung beschrieben. Die Grundlagen für diese Art der Operationalisierung stammen von Gerhard Junne und Arne Niemann, die eine Methode ausgearbeitet haben, wie man normative Macht messbar machen kann. Im Anschluss folgt der praktische Teil der Arbeit, der sich mit den drei von Junne und Niemann herausgearbeiteten Analyseebenen mit der Praxis der EU in Aserbaidschan auseinandersetzt. Abschließend wird ein abwägendes Fazit zu den Untersuchungen der Arbeit gegeben.
In den siebziger Jahren entwickelten Autoren wie Francois Dûchene das Konzept der Zivilmacht Europa. Nachdem Dûchenes Modell heftiger Kritik ausgesetzt war, überarbeiteten Maull und Twitchett die Theorie, in dem sie die drei Merkmale „Wichtigkeit ökonomischer Macht zur Erreichung nationaler Ziele“, „diplomatische Kooperation zur Lösung internationaler Konflikte“ und „der Wille zur Erschaffung einer supranationalen Institution“, als zentrale Komponenten des Konzepts herausarbeiteten. Als in den achtziger Jahren eine Rückkehr zu realpolitischen Ansätzen stattfand, geriet das Zivilmachtkonzept durch Hedley Bull in Kritik. Er warf dem Modell einen Mangel an Unabhängigkeit von anderen Staaten und Aussagelosigkeit vor, woraufhin er Dûchenes Idee das Konzept der Militärmacht als Lösung entgegenstellte
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Modell der normativen Macht
- Operationalisierung normativer Macht
- Untersuchung der EU Beziehungen zu Aserbaidschan
- Internalisierung der EU Normen in Aserbaidschan
- Interessen der EU in Aserbaidschan
- Reflexivität der EU
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, ob die Europäische Union (EU) in ihren Beziehungen zu Aserbaidschan als normativer Akteur agiert. Die zentrale Fragestellung beleuchtet, ob die EU ein genuin normatives Interesse verfolgt oder ob eigennützige Motive im Vordergrund stehen. Die Analyse basiert auf dem Konzept der normativen Macht und untersucht die Interaktion der EU mit Aserbaidschan im Kontext der Östlichen Partnerschaft.
- Das Konzept der normativen Macht im Kontext der EU-Außenpolitik
- Die Operationalisierung normativer Macht anhand der Beziehungen zwischen der EU und Aserbaidschan
- Die Analyse der Interessen der EU in Aserbaidschan
- Die Rolle der Reflexivität der EU in ihren Beziehungen zu Aserbaidschan
- Die Bewertung der Akteursqualität der EU als normativer Akteur
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt den Kontext der Europäischen Nachbarschaftspolitik (ENP) und ihre Erweiterung um die Östliche Partnerschaft. Sie stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Akteursqualität der EU in ihren Beziehungen zu Aserbaidschan und skizziert den methodischen Aufbau der Arbeit. Der Fokus liegt auf der Klärung, ob die EU in ihren Handlungen genuin normative Interessen verfolgt oder ob eigennützige Motive vorherrschen. Die Arbeit bezieht sich auf das Konzept der normativen Macht und die Methode von Junne und Niemann zur Messung normativer Macht.
Das Modell der normativen Macht: Dieses Kapitel diskutiert verschiedene Theorien des europäischen Handelns, beginnend mit dem Konzept der Zivilmacht und der darauf folgenden Kritik. Es beschreibt die Entwicklung des Konzepts der normativen Macht durch Ian Manners als Reaktion auf die Unzulänglichkeiten der Zivil- und Militärmachtkonzepte. Manners betont die Fähigkeit der EU, Normen zu setzen und deren Akzeptanz und Umsetzung durch andere Akteure zu erreichen. Der Kapitel vergleicht das normative Modell mit anderen Ansätzen und hebt die Besonderheiten der EU als Akteur hervor, die in ihrem historischen Kontext und ihrer institutionellen Struktur begründet liegen. Insbesondere wird die Abgrenzung von der These Therborns diskutiert, dass die EU ohne den Einsatz von Druckmitteln keine normative Macht ausüben könne.
Schlüsselwörter
Europäische Union, Aserbaidschan, Östliche Partnerschaft, normative Macht, Akteursqualität, EU-Außenpolitik, Normenverbreitung, Interessen, Reflexivität, Europäische Nachbarschaftspolitik (ENP).
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse der EU-Beziehungen zu Aserbaidschan
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Rolle der Europäischen Union (EU) als normativer Akteur in ihren Beziehungen zu Aserbaidschan. Der Fokus liegt darauf, zu klären, ob die EU in diesem Kontext genuin normative Interessen verfolgt oder ob eigennützige Motive im Vordergrund stehen. Die Analyse basiert auf dem Konzept der normativen Macht und bezieht die Östliche Partnerschaft mit ein.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet das Konzept der normativen Macht als analytisches Werkzeug. Es wird untersucht, wie die EU Normen in Aserbaidschan zu internalisieren versucht und welche Interessen die EU in Aserbaidschan verfolgt. Die Rolle der Reflexivität der EU wird ebenfalls analysiert. Die Arbeit bezieht sich auf das Konzept der normativen Macht und die Methode von Junne und Niemann zur Messung normativer Macht.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Das Konzept der normativen Macht im Kontext der EU-Außenpolitik; die Operationalisierung normativer Macht anhand der Beziehungen zwischen der EU und Aserbaidschan; die Analyse der Interessen der EU in Aserbaidschan; die Rolle der Reflexivität der EU in ihren Beziehungen zu Aserbaidschan; und die Bewertung der Akteursqualität der EU als normativer Akteur. Die Einleitung beschreibt den Kontext der Europäischen Nachbarschaftspolitik (ENP) und die Östliche Partnerschaft. Die verschiedenen Kapitel behandeln das Modell der normativen Macht, die Internalisierung von EU-Normen in Aserbaidschan, die Interessen der EU und die Reflexivität der EU.
Welche Schlüsselkonzepte werden verwendet?
Schlüsselkonzepte sind: Europäische Union, Aserbaidschan, Östliche Partnerschaft, normative Macht, Akteursqualität, EU-Außenpolitik, Normenverbreitung, Interessen, Reflexivität, Europäische Nachbarschaftspolitik (ENP).
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Agiert die Europäische Union (EU) in ihren Beziehungen zu Aserbaidschan als normativer Akteur? Verfolgt die EU ein genuin normatives Interesse oder stehen eigennützige Motive im Vordergrund?
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in die Kapitel: Einleitung, Das Modell der normativen Macht, Operationalisierung normativer Macht, Untersuchung der EU Beziehungen zu Aserbaidschan (inkl. Unterkapitel zu Internalisierung der EU Normen, Interessen der EU und Reflexivität der EU), und Fazit.
Wie wird das Modell der normativen Macht behandelt?
Das Kapitel "Das Modell der normativen Macht" diskutiert verschiedene Theorien europäischen Handelns, insbesondere das Konzept der normativen Macht nach Ian Manners und dessen Abgrenzung von anderen Ansätzen wie der Zivilmacht. Es wird die Fähigkeit der EU, Normen zu setzen und deren Umsetzung durch andere Akteure zu erreichen, beleuchtet. Die Arbeit diskutiert auch die These Therborns, dass die EU ohne Druckmittel keine normative Macht ausüben könne.
- Quote paper
- Bianca Siebenaller (Author), 2016, Stellt die Europäische Union in ihren Beziehungen zu Aserbaidschan einen normativen Akteur dar?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/370957