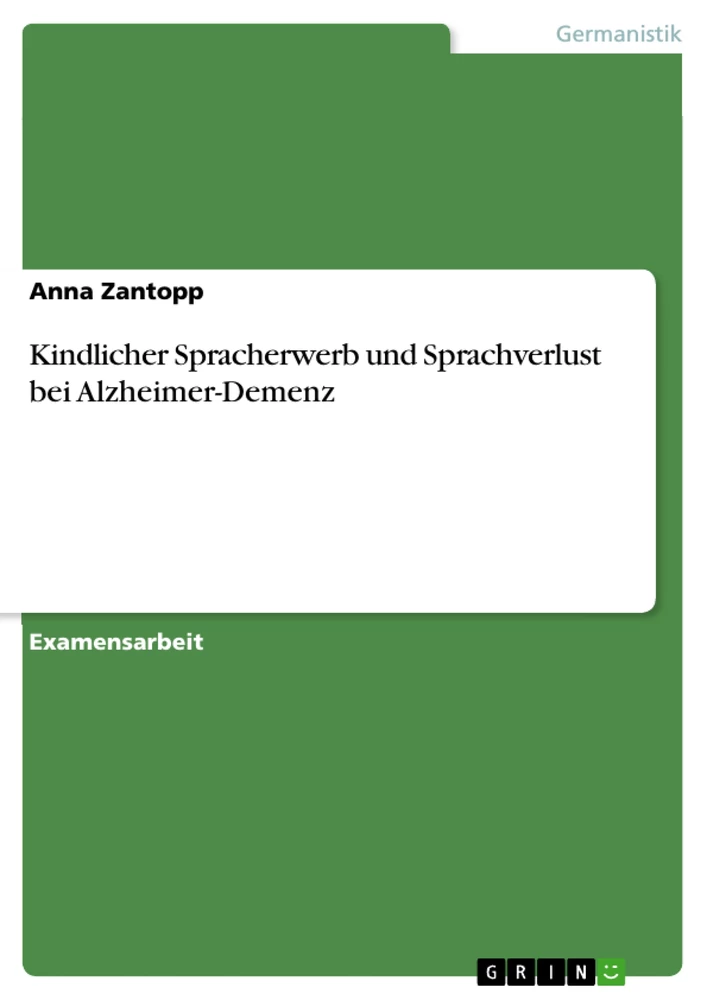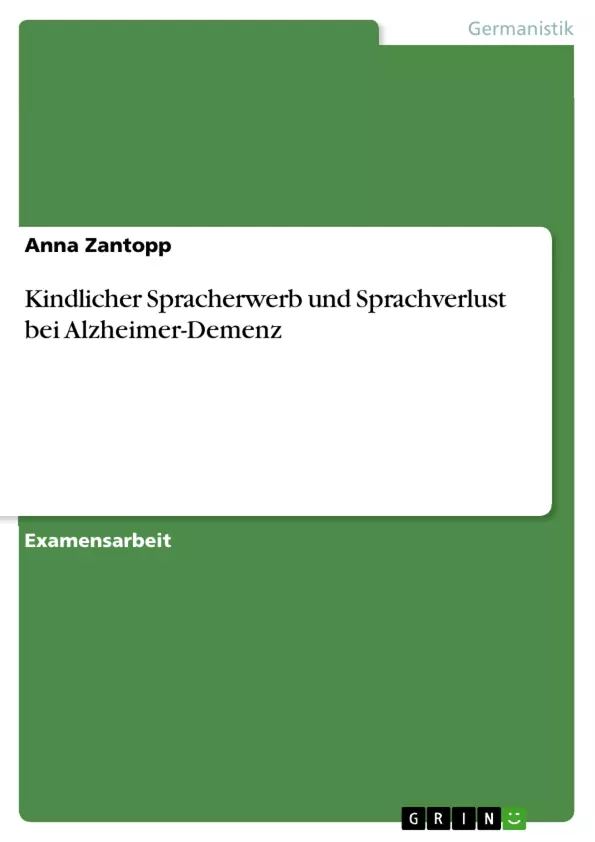Die Sprache des Menschen und dessen kognitive Fähigkeiten stehen in einem engen Zusammenhang. Der Erwerb der menschlichen Sprache ist ein komplexer Prozess, durch welchen der Mensch über viele Jahre an Fähigkeiten und Kompetenzen gewinnt. Die Sprache ist für jeden Menschen eine wichtige Eigenschaft, die es ihm ermöglicht, mit anderen Menschen in der Umgebung in Kontakt zu treten, soziale Beziehungen zu pflegen und seine Innenwelt, also seine Gedanken und seine Gefühle, nach außen mitzuteilen. Allerdings durchläuft er dabei zunächst unterschiedliche Phasen, die schlussendlich dazu führen, dass der Mensch dialogfähig wird und seine Sprache bestimmten Typen bzw. Formen von Konversationen anpassen kann.
Sprache kann demnach als eine Fähigkeit, die es dem Menschen ermöglicht, sich selbst und seine Innenwelt darstellen zu können, definiert werden. Die einzelnen Spracherwerbsphasen sind von komplexen kognitiven Vorgängen geprägt. Einen sehr weitreichenden und guten Überblick über diese Thematik schafft vor allem das Werk „Kindlicher Spracherwerb im Deutschen“ von Fritz et. al. aus dem Jahr 2012, das nicht nur den Verlauf des Spracherwerbs thematisiert, sondern auch Forschungsmethoden und Erklärungsansätze für selbigen aufzeigt. Außerdem wird auch ein Fokus auf die pragmatischen Fähigkeiten gelegt, der im Anschluss noch wichtig für die Thematik des Sprachverlusts werden wird.
Es erscheint schwer vorstellbar, dass eine Fähigkeit, die so komplex veranlagt ist, verloren gehen kann. Allerdings werden die Menschen heutzutage immer älter. Mit dem Alter verliert der Mensch einige seiner kognitiven Fähigkeiten, insgesamt laufen kognitive Prozesse bei älteren Menschen langsamer ab als bei jüngeren. Und je älter der Mensch ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, an Alzheimer-Demenz zu erkranken. Es leben in Deutschland etwa 1,2 Millionen Menschen, die an Alzheimer-Demenz leiden und somit die Sprachfähigkeit verlieren – Tendenz steigend. Doch wie genau wird die Sprache eigentlich verloren? Wie kann etwas, das so langes Training beinhaltet, einfach so verlernt werden?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sprache
- Spracherwerbstheorien
- Behaviorismus
- Kognitivismus
- Nativismus
- Die Grundzüge des kindlichen Spracherwerbs
- Primärspracherwerb vs. Fremdsprachenerwerb
- Biologische Voraussetzungen für den Spracherwerb
- Frühe Sprachwahrnehmung
- Wahrnehmung konsonantischer Phonemkontraste
- Semantische Fähigkeiten
- Wortverständnis
- Dingwörter
- Erwerb von Wortarten
- Die Verben als besondere Wortart
- Morphologische Fähigkeiten
- Wortbildung
- Pluralerwerb
- Das Kasussystem
- Tempus und Verbflexion
- Syntaktische Fähigkeiten
- Einwortäußerungen
- Zweiwortäußerungen
- Drei- und Mehrwortäußerungen
- Weitere syntaktische Fähigkeiten
- Erwerb pragmatischer Fähigkeiten
- Grundzüge des Sprachverlusts
- Altersbedingte Veränderungen der sprachlichen Fähigkeiten
- Demenz im Allgemeinen
- Alzheimer-Demenz
- Biologische Fakten
- Alzheimer-Demenz
- Schutz vor Alzheimer-Demenz
- Die Sprache bei Alzheimer-Demenz
- Wortfindungsstörungen
- Pragmatische Störungen
- Konversationsmaximen Grice
- Sprachliches Handeln: Illokutionen
- Die Kommunikation bei Alzheimer-Demenz
- Exkurs: Schriftsprache bei Alzheimer-Demenz
- Fazit
- Der kindliche Spracherwerb als komplexer Prozess
- Die verschiedenen Theorien des Spracherwerbs
- Der Einfluss von biologischen und kognitiven Faktoren auf den Spracherwerb
- Die Auswirkungen der Alzheimer-Demenz auf die Sprache
- Die Kommunikation mit Menschen, die an Alzheimer-Demenz erkrankt sind
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beleuchtet die komplexen Zusammenhänge zwischen dem Spracherwerb und dem Sprachverlust im Kontext von Alzheimer-Demenz. Im Fokus stehen die biologischen und kognitiven Grundlagen des Spracherwerbs, die Entwicklung von Sprachkompetenzen im Kindesalter und die Auswirkungen der Alzheimer-Demenz auf die sprachlichen Fähigkeiten im späteren Leben.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung skizziert den engen Zusammenhang zwischen Sprache und kognitiven Fähigkeiten und legt den Fokus auf die Bedeutung des Spracherwerbs für die Entwicklung des Menschen. Kapitel 2 widmet sich verschiedenen Spracherwerbstheorien, wie dem Behaviorismus, Kognitivismus und Nativismus. Kapitel 3 befasst sich mit den Grundzügen des kindlichen Spracherwerbs, indem es Themen wie biologische Voraussetzungen, frühe Sprachwahrnehmung, semantische Fähigkeiten, Wortarten, morphologische Fähigkeiten und syntaktische Fähigkeiten beleuchtet. Kapitel 4 erörtert die komplexen Zusammenhänge zwischen Sprachverlust und Alzheimer-Demenz, einschließlich altersbedingter Veränderungen, biologischer Aspekte der Alzheimer-Demenz und deren Auswirkungen auf die Sprachfunktionen.
Schlüsselwörter
Spracherwerb, Alzheimer-Demenz, Sprachverlust, Kognition, Behaviorismus, Kognitivismus, Nativismus, Pragmatik, Kommunikation, Wortfindungsstörungen, biologische Voraussetzungen, semantische Fähigkeiten, Morphologie, Syntax.
Häufig gestellte Fragen
Wie verläuft der kindliche Spracherwerb?
Der Spracherwerb ist ein komplexer Prozess, der über verschiedene Phasen von Einwortäußerungen bis zur vollständigen Grammatik und Pragmatik führt.
Welche Spracherwerbstheorien gibt es?
Die Arbeit behandelt zentrale Ansätze wie den Behaviorismus, Kognitivismus und Nativismus.
Wie wirkt sich Alzheimer auf die Sprache aus?
Patienten leiden häufig unter Wortfindungsstörungen, dem Verlust pragmatischer Fähigkeiten und Schwierigkeiten bei der Einhaltung von Konversationsmaximen.
Was sind Wortfindungsstörungen bei Demenz?
Es ist die Unfähigkeit, Begriffe abzurufen, die früher sicher beherrscht wurden, was oft zu Umschreibungen oder dem Abbruch von Sätzen führt.
Kann man sich vor Alzheimer-Demenz schützen?
Die Arbeit geht kurz auf biologische Fakten und mögliche Schutzfaktoren ein, die den kognitiven Verfall verzögern könnten.
- Quote paper
- Anna Zantopp (Author), 2016, Kindlicher Spracherwerb und Sprachverlust bei Alzheimer-Demenz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/371034