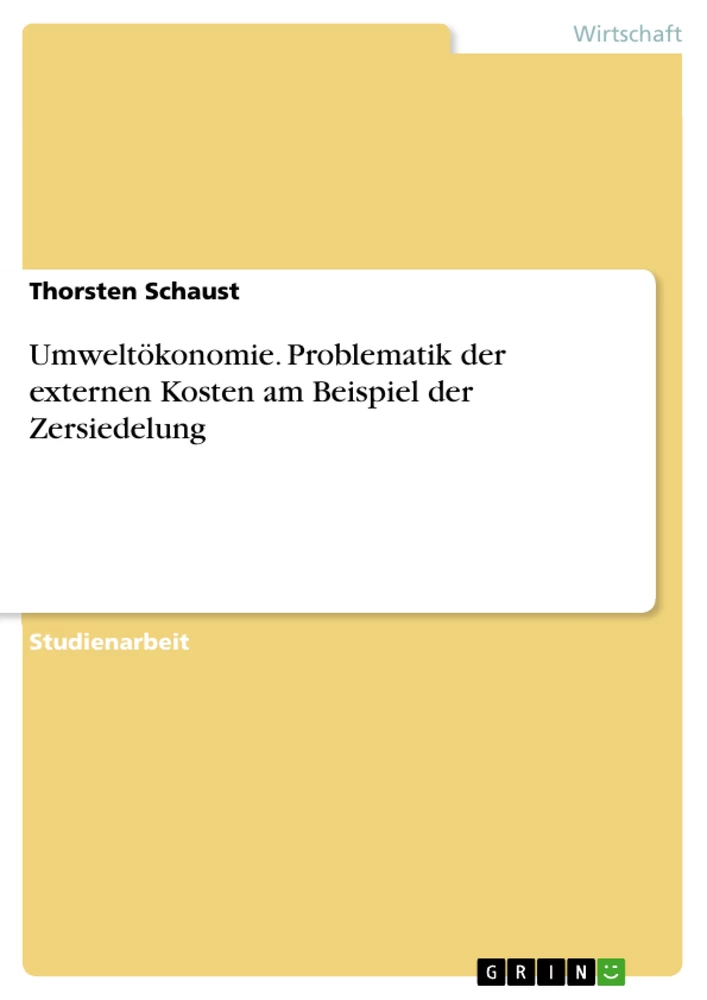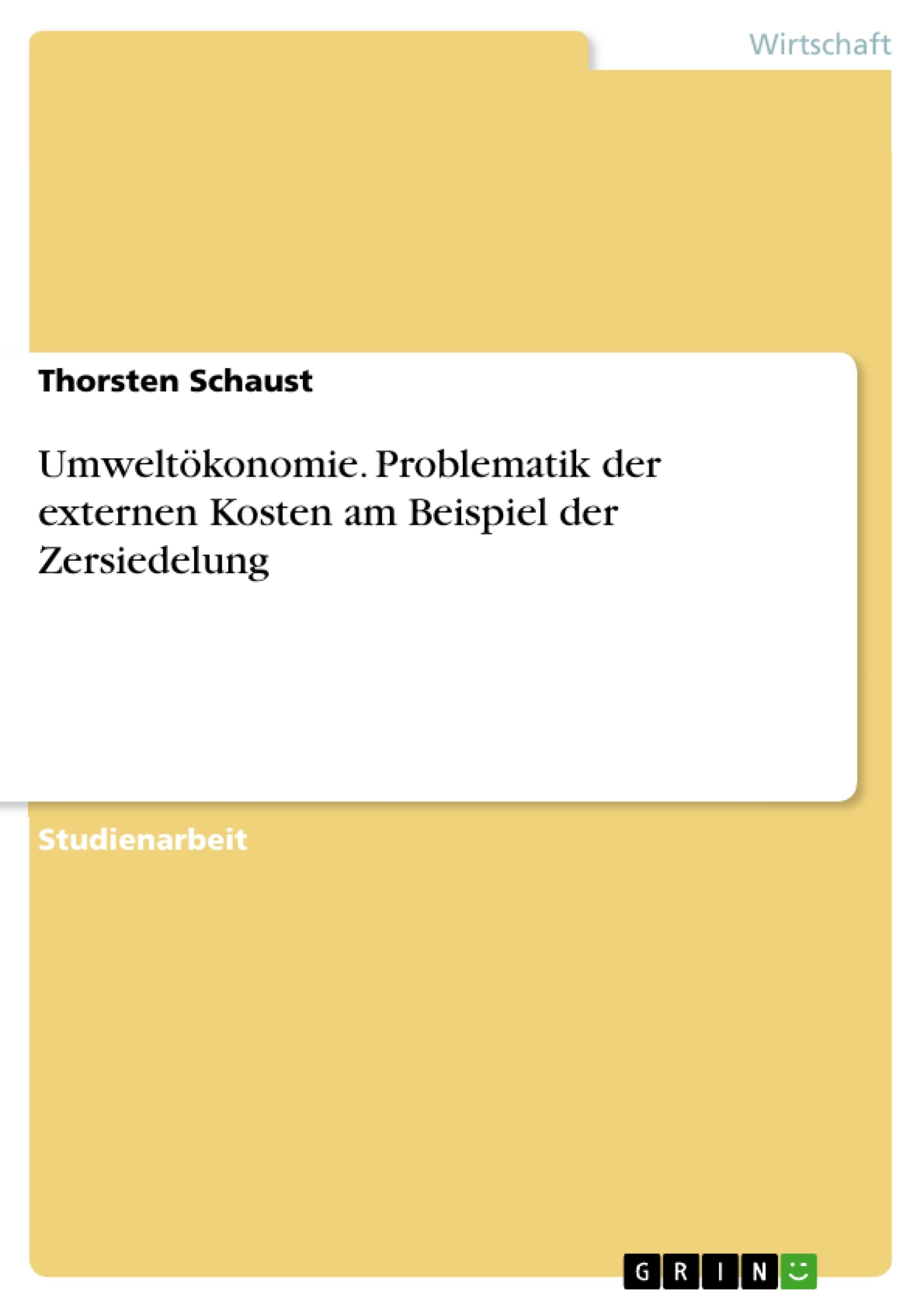In dieser Arbeit möchte ich die externen Kosten in der Umweltökonomie anhand eines Beispiels erklären. Dazu wird in Kapitel Zwei zunächst der Begriff der externen Kosten erklärt und weiter auf die verschiedenen Formen, Folgen und Entwicklungen eingegangen. Als Beispiel dient hier die Zersiedlung als aktuelles Thema in der Umweltökonomie. In Kapital Drei wird der Begriff Zersiedlung kurz erklärt, bevor näher auf die umweltökonomische Problemstellung mit Ursachen und Verursachern, sowie Folgen der Zersiedlung und daraus resultierenden externen Kosten eingegangen wird. Weiterführend wird in Kapitel Drei auch der Begriff der Internalisierung erklärt und dessen aktuelle Instrumente, als auch mögliche Ansätze erläutert. Folgend wird eine Pro- und Contra-Diskussion zu den externen Kosten am Beispiel der Zersiedlung in Kapitel Vier geführt, welche versucht alle Vor- und Nachteile dieser umweltökonomischen Diskussion aufzugreifen, zu ordnen und zu erläutern. Anschließend wird die Diskussion in Form eines Fazits in Kapitel Fünf zusammengefasst und persönlich fundiert bewertet. Dabei wird auch näher auf die angestrebten und dargestellten Lösungsmöglichkeiten in Form eines Ausblicks eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Externe Kosten
- Definition: Externe Kosten
- Formen der externen Kosten
- Folgen der externen Kosten
- Externe Kosten der Umweltökonomie anhand des Beispiels der Zersiedelung
- Begriffserklärung: Zersiedelung
- Problembeschreibung: Zersiedelung
- Ursachen und Verursacher der Zersiedelung
- Pro- und Contra-Diskussion der externen Kosten durch Zersiedlung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit zielt darauf ab, das Konzept externer Kosten in der Umweltökonomie zu erläutern und anhand des Beispiels der Zersiedlung zu veranschaulichen. Es werden die Definition, Formen und Folgen externer Kosten beleuchtet, bevor die Zersiedlung als aktuelles Problem der Umweltökonomie detailliert untersucht wird.
- Definition und Erklärung externer Kosten in der Umweltökonomie
- Analyse der Zersiedlung als Beispiel für negative externe Effekte
- Ursachen und Folgen der Zersiedlung
- Diskussion der Herausforderungen bei der Internalisierung externer Kosten
- Bewertung möglicher Lösungsansätze
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der externen Kosten in der Umweltökonomie ein und benennt die Zersiedlung als Fallbeispiel. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und gibt einen Überblick über die behandelten Kapitel.
Externe Kosten: Dieses Kapitel definiert den Begriff der externen Kosten im Kontext der Mikro- und Umweltökonomie. Es werden verschiedene Formen und Folgen externer Kosten erläutert, wobei der Fokus auf negativen externen Effekten liegt. Das Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die spätere Fallstudie zur Zersiedlung.
Externe Kosten der Umweltökonomie anhand des Beispiels der Zersiedelung: Dieses Kapitel erklärt den Begriff der Zersiedlung und analysiert sie als ein Problem der Umweltökonomie. Es werden die Ursachen und Verursacher der Zersiedlung untersucht, sowie die daraus resultierenden externen Kosten detailliert beschrieben. Das Kapitel verknüpft die theoretischen Grundlagen mit einem konkreten Anwendungsbeispiel.
Schlüsselwörter
Externe Kosten, Umweltökonomie, Zersiedlung, Suburbanisierung, Internalisierung, Marktversagen, Umweltbelastung, ökologische Folgekosten, soziale Kosten, Stadtentwicklung, Regionalplanung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Externe Kosten der Umweltökonomie anhand des Beispiels der Zersiedelung
Was ist der Hauptfokus dieser Arbeit?
Die Arbeit erläutert das Konzept der externen Kosten in der Umweltökonomie und veranschaulicht dies anhand des Beispiels der Zersiedelung. Sie untersucht Definition, Formen und Folgen externer Kosten und analysiert detailliert die Zersiedelung als aktuelles Problem der Umweltökonomie.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Erklärung externer Kosten, Analyse der Zersiedlung als Beispiel für negative externe Effekte, Ursachen und Folgen der Zersiedlung, Herausforderungen bei der Internalisierung externer Kosten und Bewertung möglicher Lösungsansätze. Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, Kapitel zu externen Kosten im Allgemeinen, ein Kapitel zur Zersiedelung als Fallbeispiel, sowie ein Fazit.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in mehrere Kapitel gegliedert: Einleitung, ein Kapitel zu externen Kosten (Definition, Formen, Folgen), ein Kapitel zur Zersiedelung (Begriffserklärung, Problembeschreibung, Ursachen und Verursacher), ein Kapitel mit einer Pro- und Contra-Diskussion der externen Kosten durch Zersiedlung und ein Fazit. Ein Inhaltsverzeichnis bietet einen detaillierten Überblick.
Was wird unter externen Kosten verstanden?
Externe Kosten beschreiben Kosten, die durch wirtschaftliche Aktivitäten entstehen, aber nicht von den Verursachern getragen werden, sondern von Dritten (z.B. Umweltbelastung durch die Zersiedelung). Die Arbeit definiert den Begriff im Kontext der Mikro- und Umweltökonomie und beleuchtet verschiedene Formen und Folgen solcher Kosten.
Welche Rolle spielt die Zersiedelung in dieser Arbeit?
Die Zersiedelung dient als Fallbeispiel, um die theoretischen Konzepte der externen Kosten zu veranschaulichen. Die Arbeit analysiert die Zersiedelung als Problem der Umweltökonomie, untersucht die Ursachen und Verursacher und beschreibt detailliert die resultierenden externen Kosten.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Externe Kosten, Umweltökonomie, Zersiedelung, Suburbanisierung, Internalisierung, Marktversagen, Umweltbelastung, ökologische Folgekosten, soziale Kosten, Stadtentwicklung und Regionalplanung.
Welche Kapitelzusammenfassungen werden angeboten?
Die Arbeit bietet Zusammenfassungen für die Kapitel Einleitung, Externe Kosten und Externe Kosten der Umweltökonomie anhand des Beispiels der Zersiedelung. Die Einleitung führt in die Thematik ein, das Kapitel zu den externen Kosten legt die theoretischen Grundlagen dar, und das Kapitel zur Zersiedelung verknüpft Theorie und Praxis.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, das Konzept externer Kosten zu erläutern und anhand des Beispiels der Zersiedelung zu veranschaulichen. Sie soll die Definition, Formen und Folgen externer Kosten beleuchten und die Zersiedelung als aktuelles Problem der Umweltökonomie detailliert untersuchen.
- Quote paper
- Thorsten Schaust (Author), 2017, Umweltökonomie. Problematik der externen Kosten am Beispiel der Zersiedelung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/371056