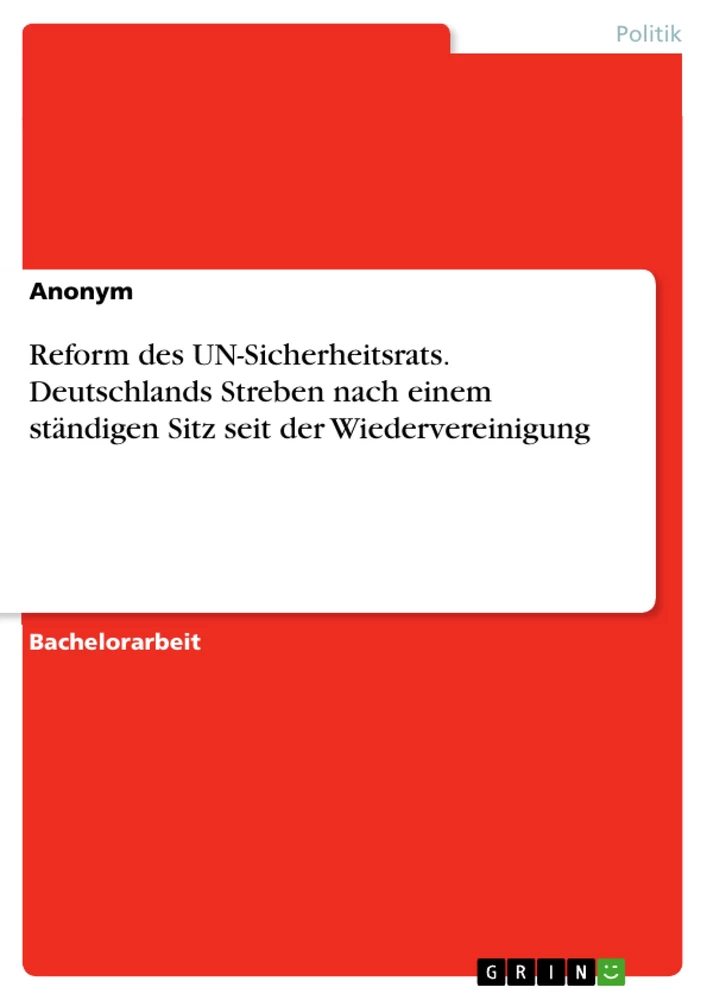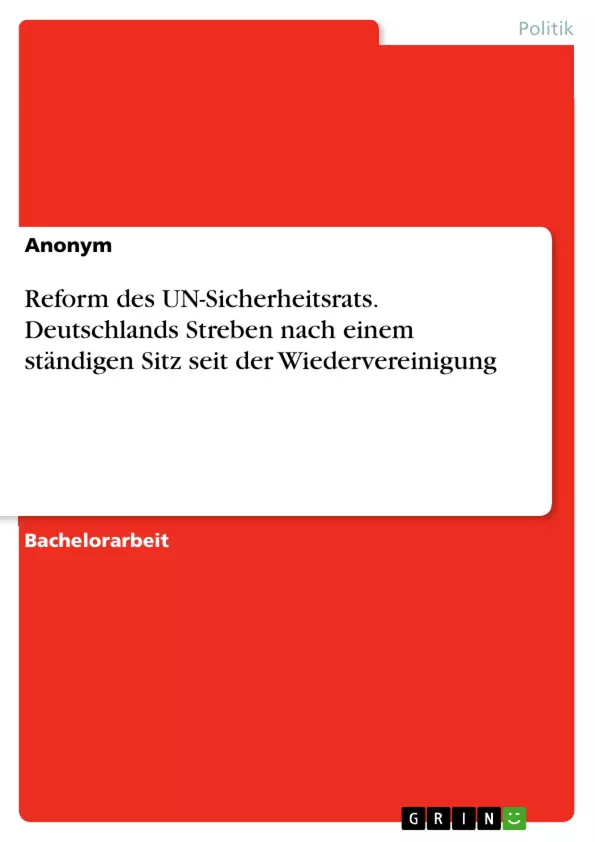In der folgenden Arbeit soll der Frage nachgegangen werden, wie sich das deutsche Streben nach einem ständigen Sitz im Sicherheitsrat auf die Reformdebatte des Gremiums ausgewirkt hat. Es wird zudem überlegt, ob es einen Wandel in der deutschen Außenpolitik nach der Wiedervereinigung gab und wie das Streben nach einem ständigen Sitz erklärt werden kann.
Im ersten Teil der Arbeit wird somit die Entwicklung deutscher Außenpolitik dargestellt um dann verschiedene Modelle der internationalen Beziehungen anzulegen. Dies soll einerseits die Außenpolitik Deutschlands beschreiben und andererseits das Streben nach einem ständigen Sitz in einen Theoretischen Rahmen einfügen. In einer Pro und Contra Darstellung werden verschiedene Positionen zum Thema ständiger Sitz aufgeführt.
Nachdem ein außenpolitisches Bild Deutschlands gezeichnet wurde, wird in Kapitel 3 auf den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen eingegangen. Nach dem einordnen in den historischen Kontext wird die Struktur und die Aufgaben des mächtigsten Hauptorgans erläutert.
Danach ist es möglich genau auf die lange Geschichte der Reformdebatte in den Vereinten Nationen, in Bezug auf den Sicherheitsrat einzugehen. Hier wurde sich auf die Reformdebatte zwischen 2003 und 2005 konzentriert. Diese wird als Moment mit besonderem Spielraum und Chance auf eine Reform gesehen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theorien und Entwicklung deutscher Außenpolitik
- 2.1 Deutsche Außenpolitik des vereinten Deutschland
- 2.1.1 Engagement des geteilten Deutschland zwischen 1973 und 1990
- 2.1.2 Engagement des vereinten Deutschland ab 1990
- 2.1.3 Abschließende Betrachtung des Engagements in den Vereinten Nationen
- 2.2 Neue deutsche Außenpolitik des vereinten Deutschland? - Erklärung aus der konstruktivistischen Theorie
- 2.2.1 Zentrale Annahmen und Erklärungsmuster der konstruktivistischen Theorie
- 2.2.2 Zivilgesellschaft, Multilateralismus und europäische Integration - Identifikationsdimensionen Deutschlands
- 2.3 Die Debatte um einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat - Pro und Contra
- 2.3.1 Erklärung der Bundesregierung - Argumente für einen ständigen Sitz Deutschlands im Sicherheitsrat
- 2.3.2 Kritische Gegenstimmen zu einem ständigen Sitz im Sicherheitsrat
- 2.4 Das Streben nach einem ständigen Sitz - Erklärungsansatz aus der Theorie des Realismus nach Morgenthau
- 2.4.1 Zentrale Annahmen und Erklärungsmuster des Realismus nach Morgenthau
- 2.4.2 Theorie des Realismus und das deutsche Streben nach einem ständigen Sitz im Sicherheitsrat
- 3 Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
- 3.1 Einordnung in den geschichtlichen Hintergrund
- 3.3.1 Zeit des Ost-West Konflikts
- 3.3.2 Ende des Ost-West Konflikts
- 3.4 Aufgaben und Organisation des Sicherheitsrats
- 4 Reformen des Sicherheitsrats
- 4.1 Reformen und Reformvorschläge zwischen 1945 und 2003
- 4.1.1 Reformen während des Ost-West Konflikts
- 4.1.2 Reformvorschläge nach dem Ende des Ost-West Konflikts
- 4.1.3 Situation nach der Jahrtausendwende
- 4.2 Die Reformdebatte zwischen 2003 und 2005
- 4.2.1 Die Gruppe „Vereint für den Konsens“
- 4.2.2 Die Afrikanische Union
- 4.2.3 Die „Gruppe der Vier“
- 4.2.4 Ende und Bewertung der Reformdebatte
- 5 Fazit
- Entwicklung der deutschen Außenpolitik nach der Wiedervereinigung
- Theoretische Modelle der internationalen Beziehungen im Kontext des Strebens nach einem ständigen Sitz
- Analyse der Pro- und Contra-Argumente für einen ständigen Sitz Deutschlands
- Reformdebatte des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen
- Einfluss des deutschen Strebens nach einem ständigen Sitz auf die Reformdebatte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Auswirkungen des deutschen Strebens nach einem ständigen Sitz im Sicherheitsrat auf die Reformdebatte des Gremiums. Sie analysiert, ob es einen Wandel in der deutschen Außenpolitik nach der Wiedervereinigung gab und wie sich das Streben nach einem ständigen Sitz erklären lässt.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Fokus der Untersuchung auf die Auswirkungen des deutschen Strebens nach einem ständigen Sitz im Sicherheitsrat auf die Reformdebatte des Gremiums legt. Anschließend analysiert Kapitel 2 die Entwicklung der deutschen Außenpolitik im Kontext der Wiedervereinigung, wobei verschiedene theoretische Modelle der internationalen Beziehungen herangezogen werden, um das Streben nach einem ständigen Sitz zu erklären. In Kapitel 3 wird der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen vorgestellt, seine historische Entwicklung und seine Struktur erläutert. Kapitel 4 beleuchtet die Geschichte der Reformdebatte des Sicherheitsrats, mit besonderem Augenmerk auf die Reformdebatte zwischen 2003 und 2005.
Schlüsselwörter
Deutsche Außenpolitik, Sicherheitsrat, Vereinte Nationen, Reformdebatte, ständiger Sitz, Realismus, Konstruktivismus, Multilateralismus, europäische Integration, Ost-West Konflikt.
Häufig gestellte Fragen
Warum strebt Deutschland einen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat an?
Deutschland möchte seiner gewachsenen internationalen Verantwortung und seinem finanziellen Engagement in den Vereinten Nationen durch mehr politisches Mitspracherecht gerecht werden.
Was war die „Gruppe der Vier“ (G4)?
Die G4 besteht aus Deutschland, Japan, Brasilien und Indien. Diese Staaten unterstützen sich gegenseitig in ihrem Bestreben nach einem ständigen Sitz im Sicherheitsrat.
Welche Argumente sprechen gegen einen deutschen Sitz?
Kritiker befürchten eine Überrepräsentation Europas und fordern stattdessen Sitze für Regionen des Globalen Südens oder einen gemeinsamen Sitz für die gesamte EU.
Wie wird das deutsche Streben aus Sicht des Realismus erklärt?
Der Realismus (nach Morgenthau) sieht darin ein klassisches Streben nach Macht und nationalem Prestige in einer anarchischen Weltordnung.
Was ist die Gruppe „Vereint für den Konsens“?
Dies ist eine informelle Gruppe von Staaten (auch „Coffee Club“ genannt), die sich gegen die Erweiterung der ständigen Sitze ausspricht und stattdessen mehr nicht-ständige Sitze fordert.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2017, Reform des UN-Sicherheitsrats. Deutschlands Streben nach einem ständigen Sitz seit der Wiedervereinigung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/371082