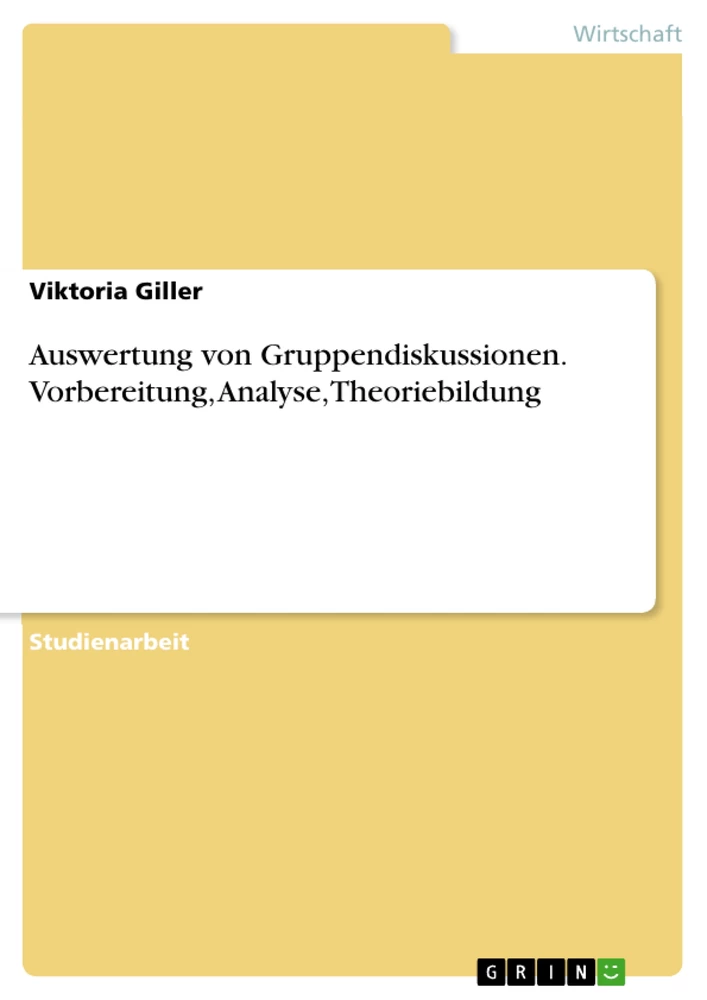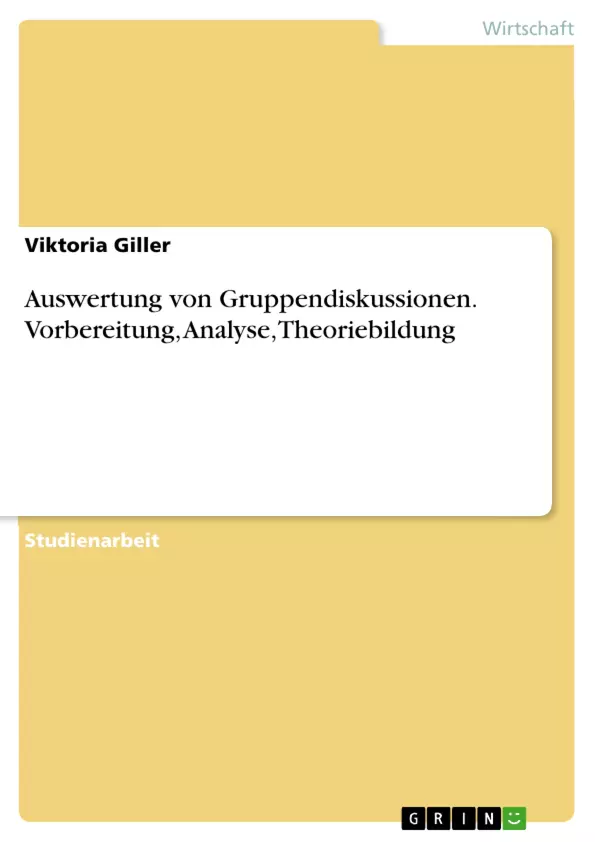In der heutigen Zeit werden die unterschiedlichsten Methoden in der Marktforschung angewandt, um Antworten für relevante Fragestellungen zu finden. Eine Methode findet sich in der Gruppendiskussion. Dieser kommt schon vor einigen Jahren an Bedeutung zu. Auch heute nimmt diese Untersuchungsmethode einen besonderen Stellenwert ein. Umso wichtiger ist es sich auch mit den möglichen Auswertungsmethoden der Gruppendiskussion auseinanderzusetzen.
Zu Beginn dieser Arbeit soll ein kurzer Überblick über die Methode der Gruppendiskussion gegeben werden. Die nachfolgenden Kapitel beschäftigen sich anschließend mit einer Auswahl unterschiedlicher Verfahren der Auswertung. Um zu verdeutlichen wie sich die einzelnen Methoden unterscheiden, soll im Anschluss der vorliegenden Arbeit näher auf die jeweiligen Anwendungsbereiche eingegangen werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Die Gruppendiskussion
- 3 Auswertung von Gruppendiskussionen
- 3.1 Vorbereitende Maßnahmen
- 3.2 Qualitative Inhaltsanalyse
- 3.3 Typologische Analyse
- 3.4 Gegenstandsbezogene Theorienbildung
- 3.5 Objektive Hermeneutik
- 4 Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit setzt sich zum Ziel, verschiedene Auswertungsmethoden für Gruppendiskussionen vorzustellen und zu beleuchten. Dabei wird ein Überblick über die Methode der Gruppendiskussion selbst gegeben und anschließend auf ausgewählte Auswertungsverfahren näher eingegangen. Die Arbeit strebt an, die unterschiedlichen Anwendungsbereiche der jeweiligen Methoden zu verdeutlichen.
- Die Gruppendiskussion als Forschungsmethode
- Verschiedene Auswertungsverfahren für Gruppendiskussionen
- Vorbereitende Maßnahmen für die Datenanalyse
- Qualitative Inhaltsanalyse als prominentes Auswertungsverfahren
- Anwendungsbereiche der verschiedenen Auswertungsmethoden
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Diese Einleitung führt in die Thematik der Gruppendiskussion als Forschungsmethode ein und erläutert die Relevanz der Auswertungsmethode.
- Kapitel 2: Die Gruppendiskussion: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Gruppendiskussion" und beschreibt die Methode in Bezug auf ihre Durchführung und Einsatzgebiete.
- Kapitel 3: Auswertung von Gruppendiskussionen: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Auswertungsverfahren für Gruppendiskussionen. Es werden die wichtigsten Methoden vorgestellt und ihre Besonderheiten erläutert.
- Kapitel 3.1: Vorbereitende Maßnahmen: Dieser Abschnitt geht auf die Bedeutung von vorbereitenden Maßnahmen für die Datenanalyse ein und stellt wichtige Fragen, die im Vorfeld der Auswertung zu klären sind.
- Kapitel 3.2: Qualitative Inhaltsanalyse: Dieses Kapitel beschreibt die qualitative Inhaltsanalyse als ein bedeutendes Auswertungsverfahren und erläutert die verschiedenen Grundformen und Analyseformen.
Schlüsselwörter
Gruppendiskussion, Auswertung, qualitative Inhaltsanalyse, Datenanalyse, Marktforschung, Forschungsmethoden, Anwendungsbereiche, Vorbereitende Maßnahmen, Theoriebildung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Gruppendiskussion in der Marktforschung?
Eine Gruppendiskussion ist eine qualitative Forschungsmethode, bei der eine Gruppe von Teilnehmern unter Anleitung eines Moderators über ein bestimmtes Thema diskutiert, um tiefere Einblicke in Meinungen und Verhaltensweisen zu gewinnen.
Welche vorbereitenden Maßnahmen sind für die Auswertung wichtig?
Wichtig sind die Transkription der Gespräche, die Klärung der Forschungsfragen sowie die Organisation der Daten, um eine systematische Analyse zu ermöglichen.
Was zeichnet die qualitative Inhaltsanalyse aus?
Die qualitative Inhaltsanalyse ist ein Verfahren zur systematischen Bearbeitung von Textmaterial. Sie nutzt Kategorien, um Inhalte zu strukturieren und wesentliche Aussagen zusammenzufassen.
Was versteht man unter objektiver Hermeneutik?
Dies ist eine Auswertungsmethode, die versucht, die latenten (tieferliegenden) Sinnstrukturen von Texten oder Gesprächsprotokollen unabhängig von der bewussten Absicht der Sprecher zu rekonstruieren.
Wann wird eine typologische Analyse angewandt?
Eine typologische Analyse wird genutzt, um aus den Diskussionsergebnissen bestimmte Personen- oder Verhaltenstypen herauszuarbeiten, die für die Fragestellung repräsentativ sind.
- Arbeit zitieren
- Viktoria Giller (Autor:in), 2017, Auswertung von Gruppendiskussionen. Vorbereitung, Analyse, Theoriebildung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/371104