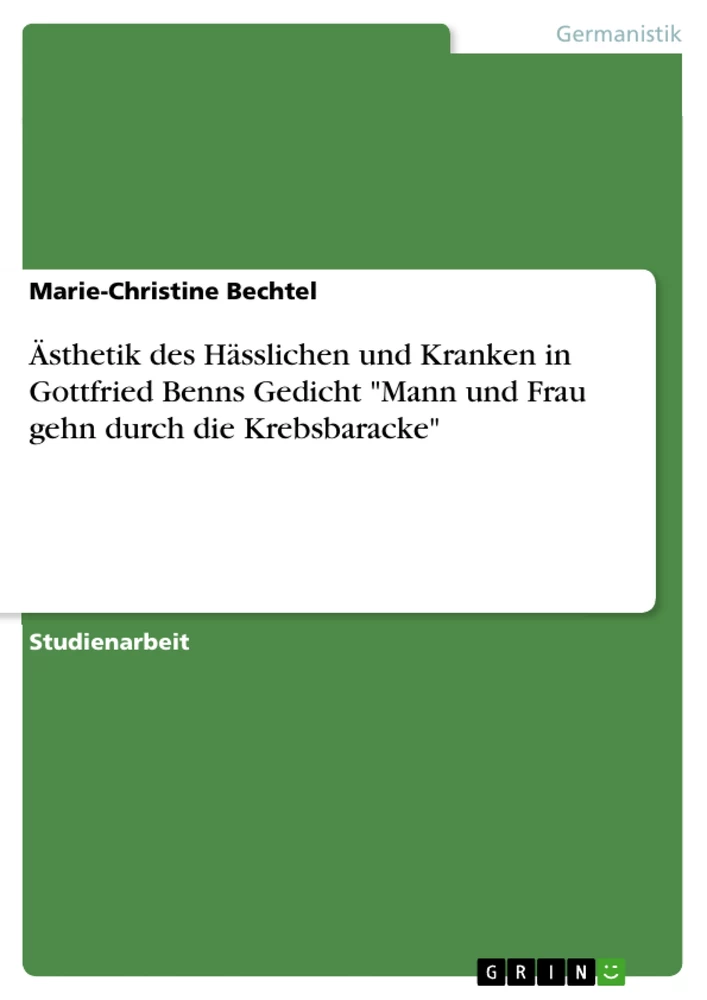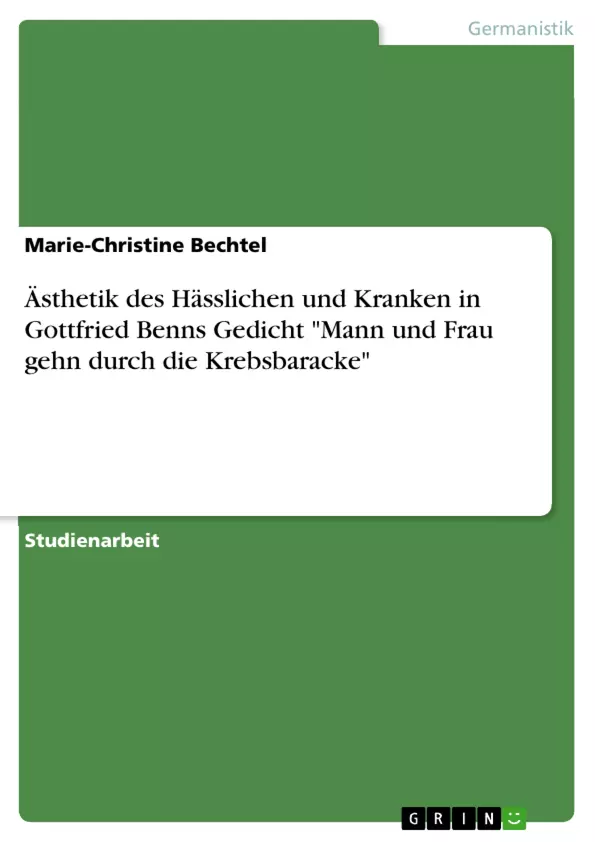In der vorliegenden Hausarbeit wird auf die "Ästhetik des Hässlichen" im Frühexpressionismus anhand eines exemplarischen Gedichts von Gottfried Benns eingegangen. Bei der Betrachtung des Ästhetik-Begriffs in seinem literaturhistorischen Kontext fällt auf, dass im Verlauf der Geschichte immer wieder die ‚Ästhetik‘ den Anlass zu zahlreichen literarischen, künstlerischen und philosophischen Texte gab. Der Inhalt dieser Hausarbeit fokussiert primär der Ästhetik des Hässlichen in Benns Gedicht "Mann und Frau gehn durch die Krebsbaracke". Dabei wird das Gedicht auf seine formalen und inhaltlichen Merkmale untersucht, die zentralen Motive der Krankheit, des Zerfalls und der Sexualität herausgearbeitet und versucht, die Frage nach der speziellen Ästhetik des Hässlichen in Benns Werk zu beantworten. Abschließend wird auf die expressionistischen Merkmale des Gedichts eingegangen, um dieses vom Naturalismus abgrenzen.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- DER ÄSTHETIK-BEGRIFF
- ÄSTHETIK-BEGRIFF IM EXPRESSIONISMUS
- GOTTFRIED BENNS MANN UND FRAU GEHN DURCH DIE KREBSBARACKE
- FORM UND AUFBAU
- INHALT
- ,,KOMM, HEBE RUHIG DIESE DECKE AUF"
- NATURALISMUS - ANTINATURALISMUS
- FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Ästhetik des Hässlichen im Frühexpressionismus anhand eines exemplarischen Gedichts von Gottfried Benn. Die Analyse des Ästhetik-Begriffs im historischen Kontext zeigt die Entwicklung des Hässlichen als künstlerisches Motiv. Der Schwerpunkt liegt auf der Untersuchung von Benns Gedicht „Mann und Frau gehn durch die Krebsbaracke“, wobei die formalen und inhaltlichen Merkmale analysiert werden, um die spezielle Ästhetik des Hässlichen in Benns Werk zu erforschen. Die Arbeit analysiert die zentralen Motive von Krankheit, Zerfall und Sexualität und grenzt das Gedicht vom Naturalismus durch die expressionistischen Merkmale ab.
- Die Entwicklung des Ästhetik-Begriffs im historischen Kontext
- Die Darstellung des Hässlichen in Benns Gedicht „Mann und Frau gehn durch die Krebsbaracke“
- Die Analyse der formalen und inhaltlichen Merkmale des Gedichts
- Die zentralen Motive von Krankheit, Zerfall und Sexualität im Gedicht
- Die Abgrenzung des Gedichts vom Naturalismus durch die expressionistischen Merkmale
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und erläutert den Fokus auf die Ästhetik des Hässlichen im Frühexpressionismus anhand eines Gedichts von Gottfried Benn. Der zweite Abschnitt befasst sich mit dem historischen Wandel des Ästhetik-Begriffs, behandelt die traditionelle Auffassung von Schönheit in der Kunst und die Herausforderungen, die der Umgang mit dem Hässlichen in der Tragödie mit sich brachte. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung des Hässlichen als künstlerisches Motiv. Der dritte Abschnitt analysiert Benns Gedicht „Mann und Frau gehn durch die Krebsbaracke“, wobei die formalen und inhaltlichen Merkmale des Gedichts sowie die zentralen Motive von Krankheit, Zerfall und Sexualität im Detail beleuchtet werden. Die Arbeit geht auch auf den Naturalismus ein und grenzt das Gedicht von dieser literarischen Strömung ab.
Schlüsselwörter
Ästhetik des Hässlichen, Frühexpressionismus, Gottfried Benn, „Mann und Frau gehn durch die Krebsbaracke“, Krankheit, Zerfall, Sexualität, Formalanalyse, Inhaltsanalyse, Naturalismus, Expressionismus.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet der Begriff „Ästhetik des Hässlichen“?
Es handelt sich um ein künstlerisches Konzept, bei dem nicht das Schöne, sondern das Kranke, Verfallende und Abstoßende zum Gegenstand der Kunst gemacht wird, um eine neue Form der Wahrheit auszudrücken.
Worum geht es in Gottfried Benns Gedicht „Mann und Frau gehn durch die Krebsbaracke“?
Das Gedicht beschreibt einen Rundgang durch ein Krankenhaus für unheilbar Kranke und zeigt schonungslos den körperlichen Zerfall, Eiter, Gestank und die menschliche Sterblichkeit.
Wie unterscheidet sich Benns Expressionismus vom Naturalismus?
Während der Naturalismus das Elend fotogetreu abbilden will, nutzt der Expressionismus das Hässliche als radikales Ausdrucksmittel, um bürgerliche Sehgewohnheiten zu zertrümmern und das Wesen des Seins zu enthüllen.
Welche Rolle spielt die Sexualität in dem Gedicht?
Benn kontrastiert die körperliche Liebe (Mann und Frau) mit dem totalen körperlichen Zerfall in der Baracke, was die Vergänglichkeit des Fleisches besonders drastisch hervorhebt.
Warum gilt das Gedicht als typisch für den Frühexpressionismus?
Es bricht radikal mit der Tradition der „schönen Kunst“ und thematisiert stattdessen die Tabus der modernen Großstadtgesellschaft, wie Krankheit und den anonymen Tod im Krankenhaus.
- Quote paper
- Marie-Christine Bechtel (Author), 2017, Ästhetik des Hässlichen und Kranken in Gottfried Benns Gedicht "Mann und Frau gehn durch die Krebsbaracke", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/371122