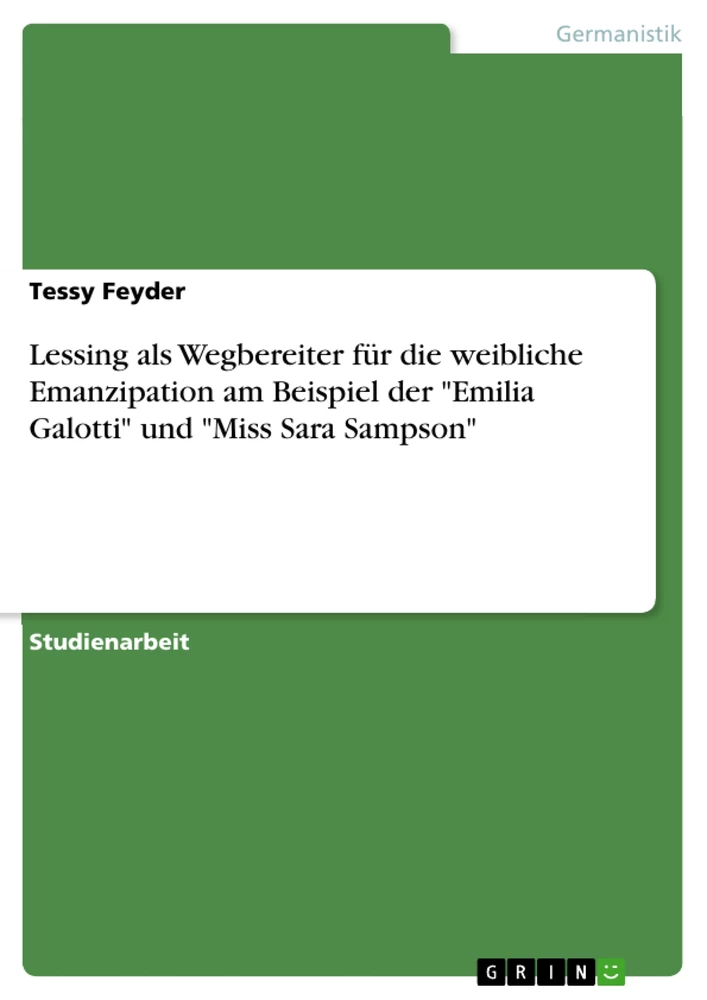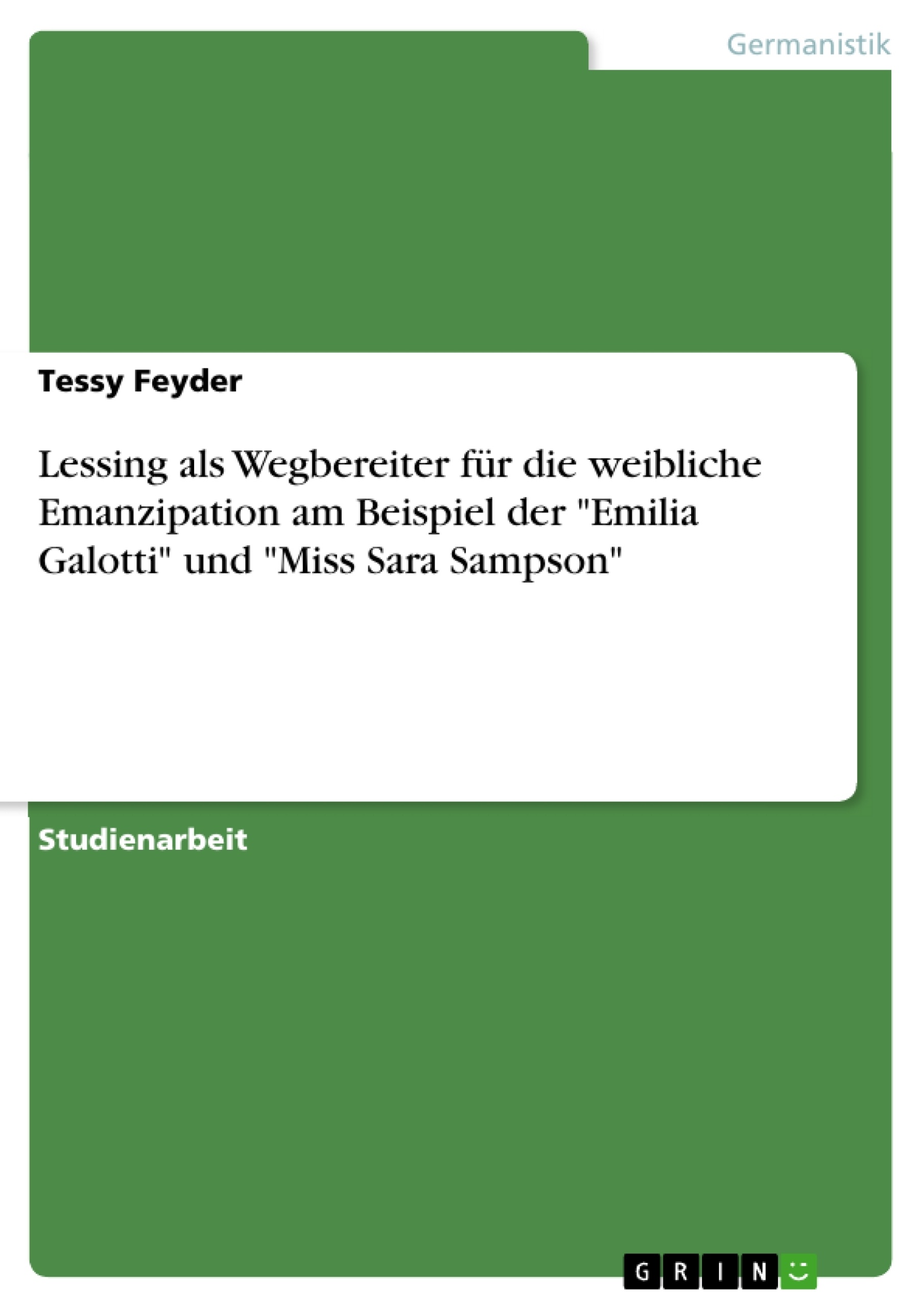Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit den Frauenbildern Lessings. Um diese besser zu verstehen, werden verschiedene Frauenbilder aus unterschiedlichen Dramen analysiert. In diesem Sinne widmet sich das erste Kapitel der Hausarbeitet zwei Frauengestalten aus der Tragödie “Emilia Galotti“ zu (Emilia und Orsina). Bei dieser Analyse wird der Fokus vor allem auf die Frage gelegt, inwiefern beide Figuren als emanzipierte Frauen betrachtet werden können. Im darauffolgenden Kapitel wird die Figur der Miss Sara Sampson aus dem gleichnamigen Trauerspiel untersucht. Hier gehen wir detaillierter auf die Handlung ein und konzertieren uns auf die emanzipierten Taten Saras.
Das 18. Jahrhundert gilt als prägendes Zeitalter für die Veränderung der Frauenrolle und steht für den Beginn der Frauenbewegung. Durch die Epoche der Aufklärung motiviert, welche unter anderem für die Handlungsfreiheit der Menschen plädierte, fingen die ersten mutigen Frauen (zuerst in England und Frankreich) an, an einen Umschwung der Frauenposition zu denken und ihren Missmut kundzutun. Ihre Bestrebungen, Proteste und Gedanken betrachtet man heute als die Wurzeln der Frauenemanzipation.
Die Frauen kämpften für einen sozialen Aufstieg sowie für die Gleichsetzung der Geschlechter. Bis jeher wurden Frauen nämlich nicht als den Männern ebenbürtig angesehen, sondern ihre Aufgabe bestand ausschließlich darin, als Ehefrau und Mutter zu dienen. Sie mussten sich somit ihren Ehemännern unterordnen und waren zudem auch rechtlich und ökonomisch von den Männern abhängig. Letzteres ging so weit, dass die Väter in der damaligen Zeit üblicherweise die Ehemänner für ihre Töchter aussuchten. Auch war den Frauen eine Ausbildung verwehrt, da diese sie von ihren Pflichten, nämlich die Erziehung der Kinder sowie das Erledigen des Haushalts, abhalten würde. Das Einzige, was den Frauen in ihrer Freizeit gestattet war, war die Zuwendung zur Literatur. Sie war das einzige Medium, aus welchem die Frauen sich weiterbilden konnten. Zusammenfassend bedeutet dies also, dass die Frauen eine feste Rollenordnung zu befolgen hatten und in einem starken Abhängigkeitsverhältnis zu ihrem Mann standen, welcher die einzige Pflicht hatte, sich um die Unterhaltszahlung seiner Frau zu sorgen. Die Frauen waren somit machtlos und mussten ihrer Stellung passiv erliegen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung: Die Stellung der Frau im 18. Jahrhundert
- 2. Aufbau der Hausarbeit
- 3. Die Frauenfiguren in Lessings Dramen
- 3.1. Emilia Galotti - Einführung in das Trauerspiel
- 3.1.1. Emilia
- 3.1.2. Orsina
- 3.2. Miss Sara Sampson. Einführung in das Drama “Miss Sara Sampson“
- 3.2.1. Miss Sara Sampson
- 3.1. Emilia Galotti - Einführung in das Trauerspiel
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit den Frauenbildern in Lessings Dramen. Durch die Analyse verschiedener Frauengestalten aus unterschiedlichen Werken, sollen die spezifischen Charakterzüge und die Stellung der Frau in Lessings Werken untersucht werden. Die Arbeit widmet sich dabei der Frage, inwiefern diese Figuren als emanzipiert betrachtet werden können und welche Rolle ihnen in den jeweiligen Dramen zukommt.
- Die Stellung der Frau im 18. Jahrhundert
- Die Darstellung von Frauen in Lessings Dramen
- Emanzipation und Selbstbestimmung der Frauenfiguren
- Die Rolle der Ehre in Lessings Dramen
- Das Motiv der Verführung und seine Auswirkungen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die gesellschaftliche Situation der Frau im 18. Jahrhundert. Es wird deutlich, dass Frauen in dieser Zeit einer strengen Rollenordnung unterworfen waren und keine Möglichkeit hatten, sich selbst zu verwirklichen. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Struktur der Hausarbeit und skizziert die behandelten Themen sowie die methodischen Vorgehensweisen. Im dritten Kapitel werden die Frauenfiguren in Lessings Dramen genauer untersucht. Zunächst werden Emilia und Orsina aus der Tragödie "Emilia Galotti" analysiert und es wird erörtert, inwiefern beide Figuren als emanzipiert betrachtet werden können. Im Anschluss wird die Figur der Miss Sara Sampson aus dem gleichnamigen Trauerspiel betrachtet und ihre emanzipierten Handlungen im Detail beleuchtet. Die Arbeit zeichnet ein umfassendes Bild der weiblichen Figuren in Lessings Dramen und zeigt deren komplexe Rolle in der patriarchalischen Gesellschaft des 18. Jahrhunderts auf.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Frauenbilder in Lessings Dramen, insbesondere die Figuren Emilia Galotti, Orsina und Miss Sara Sampson. Die zentralen Themen sind Emanzipation, Selbstbestimmung, Ehre, Verführung und die Darstellung von Frauen in der patriarchalischen Gesellschaft des 18. Jahrhunderts. Die Untersuchung beleuchtet den Einfluss von Lessings Werken auf die gesellschaftliche Debatte über die Stellung der Frau und den Beginn der Frauenbewegung.
- Quote paper
- Tessy Feyder (Author), 2016, Lessing als Wegbereiter für die weibliche Emanzipation am Beispiel der "Emilia Galotti" und "Miss Sara Sampson", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/371124