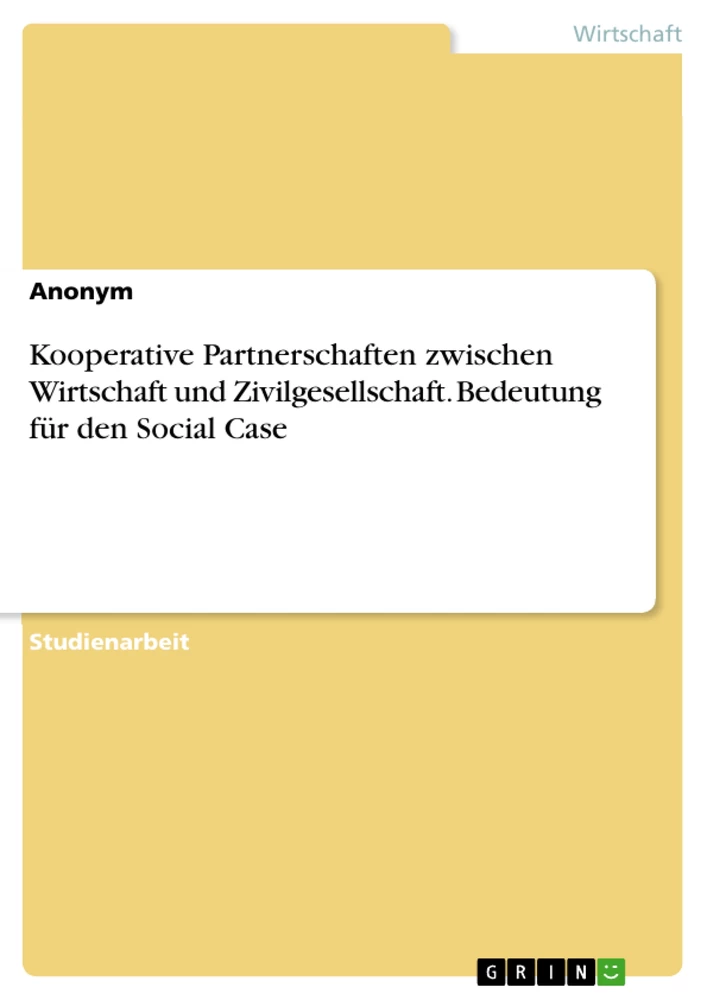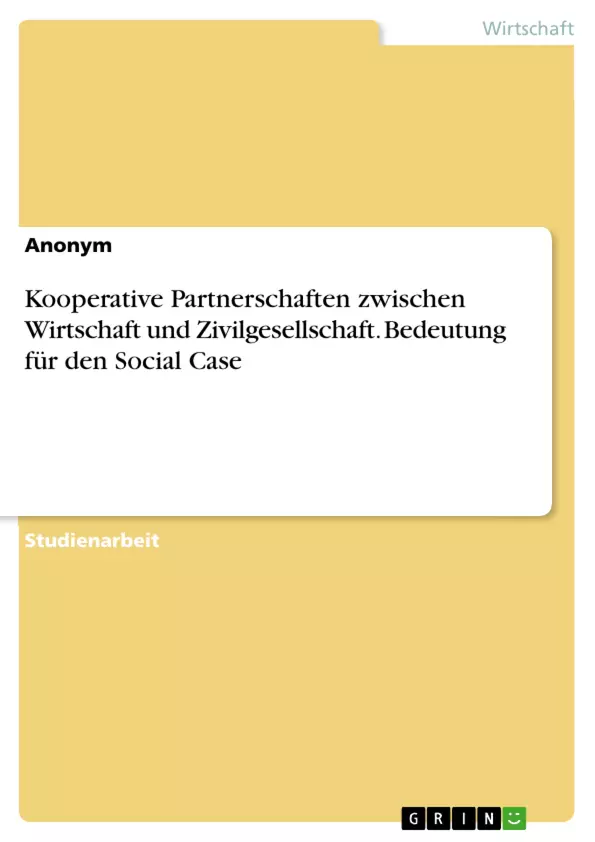Diese Hausarbeit ist dem Themenschwerpunkt „Strategische Kooperation im globalen Kontext“ zuzuordnen. Gegenwärtig wird in diesem Kontext immer wieder die Frage nach dem Stellenwert von Nichtregierungsorganisationen bzw. non-governmental organizations (NGOs) innerhalb der Gesellschaft diskutiert, wobei sich viele Kritiker nicht einig sind, ob NGOs durch ihre Arbeit primär einen gesellschaftlichen Nutzen generieren oder Machtinteressen und Lobbyismus das Handeln der NGOs bestimmen.
Aus diesem Grund untersucht diese Hausarbeit das Verhältnis zwischen multinationalen Unternehmen (MNU) und NGOs in kooperativen Partnerschaften. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage nach der Bedeutung dieser Partnerschaften für den sogenannten Social Case. In der Theorie wird grundsätzlich eine Unterteilung in Business Case und Social Case vorgenommen. Der Business Case befasst sich mit dem Wertschöpfungsbeitrag eines Projektes und betrachtet auch soziales Engagement als einen Wettbewerbsfaktor für Unternehmen. Unter dem Social Case hingegen versteht man den gesellschaftlichen Nutzen, der durch ein solches partnerschaftliches Engagement entsteht.
In Verbindung mit der Leitfrage werden MNU und NGOs als Erstes isoliert voneinander betrachtet. Dabei wird auf ihre jeweiligen Bezugssysteme, Motive und Interessen eingegangen. Nachdem mit Hilfe dieser Erkenntnisse die Sinnhaftigkeit einer Partnerschaft für die beiden Partner herausgearbeitet wird, soll anschließend beleuchtet werden, welchen Nutzen kooperative Partnerschaften für die Gesellschaft bzw. die Umwelt haben und welche spezifischen Chancen und Risiken im Vergleich zu staatlichen bzw. politischen Maßnahmen entstehen können.
Daraufhin sollen konkrete Überlegungen vorangetrieben werden, die sich damit befassen, ob und inwiefern staatliche Maßnahmen durch die beschriebenen Partnerschaften vollständig ersetzt werden können. Letztendlich soll daraus abschließend ein Fazit entwickelt werden, das die Auswirkungen auf den Social Case beschreibt. Dabei soll festgestellt werden, ob der Social Case allein durch Partnerschaften zwischen MNU und NGOs gewahrt werden kann oder möglicherweise in Gefahr gerät, sofern die Politik keinen Einfluss auf den Social Case nimmt. Eine Handlungsempfehlung für die beteiligten Akteure bildet den Abschluss dieser Hausarbeit.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Kooperative Partnerschaften zwischen MNU und NGOs
- 2.1. Eigenschaften der beiden Partner
- 2.2. Entstehende Vor- und Nachteile für die Partner
- 2.3. Beispiele für Maßnahmen und Methoden zum Erreichen des Social Case
- 3. Bedeutung der Politik für den Social Case
- 3.1. Verhältnis zu kooperativen Partnerschaften
- 3.2. Bedeutung von Global Governance für den Social Case
- 3.3. Schlussfolgerung in Bezug auf den Social Case
- 4. Fazit
- 4.1. Vorteile von kooperativen Partnerschaften bzw. der Politik
- 4.2. Ausblick auf die Entwicklung des Social Case
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Bedeutung kooperativer Partnerschaften zwischen multinationalen Unternehmen (MNU) und Nichtregierungsorganisationen (NGOs) für den Social Case. Dabei wird untersucht, wie diese Partnerschaften im Kontext des globalen Engagements zu einem gesellschaftlichen Nutzen beitragen können. Die Arbeit beleuchtet die Eigenschaften der beiden Partner, die Vorteile und Nachteile der Zusammenarbeit sowie die Rolle der Politik im Zusammenhang mit dem Social Case.
- Bedeutung von kooperativen Partnerschaften zwischen MNU und NGOs
- Motive und Interessen der Partner
- Chancen und Risiken der Partnerschaften im Vergleich zu staatlichen Maßnahmen
- Einfluss der Politik auf den Social Case
- Auswirkungen von Partnerschaften auf den Social Case
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung der Hausarbeit führt den Leser in das Thema ein und definiert den Begriff „Social Case“. Kapitel 2 beleuchtet die Eigenschaften von MNU und NGOs, insbesondere ihre jeweiligen Motive und Interessen, und untersucht, wie sich diese in einer Kooperation ergänzen können. Kapitel 3 befasst sich mit der Rolle der Politik im Zusammenhang mit dem Social Case und analysiert die Beziehung zwischen staatlichen Maßnahmen und kooperativen Partnerschaften. Die Arbeit stellt die Frage, ob staatliche Maßnahmen durch Partnerschaften vollständig ersetzt werden können. Schließlich wird in Kapitel 4 ein Fazit gezogen, das die Auswirkungen von Partnerschaften auf den Social Case und die Bedeutung der Politik für diesen analysiert.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit befasst sich mit den Themen Kooperative Partnerschaften, MNU, NGOs, Social Case, Global Governance, gesellschaftliches Engagement, Wertschöpfungsbeitrag, Gewinnorientierung, Philanthropie, gesellschaftlicher Nutzen, staatliche Maßnahmen und Handlungsempfehlung.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem "Social Case"?
Unter dem Social Case versteht man den gesellschaftlichen Nutzen, der durch partnerschaftliches Engagement zwischen Unternehmen und NGOs entsteht.
Wie unterscheiden sich Business Case und Social Case?
Der Business Case fokussiert auf den Wertschöpfungsbeitrag und Wettbewerbsvorteile für das Unternehmen, während der Social Case den Nutzen für Gesellschaft und Umwelt in den Vordergrund stellt.
Warum kooperieren multinationale Unternehmen (MNU) mit NGOs?
Unternehmen suchen oft nach Legitimität und Fachwissen für ihr soziales Engagement, während NGOs Ressourcen und Plattformen zur Umsetzung ihrer Ziele gewinnen können.
Können Kooperationen staatliche Maßnahmen ersetzen?
Die Arbeit untersucht kritisch, ob diese Partnerschaften staatliches Handeln vollständig ersetzen können oder ob die Politik weiterhin steuernd eingreifen muss, um den Social Case zu sichern.
Was sind Risiken solcher Partnerschaften?
Kritiker befürchten, dass NGOs durch Lobbyismus beeinflusst werden könnten oder dass Machtinteressen der Unternehmen den eigentlichen gesellschaftlichen Nutzen überlagern.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2014, Kooperative Partnerschaften zwischen Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Bedeutung für den Social Case, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/371160