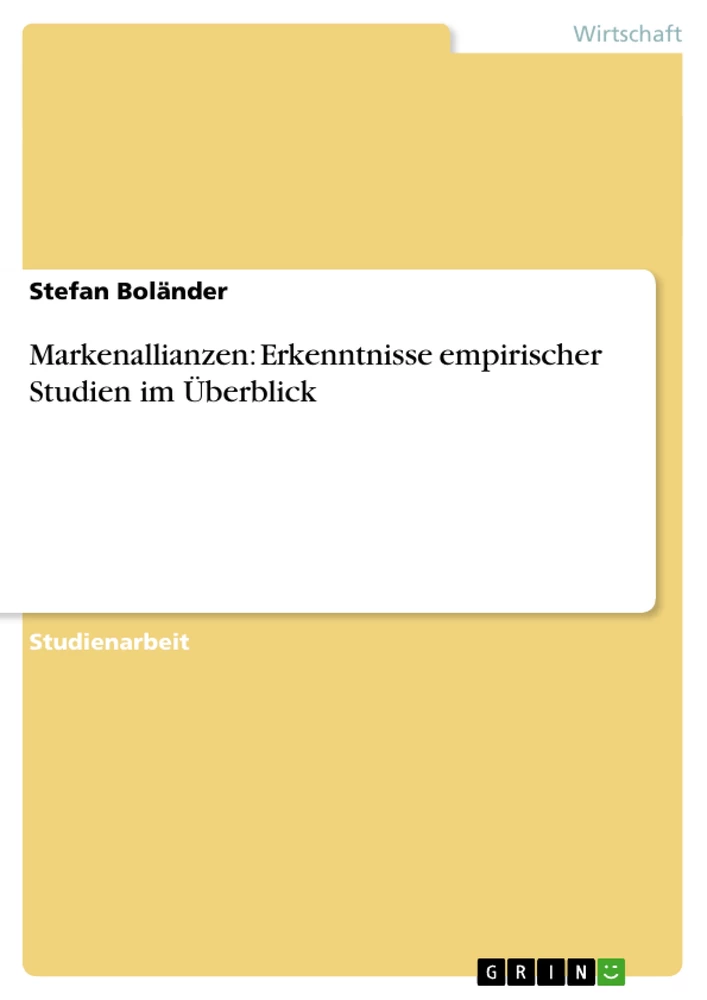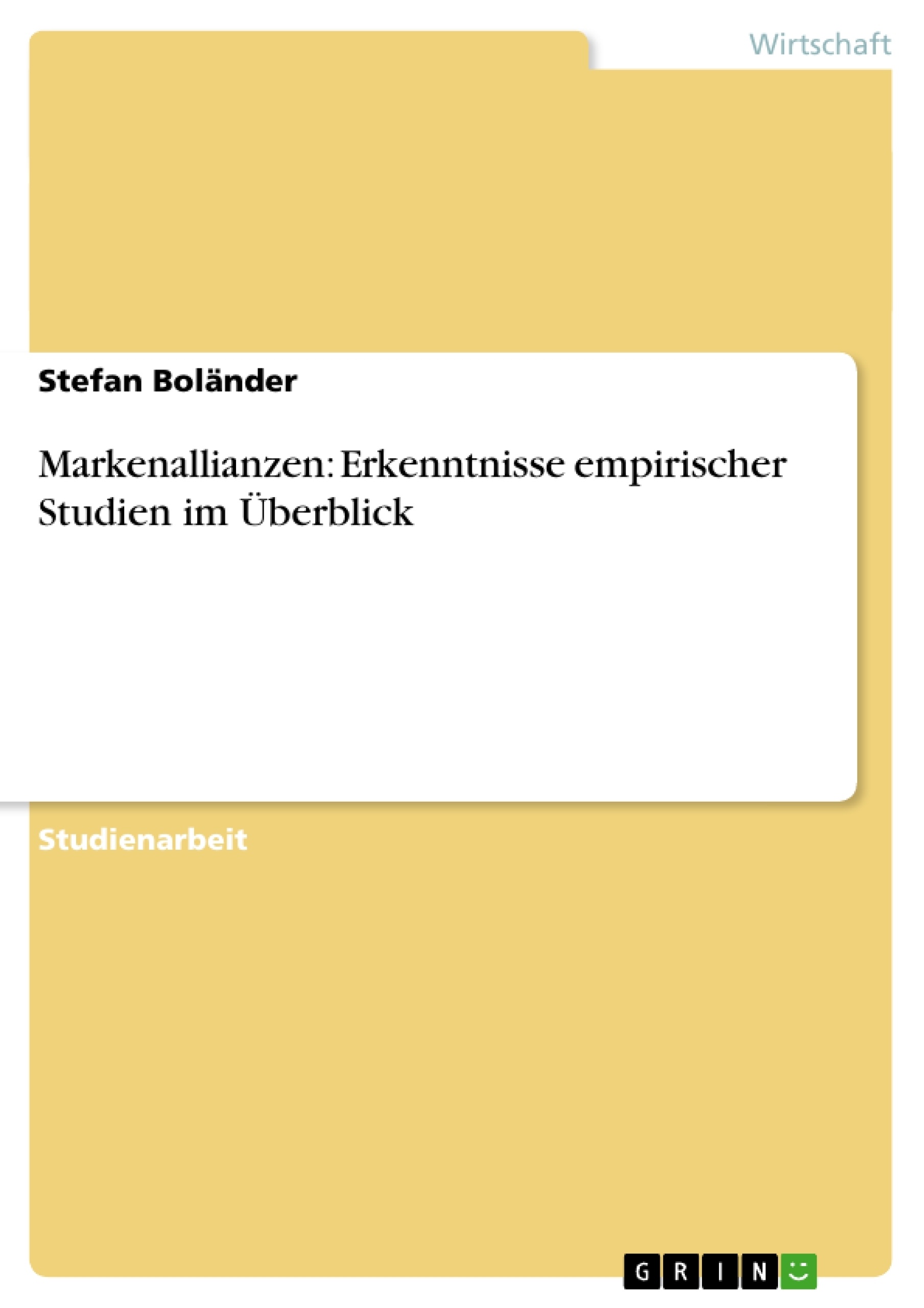Eine Marke ist aus absatzwirtschaftlicher Sicht ein Name, Begriff, Zeichen, Symbol, eine Gestaltungsform oder eine Kombination aus diesen Bestandteilen zum Zwecke der Kennzeichnung der Produkte oder Dienstleistungen eines Anbieters oder einer Anbietergruppe und der Differenzierung gegenüber Konkurrenzangeboten. Konsumenten verbinden mit Marken bestimmte Assoziationen. Für Unternehmen sind Marken daher zentrale unternehmensstrategische Elemente, über die das Marktverhalten von Konsumenten beeinflusst werden kann. Aus diesem Grund hat die Markenführung inzwischen eine bedeutende Position in der strategischen Planung in Unternehmen eingenommen. Die Kenntnis von der besonderen Konsumentenwirkung lässt die Unternehmen ihre Marken in immer vielfältigeren Erscheinungsformen vermarkten. Markenallianzen erlangten in den 1990ern in der Markenpolitik zunehmenden Stellenwert. Sie stellen ein interessantes Instrument dar, die Wahrnehmung von Marken durch den Konsumenten in vergleichsweise effektiver Form zu beeinflussen. Durch sie sollen die Kraft mehrerer Marken gebündelt werden, um Vorteile bei der Markenführung zu realisieren, die sich gegenüber der Nutzung von nur einer Marke ergeben. Die beteiligten Unternehmen erhoffen sich davon besondere präferenzbildende Wirkungen bei den Konsumenten. Aufgrund rechtlicher Entwicklungen wie dem Wegfall der Zugabenverordnung erweitert sich das Potenzial von Markenallianzen erheblich. Typische Beispiele für solche Markenallianzen sind Schöller Mövenpick-Eis, Ritter Sport Smarties-Schokolade oder Computer von Fujitsu Siemens.
In der Literatur wurde das Thema der Markenallianz erst in der jüngeren Vergangenheit verstärkt aufgegriffen und untersucht. Diese Arbeit soll einen Überblick über verschiedene bisher erschienene empirische Studien geben und diese in kurzer Form zusammenfassen. Dabei wird besonders auf relevante Erfolgsfaktoren bei der Bildung von Markenallianzen und die Wirkungen von Markenallianzen eingegangen. Zuvor wird ein Überblick über die Verwendung unterschiedlicher Begriffe und Darbietungsformen von Markenallianzen gegeben.
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Motivation und Ziele der Arbeit
2. Markenallianzen – Begriffe und Formen in der Literatur
2.1. Allgemein
2.2. Begriffsabgrenzungen
3. Wirkung und Management von Markenallianzen
3.1. Empirische Studien zu Markenallianzen im Überblick
3.1.1. Analyse von Spillover-Effekten von Einstellungen zu Marken beim Einsatz von Markenallianzen
3.1.2. Produkt-Beurteilung bei direkten Markenerweiterungen im Vergleich zu indirekten Markenerweiterungen
3.1.3. Die Wirkung von hochwertig eingeschätzten Marken auf die Durchführung von Ingredient Brands
3.1.4. Beeinflussung der Qualitätswahrnehmung durch den Einsatz von Markenallianzen
3.1.5. Beurteilung von Markenerweiterungen durch den Einfluss von Ingredient Brands
3.1.6. Einfluss der Beurteilung von einzelnen Marken auf eine Markenallianz
3.2. Management von Markenallianzen
3.2.1. Identifizierte Erfolgsfaktoren zur Markenallianzführung
3.2.2. Empirische Erkenntnisse im Managementprozess
4. Kritische Würdigung
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Begriffe aus dem Kontext von Markenkombinationen
Abb. 2: Zentrale Studien zur Wirkung von Markenallianzen
Abb. 3: Matrix zur Erfassung des Grenznutzens von Markierungen
Abkürzugsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Motivation und Ziele der Arbeit
Eine Marke ist aus absatzwirtschaftlicher Sicht ein Name, Begriff, Zeichen, Symbol, eine Gestaltungsform oder eine Kombination aus diesen Bestandteilen zum Zwecke der Kennzeichnung der Produkte oder Dienstleistungen eines Anbieters oder einer Anbietergruppe und der Differenzierung gegenüber Konkurrenzangeboten. Konsumenten verbinden mit Marken bestimmte Assoziationen. Für Unternehmen sind Marken daher zentrale unternehmensstrategische Elemente, über die das Marktverhalten von Konsumenten beeinflusst werden kann. Aus diesem Grund hat die Markenführung inzwischen eine bedeutende Position in der strategischen Planung in Unternehmen eingenommen. Die Kenntnis von der besonderen Konsumentenwirkung lässt die Unternehmen ihre Marken in immer vielfältigeren Erscheinungsformen vermarkten. Markenallianzen erlangten in den 1990ern in der Markenpolitik zunehmenden Stellenwert. Sie stellen ein interessantes Instrument dar, die Wahrnehmung von Marken durch den Konsumenten in vergleichsweise effektiver Form zu beeinflussen. Durch sie sollen die Kraft mehrerer Marken gebündelt werden, um Vorteile bei der Markenführung zu realisieren, die sich gegenüber der Nutzung von nur einer Marke ergeben. Die beteiligten Unternehmen erhoffen sich davon besondere präferenzbildende Wirkungen bei den Konsumenten. Aufgrund rechtlicher Entwicklungen wie dem Wegfall der Zugabenverordnung erweitert sich das Potenzial von Markenallianzen erheblich. Typische Beispiele für solche Markenallianzen sind Schöller Mövenpick-Eis, Ritter Sport Smarties-Schokolade oder Computer von Fujitsu Siemens.
In der Literatur wurde das Thema der Markenallianz erst in der jüngeren Vergangenheit verstärkt aufgegriffen und untersucht. Diese Arbeit soll einen Überblick über verschiedene bisher erschienene empirische Studien geben und diese in kurzer Form zusammenfassen. Dabei wird besonders auf relevante Erfolgsfaktoren bei der Bildung von Markenallianzen und die Wirkungen von Markenallianzen eingegangen. Zuvor wird ein Überblick über die Verwendung unterschiedlicher Begriffe und Darbietungsformen von Markenallianzen gegeben.
2. Markenallianzen – Begriffe und Formen in der Literatur
Für ein besseres Verständnis der verschiedenen Formen von Markenallianzen und deren Bedeutung soll als erstes auf einige Begriffe aus der Themenstellung genauer eingegangen werden.
2.1. Allgemein
Eine Marke dient der Kennzeichnung und Individualisierung von Waren und Dienstleistungen im Wettbewerb. Des Weiteren erfüllt die Marke eine Orientierungs- und Wiedererkennungsfunktion, eine Qualitätssicherungs- bzw. Vertrauensschutzfunktion sowie eine Prestigefunktion. Auf der Suche nach Möglichkeiten, die Absatzchancen der eigenen Produkte durch Differenzierung und Präferenzbildung zu verbessern, bieten sich Markenkombinationen als geeignetes Instrument an. Die gemeinsame Darbietung mehrerer Marken im Zusammenhang mit einem eigenständigen Leistungsangebot wird als Markenkombination bezeichnet.[1] Bei einer Markenkombination wird beispielsweise eine Tafel Schokolade nicht unter einer einzelnen Marke angeboten, sondern das Produkt wird dem Konsumenten mit zwei Marken angeboten. Als Beispiel sei hier Ritter Sport-Schokolade mit Baileys anzuführen. Von der Bündelung der Marken versprechen sich Unternehmen Vorteile gegenüber der Nutzung einer einzigen Marke. Markenallianzen stellen eine Ausprägung von Markenkombinationen dar.[2] Aus unternehmensstrategischer Sicht können Markenallianzen als ein Sonderfall von strategischen Allianzen angesehen werden.[3] Bei einer strategischen Allianz handelt es sich um eine freiwillige, längerfristige Beziehung zwischen Unternehmen, die mit dem Ziel eingegangen wird, die eigenen Schwächen durch Stärken der anderen Organisation zu kompensieren, um somit die Wettbewerbsposition der Allianzpartner langfristig auszubauen oder zu sichern.[4] Markenallianzen besitzen demgegenüber einen spezielleren Betrachtungsschwerpunkt. Markenallianzen sind ausschließlich marktgerichtet und beziehen sich auch nur auf Fälle, in denen eine gemeinsame Leistung für den Konsumenten sichtbar durch zwei oder mehr unabhängige Marken gekennzeichnet ist. Die Kooperation beschränkt sich bei Markenallianzen auf den Bereich der Markenpolitik und setzt die gemeinsame Darbietung der kooperierenden Marken im Zusammenhang mit einer Leistung voraus.[5] Weiter gefasst sind Markenallianzen eine koordinierte Kooperation zwischen zwei oder mehreren rechtlich und wirtschaftlich selbständigen Unternehmens- und Geschäftsbereichen. Diese bringen vorwiegend immaterielle Ressourcen in eine langfristige Zusammenarbeit ein. Mit Hilfe dieser Ressourcen streben sie gemeinsam danach, Wettbewerbsvorteile dadurch zu erlangen, dass sie ihr psycho-emotionales Leistungsangebot weitgehend ergänzen und durch die Ergänzung der Leistung auf dieser Ebene der Nachfrager eine Steigerung des Nutzens erfährt.[6]
2.2. Begriffsabgrenzungen
Die unterschiedlichen Auffassungen in der Literatur über das Thema Markenallianzen drücken sich bei der Definition der in diesem Zusammenhang verwendeten Begriffe aus. Im Folgenden werden die zentralen Termini aus diesem Kontext vorgestellt und erklärt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Begriffe aus dem Kontext von Markenkombinationen
Quelle: In Anlehnung an Redler (2003), S. 18.
Co-Branding: In der Literatur wird der Begriff Co-Branding oft als Synonym für Markenallianzen verwendet. Allerdings trifft man beim Co-Branding, wie bei der Markenallianz selbst, auf unterschiedliche Reichweiten des Begriffs. Weiter gefasste Definitionen verstehen darunter, die Verwendung von zwei existierenden Marken auf einem Produkt[7] oder dass zwei oder mehr bekannte Marken in einer angebotenen Leistung gemeinsam verwendet werden.[8] Etwas enger definiert liegt der Co-Branding-Fall vor, wenn zwei weiterhin eigenständige Marken mittel- oder langfristig kooperieren, dies vom Konsumenten wahrgenommen wird, und das Potenzial der Netto-Wert-Schaffung zu gering ist, um die Schaffung einer eigenen Marke oder eine andere Kooperationsform zu rechtfertigen.[9] Im Wesentlichen versteht man in der Literatur unter dem Begriff Co-Branding eine unternehmensübergreifende Form der Markenkombination. Dabei kann man unterscheiden, ob zwei Herstellermarken funktionell miteinander verknüpft werden (Composite Brand Alliances; Beispiel: Rasierer von Philips und Nivea) oder ob lediglich zwei Markennamen miteinander verknüpft werden (Co-Naming; Beispiel: Renault 205 Lacoste)
[...]
[1] Vgl. Redler, (2003), S. 11.
[2] Vgl. Redler, (2003), S. 14.
[3] Vgl. Huber in: Redler (2003), S. 14, Redler (2003) S. 14f.
[4] Vgl. Sheth und Parvatiyar in: Redler (2003), S.15.
[5] Vgl. Redler, (2003), S. 15.
[6] Vgl. Huber in Redler (2003), S. 16, Redler (2003) S. 16.
[7] Vgl. Levin et al. in: Redler (2003), S. 17.
[8] Vgl. Kotler in: Redler (2003), S. 17.
[9] Vgl. Blackett/Russell in: Redler (2003), S. 18.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter einer Markenallianz?
Eine Markenallianz ist die gemeinsame Kennzeichnung einer Leistung durch zwei oder mehr unabhängige Marken, um die Kräfte der Marken zu bündeln und die Wahrnehmung der Konsumenten positiv zu beeinflussen.
Was ist der Unterschied zwischen Markenallianzen und strategischen Allianzen?
Während strategische Allianzen allgemein die Zusammenarbeit zur Kompensation von Schwächen sind, beziehen sich Markenallianzen speziell auf die marktgerichtete Kooperation in der Markenpolitik.
Was bedeutet der Begriff Co-Branding?
Co-Branding wird oft synonym zu Markenallianzen verwendet und beschreibt die Verwendung von zwei existierenden Marken auf einem Produkt oder in einer angebotenen Leistung.
Welche Beispiele für Markenallianzen werden in der Arbeit genannt?
Typische Beispiele sind Schöller Mövenpick-Eis, Ritter Sport Smarties-Schokolade oder Computer von Fujitsu Siemens.
Was sind Spillover-Effekte bei Markenallianzen?
Dabei handelt es sich um die Übertragung von Einstellungen oder Image-Assoziationen von einer Marke auf die andere innerhalb der Allianz.
Welche Erfolgsfaktoren werden in der Arbeit untersucht?
Die Arbeit gibt einen Überblick über empirische Studien zu relevanten Erfolgsfaktoren bei der Bildung und Führung von Markenallianzen.
- Citation du texte
- Stefan Boländer (Auteur), 2004, Markenallianzen: Erkenntnisse empirischer Studien im Überblick, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/37116