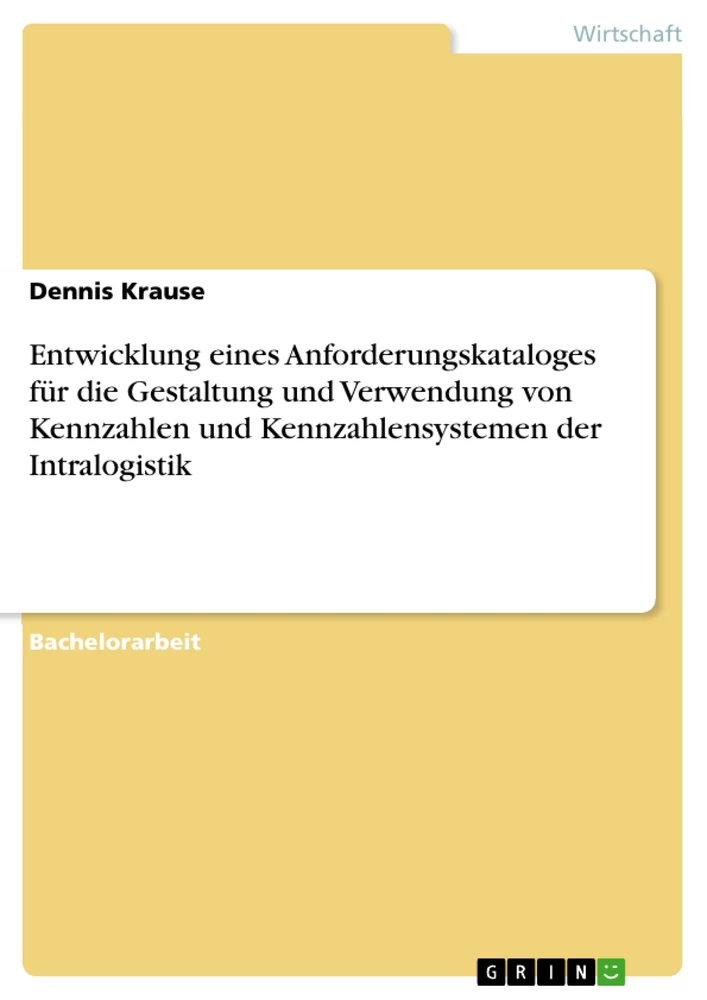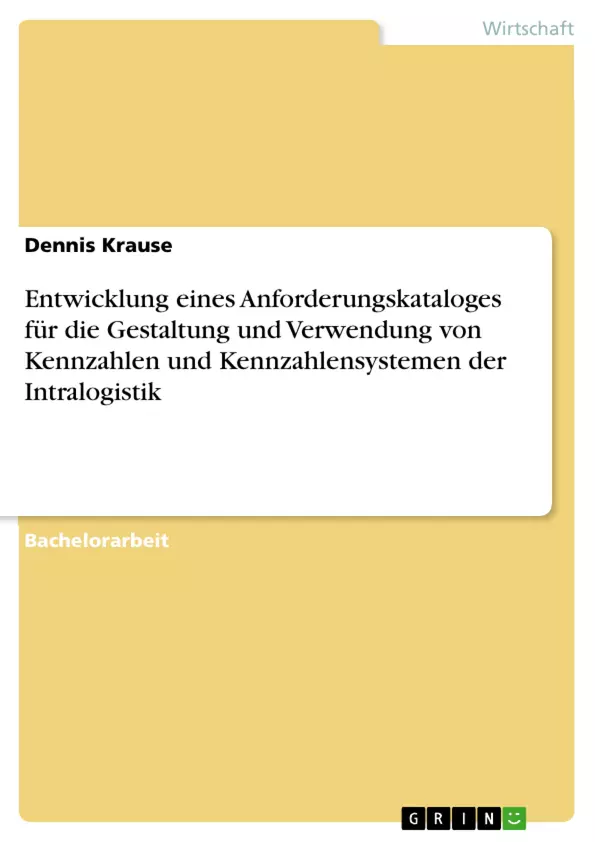Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, die relevanten Kernanforderungen als Basis mit ergänzenden Anforderungen an monetären und nicht monetären Kennzahlen sowie an Kennzahlensystemen zu gestalten und in einem modularen gewichteten Anforderungskatalog darzustellen und zu gewichten. Nach Ausarbeitung und Gestaltung des modularen Anforderungskataloges wird der Anforderungskatalog an ausgewählten monetären und nicht monetären Kennzahlen in den Unternehmensbereichen der Intra-logistik sowie an einem Kennzahlensystem angewendet. Der zu entwickelnde modulare gewichtete Anforderungskatalog stellt die Problemlösung dar.
Für die Erreichung der operativen und strategischen Unternehmensziele bei immer schnelllebigen und globalisierten Märkten, benötigen die unternehmensentscheidungsrelevante Informationen, um daraus kurzfristige und langfristige Entscheidungen, Planungen und Kontrollen für die Wettbewerbsfähigkeit und Zielerreichung des Unternehmens formulieren und durchführen zu können. Durch die kontinuierliche Auswertung entscheidungsrelevanter Informationen lassen sich über Verbesserungen und Maßnahmen, von z.B. Prozessen, Steigerungen des Unternehmenserfolges erzielen. Hierin liegt ein nutzbares Rationalisierungspotential, welches ein leistungsfähiges Informationssystem benötigt.
Entscheidungsrelevante Informationen erhalten viele Unternehmen unter anderem durch Kennzahlen und Kennzahlensystemen. Dabei variieren die relevanten Kennzahlen eines Unternehmens von Branche zu Branche. Es gibt kein Patentrezept, welche Kennzahlen für welches Unternehmen essentiell sind. Entscheidend bei der Auswahl der benötigten Kennzahlen ist die Vision, die auf dem Markt agierende Strategie, die Kernkompetenzen sowie die Unternehmensstruktur des Unternehmens. Daraus bilden sich die einzelnen Kennzahlen und Kennzahlensysteme, welche für das Unternehmen von Bedeutung sind.
Unternehmen, die im Wettbewerb über optimale Führungsinstrumente in Form von Kennzahlen und Kennzahlensystemen und damit verbundenen entscheidungsrelevanten Informationen verfügen, haben im wirtschaftlichen Wettbewerb die größeren Chancen. Es kann auf breiterer Basis und größerer Sorgfalt analysiert, komplexer gedacht und gezielter disponiert werden. Zudem ist das Unternehmen in Ihren internen sowie externen Handlungen schneller aktionsfähig.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 1.1. Problemstellung
- 1.2. Ziel der Arbeit
- 1.3. Forschungsstand
- 2. Intralogistik
- 2.1. Begriff Intralogistik
- 2.2. Unternehmensbereiche der Intralogistik
- 2.3. Ziele der Intralogistik
- 3. Untersuchungsgegenstand Kennzahlen und Kennzahlensysteme
- 3.1. Definition und Systematiken von Kennzahlensystemen
- 3.2. Begriff Kennzahl, Kennzahlenarten und Kennzahlenvergleiche
- 3.3. Systematisierung und Klassen von Kennzahlen
- 3.4. Funktionen von Kennzahlen und Kennzahlensystemen
- 3.5. Die 10 Teilschritte des Einsatzes von Kennzahlen
- 3.6. Grenzen von Kennzahlen und Kennzahlensystemen
- 4. Anforderungen an Kennzahlen und Kennzahlensystemen und Entwicklung eines modularen Anforderungskataloges für die Intralogistik
- 4.1. Begriff Anforderung, Anforderungskatalog und modularer Anforderungskatalog
- 4.2. Kernanforderungen an Kennzahlen und Kennzahlensystemen
- 4.3. Ergänzende Anforderungen an monetären Kennzahlen
- 4.4. Ergänzende Anforderungen an nicht monetären Kennzahlen
- 4.5. Ergänzende Anforderungen an Kennzahlensystemen
- 4.6. Gewichteter modularer Anforderungskatalog der Intralogistik
- 5. Anwendung des modularen Anforderungskataloges in der Intralogistik
- 5.1. Ausgewählte Kennzahlen
- 5.1.1. Beschaffungslogistik
- 5.1.2. Produktionslogistik
- 5.1.3. Distributionslogistik
- 5.1.4. Rentabilitätskennzahl
- 5.2. Ausgewähltes Kennzahlensystem
- 5.2.1. Vorstellung eines ausgewählten Kennzahlensystems
- 5.2.2. Anwendung des modularen Anforderungskataloges
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der Entwicklung eines modularen Anforderungskataloges für die Gestaltung und Verwendung von Kennzahlen und Kennzahlensystemen in der Intralogistik. Das Ziel der Arbeit ist es, einen umfassenden Katalog zu erstellen, der die wichtigsten Anforderungen an Kennzahlen und Kennzahlensysteme in diesem Bereich abdeckt. Der Katalog soll dabei helfen, die Qualität und Aussagekraft von Kennzahlen und Kennzahlensystemen in der Intralogistik zu verbessern.
- Definition und Systematiken von Kennzahlensystemen
- Begriff Kennzahl, Kennzahlenarten und Kennzahlenvergleiche
- Systematisierung und Klassen von Kennzahlen
- Funktionen von Kennzahlen und Kennzahlensystemen
- Anforderungen an Kennzahlen und Kennzahlensysteme in der Intralogistik
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit ein. Es beleuchtet den aktuellen Forschungsstand zum Thema Kennzahlen und Kennzahlensysteme in der Intralogistik. Das zweite Kapitel behandelt den Begriff der Intralogistik und beschreibt die relevanten Unternehmensbereiche sowie die Ziele der Intralogistik. Kapitel 3 widmet sich dem Untersuchungsgegenstand Kennzahlen und Kennzahlensysteme. Es definiert die Begriffe und stellt verschiedene Systematiken und Klassen von Kennzahlen vor. Außerdem werden die Funktionen von Kennzahlen und Kennzahlensystemen sowie die 10 Teilschritte des Einsatzes von Kennzahlen behandelt. Kapitel 4 entwickelt einen modularen Anforderungskatalog für die Intralogistik. Der Katalog umfasst sowohl Kernanforderungen als auch ergänzende Anforderungen an Kennzahlen und Kennzahlensystemen. Im fünften Kapitel wird der Anforderungskatalog anhand von ausgewählten Kennzahlen und einem ausgewählten Kennzahlensystem angewendet. Es werden dabei verschiedene Anwendungsszenarien in der Intralogistik aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Intralogistik, Kennzahlen, Kennzahlensysteme, Anforderungskatalog, modularer Anforderungskatalog, Beschaffungslogistik, Produktionslogistik, Distributionslogistik, Rentabilität, Balanced Scorecard.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des Anforderungskataloges für die Intralogistik?
Ziel ist die Gestaltung und Gewichtung von Anforderungen an Kennzahlen und Kennzahlensysteme zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit.
Was unterscheidet monetäre von nicht monetären Kennzahlen?
Monetäre Kennzahlen basieren auf Geldwerten (z.B. Rentabilität), während nicht monetäre Kennzahlen physische Größen oder Zeitwerte (z.B. Durchlaufzeiten) messen.
In welchen Bereichen der Intralogistik wird der Katalog angewendet?
Anwendungsbereiche sind die Beschaffungs-, Produktions- und Distributionslogistik.
Warum gibt es kein "Patentrezept" für Kennzahlen?
Die Auswahl hängt stark von der individuellen Vision, Strategie, Kernkompetenz und Struktur des jeweiligen Unternehmens ab.
Was ist eine Balanced Scorecard (BSC)?
Es ist ein ganzheitliches Kennzahlensystem, das neben Finanzkennzahlen auch Kunden-, Prozess- und Innovationsperspektiven berücksichtigt.
- Arbeit zitieren
- Dennis Krause (Autor:in), 2017, Entwicklung eines Anforderungskataloges für die Gestaltung und Verwendung von Kennzahlen und Kennzahlensystemen der Intralogistik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/371264