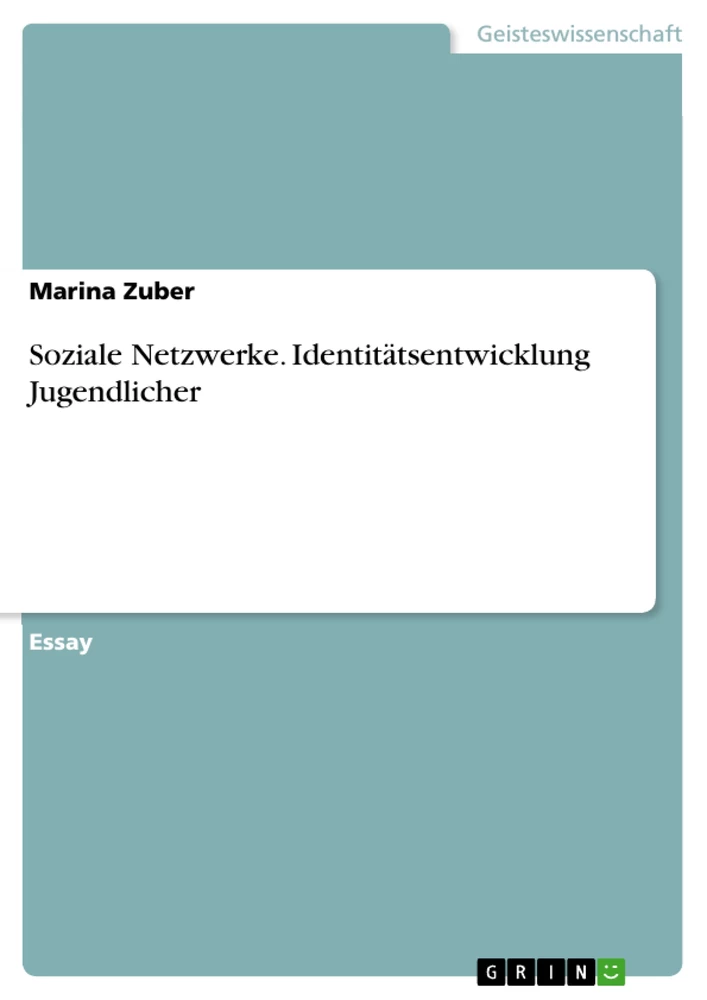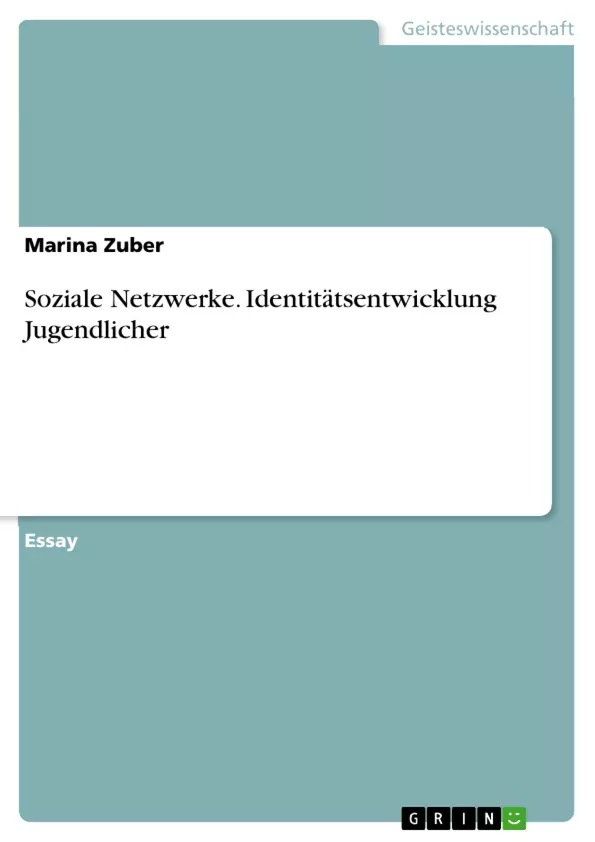Die Nutzung Sozialer Netzwerke bildet in der heutigen Gesellschaft einen zentralen Aspekt, insbesondere für die Jugendlichen. Das Einstiegsalter der medialen Nutzer liegt bei 13 Jahren oder jünger. Soziale Netzwerke als Internetmedium und somit unter anderem auch „Facebook“ und „Instagram“ sind zwei der bekanntesten Netzwerke der heutigen Zeit. Kaum eine andere Errungenschaft der modernen Technik hat das Leben von Kindern und Jugendlichen so geprägt und verändert, wie die Sozialen Netzwerke.
In diesem Essay möchte ich speziell auf das Netzwerk Facebook eingehen, welches den Alltag vieler Jugendlicher nahezu komplett bestimmt. Die Eltern bekommen davon häufig nichts oder nur einen sehr geringen Anteil mit, ob Verabredungen zum Fortgehen, dem Freund bzw. der Freundin, auf die man schon lange ein Auge geworfen hat, eine unmissverständliche Liebesnachricht posten oder das gemeinsame Lästern über unbeliebte Lehrer - fast jedes alltägliche Anliegen wird mittlerweile auch in den sozialen Netzwerken im Internet thematisiert und problematisch dargestellt. Dank moderner Smartphones können auch schon Kinder heute von überall und jederzeit ins Netz. Sie treffen dort in Chats oder Netzwerken ihre Klassenkameraden und Freunde. Doch wie wirken sich diese Veränderungen auf die Psyche bzw. auf die Entwicklung der Jugendlichen aus? Fachleute betonen, dass speziell das Tempo zugenommen hat, mit der Kinder und Jugendliche heute die Dinge in ihrem Alltag praktizieren.
Inhaltsverzeichnis
- Soziale Netzwerke und die Identitätsentwicklung Jugendlicher
- Identität: Ein Akt sozialer Konstruktion
- Eriksons Stufenmodell der Identitätsentwicklung
- Meads Theorie der Identität und symbolische Interaktion
- Medien und Identitätsbildung in der heutigen Gesellschaft
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Essay untersucht den Einfluss sozialer Netzwerke, insbesondere Facebook, auf die Identitätsentwicklung Jugendlicher. Ziel ist es, die Herausforderungen und Chancen aufzuzeigen, die sich aus der Nutzung dieser Medien ergeben. Der Essay beleuchtet die komplexen Zusammenhänge zwischen Online-Kommunikation, sozialer Interaktion und der Konstruktion des Selbst.
- Der Einfluss sozialer Netzwerke auf das Alltagsleben Jugendlicher
- Die Rolle sozialer Netzwerke bei der Identitätsfindung
- Herausforderungen und Risiken der Online-Kommunikation für Jugendliche
- Theorien der Identitätsentwicklung im Kontext digitaler Medien
- Die Bedeutung von elterlicher Begleitung und Kommunikation
Zusammenfassung der Kapitel
Soziale Netzwerke und die Identitätsentwicklung Jugendlicher: Dieser Abschnitt beschreibt die weitverbreitete Nutzung sozialer Netzwerke unter Jugendlichen und deren Einfluss auf den Alltag. Es wird die problembehaftete Darstellung alltäglicher Anliegen in sozialen Medien thematisiert, sowie die Schnelligkeit, mit der Beziehungen online eingegangen und beendet werden. Der fehlende Halt im Alltag und die fehlende Orientierung werden als Problemfelder hervorgehoben, ebenso wie die öffentliche Natur von Online-Profilen und die damit verbundenen Risiken wie Mobbing und Cybermobbing, die in Einzelfällen sogar zu Suizid führen können. Die Bedeutung des Gesprächs zwischen Eltern und Kindern wird betont, um die Herausforderungen der Online-Welt zu bewältigen.
Identität: Ein Akt sozialer Konstruktion: Dieser Teil des Essays befasst sich mit der Frage nach der Identität und deren Entstehung. Identität wird als ein Prozess der sozialen Konstruktion definiert, der die Passung zwischen dem subjektiven "Innen" und dem gesellschaftlichen "Außen" beschreibt. Das Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit und Würdigung wird als wichtiger Bestandteil der Identitätsbildung hervorgehoben. Identität wird als ein Kompromiss zwischen Eigensinn und Anpassung beschrieben.
Eriksons Stufenmodell der Identitätsentwicklung: Hier wird Eriksons 8-Stufen-Modell der psychosozialen Entwicklung vorgestellt, wobei der Fokus auf der 5. Stufe, der Adoleszenz, liegt. Das Ziel dieser Stufe ist die Erreichung einer Ich-Identität und die Vermeidung von Rollenverwirrung. Die Bedeutung von Riten und Übergängen im Jugendalter wird diskutiert, und es wird darauf hingewiesen, dass der Mangel an klaren Übergängen in der modernen Gesellschaft zu Unsicherheit und Krisen bei Jugendlichen führen kann.
Meads Theorie der Identität und symbolische Interaktion: Dieser Abschnitt präsentiert Meads Theorie der Identität, die auf der Interaktion zwischen Individuen basiert. Die Unterscheidung zwischen "Me" (die internalisierten Erwartungen anderer) und "I" (die spontane Reaktion des Individuums) wird erklärt. Der Prozess der Identitätsbildung wird als ein kontinuierliches Aushandeln zwischen "Me" und "I" beschrieben, das zur Bildung des "Self" führt. Die Bedeutung der Kommunikation und die Herausforderungen der rasanten Entwicklung der Medien im Kontext der Identitätsbildung werden betont.
Schlüsselwörter
Soziale Netzwerke, Identitätsentwicklung, Jugendliche, Facebook, Online-Kommunikation, Identitätstheorien, Erikson, Mead, Mobbing, Cybermobbing, Medien, Digitalisierung, Globalisierung, Selbstbild, Rollenfindung
Häufig gestellte Fragen zum Essay: Soziale Netzwerke und die Identitätsentwicklung Jugendlicher
Was ist der Hauptfokus dieses Essays?
Der Essay untersucht den Einfluss sozialer Netzwerke, insbesondere Facebook, auf die Identitätsentwicklung Jugendlicher. Er beleuchtet die Herausforderungen und Chancen, die sich aus der Nutzung dieser Medien ergeben, und die komplexen Zusammenhänge zwischen Online-Kommunikation, sozialer Interaktion und der Konstruktion des Selbst.
Welche Themen werden im Essay behandelt?
Der Essay behandelt die weitverbreitete Nutzung sozialer Netzwerke unter Jugendlichen und deren Einfluss auf den Alltag. Er thematisiert die problembehaftete Darstellung alltäglicher Anliegen in sozialen Medien, die Schnelligkeit von Online-Beziehungen, den fehlenden Halt im Alltag und die fehlende Orientierung. Weitere Themen sind die öffentliche Natur von Online-Profilen und die damit verbundenen Risiken wie Mobbing und Cybermobbing, verschiedene Identitätstheorien (Erikson, Mead), die Bedeutung von elterlicher Begleitung und Kommunikation sowie die Rolle sozialer Netzwerke bei der Identitätsfindung.
Welche Identitätstheorien werden im Essay vorgestellt?
Der Essay präsentiert Eriksons 8-Stufen-Modell der psychosozialen Entwicklung mit Fokus auf die Adoleszenz und die Bedeutung von Ich-Identität und Rollenfindung. Zusätzlich wird Meads Theorie der Identität und symbolischen Interaktion erläutert, die die Interaktion zwischen Individuen, die Unterscheidung zwischen "Me" und "I" und den Prozess der Identitätsbildung als kontinuierliches Aushandeln beschreibt.
Welche Herausforderungen und Risiken der Online-Kommunikation werden angesprochen?
Der Essay hebt die Herausforderungen hervor, die sich aus der öffentlichen Natur von Online-Profilen ergeben, wie Mobbing und Cybermobbing, die in Einzelfällen sogar zu Suizid führen können. Die problembehaftete Darstellung alltäglicher Anliegen in sozialen Medien, die Schnelligkeit von Online-Beziehungen und der fehlende Halt im Alltag werden als weitere Risiken genannt.
Welche Rolle spielt die elterliche Begleitung?
Der Essay betont die Bedeutung des Gesprächs zwischen Eltern und Kindern, um die Herausforderungen der Online-Welt zu bewältigen und die Jugendlichen bei der Identitätsfindung zu unterstützen.
Wie wird Identität im Essay definiert?
Identität wird als ein Prozess der sozialen Konstruktion definiert, der die Passung zwischen dem subjektiven "Innen" und dem gesellschaftlichen "Außen" beschreibt. Das Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit und Würdigung wird als wichtiger Bestandteil der Identitätsbildung hervorgehoben. Identität wird als ein Kompromiss zwischen Eigensinn und Anpassung beschrieben.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Essay?
Schlüsselwörter sind: Soziale Netzwerke, Identitätsentwicklung, Jugendliche, Facebook, Online-Kommunikation, Identitätstheorien, Erikson, Mead, Mobbing, Cybermobbing, Medien, Digitalisierung, Globalisierung, Selbstbild, Rollenfindung.
- Quote paper
- Marina Zuber (Author), 2017, Soziale Netzwerke. Identitätsentwicklung Jugendlicher, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/371339