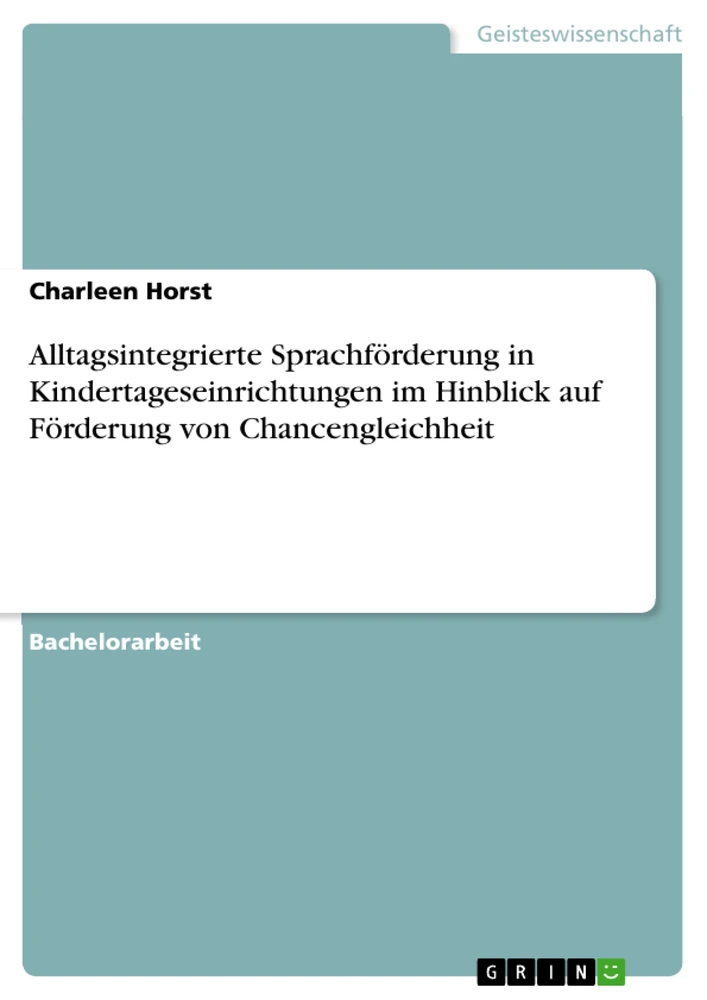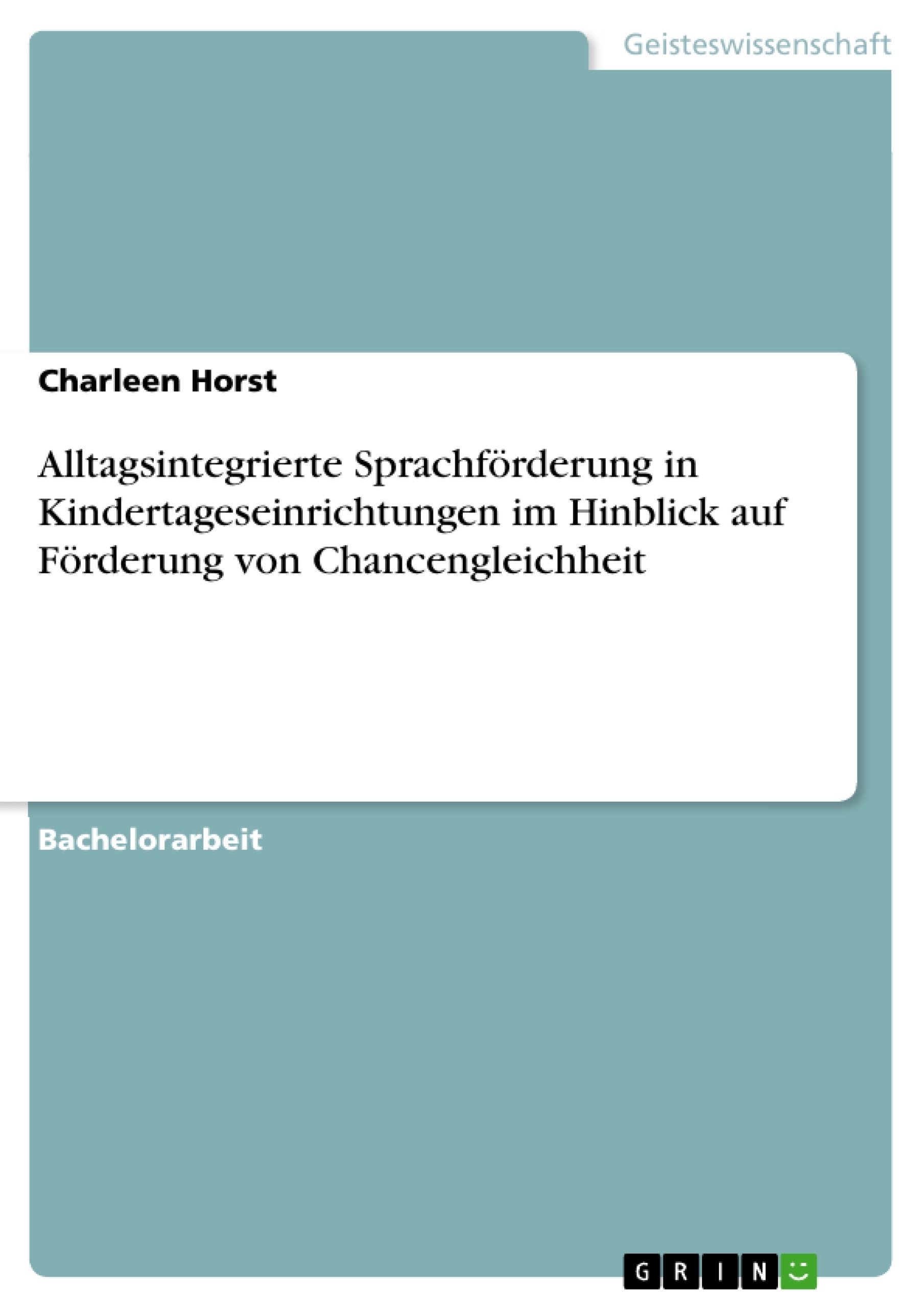In dieser wissenschaftlichen Arbeit soll dem auf den Grund gegangen werden: Kann für Kinder mit Migrationshintergrund und/oder aus sozial schwachen Familienverhältnissen durch eine Methode wie die alltagsintegrierte Sprachförderung Chancengleichheiten hergestellt werden?
Durch die verschiedenen nationalen und internationalen Vergleichsstudien zu Schulleistungen, Leseleistungen und vielem mehr wurden in Deutschland immer wieder öffentliche Diskussionen entfacht. Die Ergebnisse waren mehr als unbefriedigend und ließen die zuständigen bildungspolitischen Stellen sowie Forschungseinrichtungen des gesamten Landes nach Möglichkeiten zur Verbesserung unseres Bildungssystems suchen. Als mögliche Lösung wurde nun der frühkindliche institutionelle Bildungssektor verstärkt in den Blick genommen. Mit vielen Maßnahmen und Bemühungen sollte diese ungleiche Verteilung an Bildungsgütern und Chancen beseitigt werden.
Besonders die Tatsache, dass Kinder mit einem Migrationshintergrund zum Schuleintritt häufig gar nicht oder nur sehr schlecht die deutsche Sprache beherrschen, lässt die Politiker hoffen, dass sich früh einschleichende Chancenminderungen auf dem Bildungs- und Arbeitsmarkt verringern oder gar ganz vermieden werden können, wenn diese Kinder ihre Schullaufbahn mit gleichen Voraussetzungen beginnen wie Kinder deutscher Herkunft beginnen. Aufgrund dessen nehmen Sprachförderprogramme einen immer größeren Stellenwert in deutschen Kindertageseinrichtungen ein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Frühkindliche institutionelle Bildung, Erziehung und Betreuung
- Politische Interessen an Kindertageseinrichtungen
- Gesetzesperspektiven
- (Sprach-)Bildung in der frühen Kindheit
- Bildung in der frühen Kindheit
- Grundlagen der sprachlichen Entwicklung in der Kindheit
- Varianten des (Mehr-)Spracherwerbs
- Erwerbsschritte und Einflussfaktoren auf den Zweitspracherwerb
- Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen – Gründe, Wege, Fakten
- Alltagsintegrierte Sprachförderung
- Evaluationsstudie zur Sprachförderung im Elementarbereich
- Praktische Umsetzung und Verständnis alltagsintegrierter Sprachförderung
- Vorgehensweise und die zentralen Ergebnisse im Überblick
- (Außer-)familiäre Einflüsse auf die kindliche Entwicklung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Wirksamkeit alltagsintegrierter Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen zur Herstellung von Chancengleichheit für Kinder mit Migrationshintergrund und/oder aus sozial schwachen Familienverhältnissen. Die Arbeit analysiert den politischen und gesetzlichen Rahmen, die Grundlagen der sprachlichen Entwicklung im Kindesalter und die Bedeutung von Sprachförderung in der frühkindlichen Bildung.
- Politische und rechtliche Rahmenbedingungen der frühkindlichen Bildung in Deutschland
- Grundlagen der sprachlichen Entwicklung und des Mehrsprachenerwerbs bei Kindern
- Konzept und praktische Umsetzung alltagsintegrierter Sprachförderung
- Auswertung einer Evaluationsstudie zur Wirksamkeit von Sprachförderprogrammen
- Einfluss familiärer und außerfamiliärer Faktoren auf die kindliche Entwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Chancengleichheit im deutschen Bildungssystem ein und stellt die Forschungsfrage nach der Wirksamkeit alltagsintegrierter Sprachförderung für Kinder mit Migrationshintergrund und/oder aus sozial schwachen Familien. Sie betont die Bedeutung frühkindlicher Bildung und die Notwendigkeit von Sprachförderungsprogrammen zur Kompensation von Benachteiligungen. Die Arbeit skizziert den Aufbau und die Methodik der Untersuchung.
Frühkindliche institutionelle Bildung, Erziehung und Betreuung: Dieses Kapitel beleuchtet den politischen und gesetzlichen Kontext der frühkindlichen Bildung in Deutschland. Es analysiert das steigende politische Interesse an Kindertageseinrichtungen und die damit verbundenen gesetzlichen Rahmenbedingungen. Der Fokus liegt auf der rechtlichen Verankerung und Absicherung kindlicher Bildung sowie der Bedeutung von Kindertageseinrichtungen als Orte der Bildung und Betreuung.
(Sprach-)Bildung in der frühen Kindheit: Dieses Kapitel befasst sich mit den Grundlagen der sprachlichen Entwicklung im Kindesalter. Es erläutert das Verständnis von früher Bildung in der Pädagogik und die zentrale Rolle der Sprachbildung innerhalb dieses Kontexts. Es werden verschiedene Varianten des (Mehr-)Spracherwerbs diskutiert und die Einflussfaktoren auf die sprachliche Entwicklung, insbesondere den Zweitspracherwerb, analysiert. Das Kapitel liefert somit ein theoretisches Fundament für das Verständnis der Herausforderungen im Bereich der Sprachförderung.
Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen – Gründe, Wege, Fakten: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Bedeutung und die Methoden der Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen. Es erklärt das Konzept der alltagsintegrierten Sprachförderung und deren Vorteile im Vergleich zu anderen Fördermethoden. Ein wichtiger Bestandteil dieses Kapitels ist die detaillierte Beschreibung und Auswertung einer Evaluationsstudie zur Wirksamkeit von Sprachförderprogrammen im Elementarbereich. Die Ergebnisse der Studie werden kritisch beleuchtet und in den Kontext der bisherigen Forschung eingeordnet. Darüber hinaus werden (außer-)familiäre Einflüsse auf die kindliche Entwicklung diskutiert.
Schlüsselwörter
Chancengleichheit, Alltagsintegrierte Sprachförderung, Kindertageseinrichtungen, Sprachentwicklung, Mehrsprachigkeit, Migrationshintergrund, frühkindliche Bildung, Evaluationsstudie, soziale Benachteiligung, Bildungsgerechtigkeit.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Alltagsintegrierte Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht die Wirksamkeit alltagsintegrierter Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen zur Herstellung von Chancengleichheit für Kinder mit Migrationshintergrund und/oder aus sozial schwachen Familienverhältnissen. Sie analysiert den politischen und gesetzlichen Rahmen, die Grundlagen der sprachlichen Entwicklung im Kindesalter und die Bedeutung von Sprachförderung in der frühkindlichen Bildung.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Politische und rechtliche Rahmenbedingungen der frühkindlichen Bildung in Deutschland; Grundlagen der sprachlichen Entwicklung und des Mehrsprachenerwerbs bei Kindern; Konzept und praktische Umsetzung alltagsintegrierter Sprachförderung; Auswertung einer Evaluationsstudie zur Wirksamkeit von Sprachförderprogrammen; Einfluss familiärer und außerfamiliärer Faktoren auf die kindliche Entwicklung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, die Kapitel „Frühkindliche institutionelle Bildung, Erziehung und Betreuung“, „(Sprach-)Bildung in der frühen Kindheit“, „Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen – Gründe, Wege, Fakten“ und ein Fazit. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Forschungsfrage.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung führt in das Thema der Chancengleichheit im deutschen Bildungssystem ein und stellt die Forschungsfrage nach der Wirksamkeit alltagsintegrierter Sprachförderung für Kinder mit Migrationshintergrund und/oder aus sozial schwachen Familien. Sie betont die Bedeutung frühkindlicher Bildung und die Notwendigkeit von Sprachförderungsprogrammen zur Kompensation von Benachteiligungen. Der Aufbau und die Methodik der Untersuchung werden skizziert.
Worauf konzentriert sich das Kapitel „Frühkindliche institutionelle Bildung, Erziehung und Betreuung“?
Dieses Kapitel beleuchtet den politischen und gesetzlichen Kontext der frühkindlichen Bildung in Deutschland. Es analysiert das steigende politische Interesse an Kindertageseinrichtungen und die damit verbundenen gesetzlichen Rahmenbedingungen. Der Fokus liegt auf der rechtlichen Verankerung und Absicherung kindlicher Bildung sowie der Bedeutung von Kindertageseinrichtungen als Orte der Bildung und Betreuung.
Was sind die Inhalte des Kapitels „(Sprach-)Bildung in der frühen Kindheit“?
Dieses Kapitel befasst sich mit den Grundlagen der sprachlichen Entwicklung im Kindesalter. Es erläutert das Verständnis von früher Bildung in der Pädagogik und die zentrale Rolle der Sprachbildung. Es werden verschiedene Varianten des (Mehr-)Spracherwerbs diskutiert und die Einflussfaktoren auf die sprachliche Entwicklung, insbesondere den Zweitspracherwerb, analysiert. Das Kapitel liefert ein theoretisches Fundament für das Verständnis der Herausforderungen im Bereich der Sprachförderung.
Was wird im Kapitel „Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen – Gründe, Wege, Fakten“ untersucht?
Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Bedeutung und die Methoden der Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen. Es erklärt das Konzept der alltagsintegrierten Sprachförderung und deren Vorteile. Ein wichtiger Bestandteil ist die detaillierte Beschreibung und Auswertung einer Evaluationsstudie zur Wirksamkeit von Sprachförderprogrammen im Elementarbereich. Die Ergebnisse werden kritisch beleuchtet und in den Kontext der bisherigen Forschung eingeordnet. (Außer-)familiäre Einflüsse auf die kindliche Entwicklung werden diskutiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Chancengleichheit, Alltagsintegrierte Sprachförderung, Kindertageseinrichtungen, Sprachentwicklung, Mehrsprachigkeit, Migrationshintergrund, frühkindliche Bildung, Evaluationsstudie, soziale Benachteiligung, Bildungsgerechtigkeit.
- Quote paper
- Charleen Horst (Author), 2016, Alltagsintegrierte Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen im Hinblick auf Förderung von Chancengleichheit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/371379