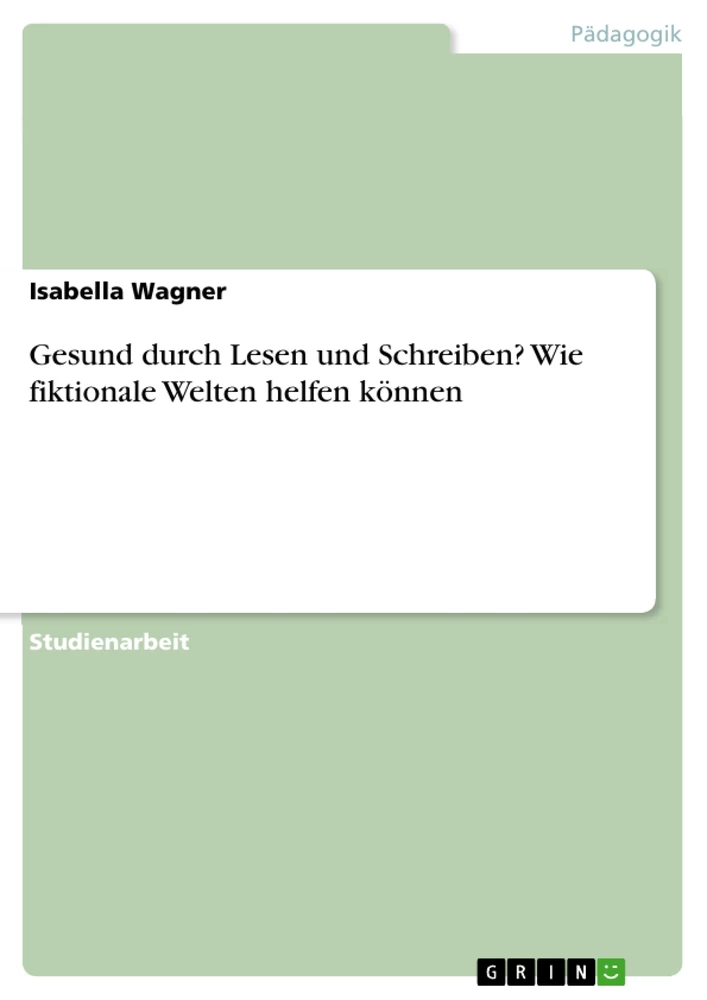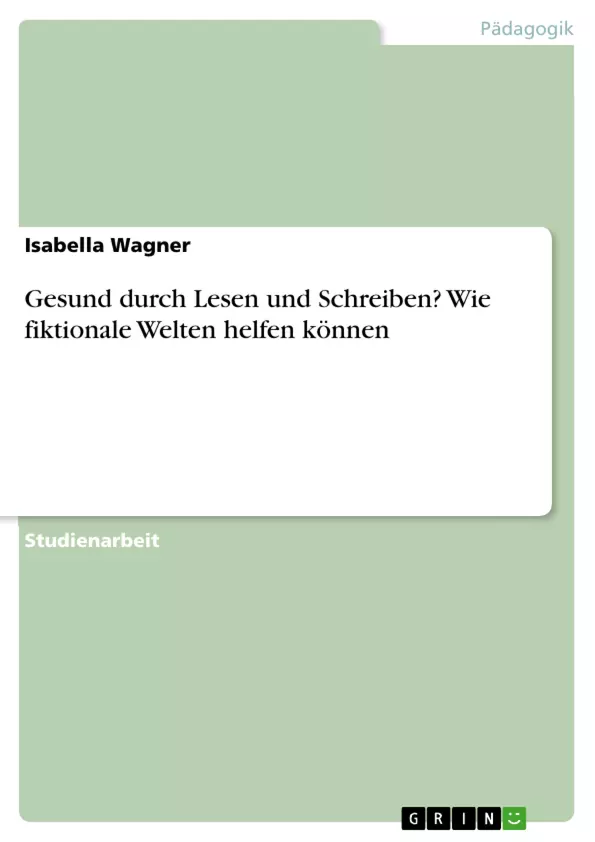Ziel dieser Arbeit ist es, darzustellen, wie fiktionale Welten (bei produktiver oder rezeptiver Auseinandersetzung) heilen können und welche Rolle die mit ihnen in Zusammenhang stehenden Emotionen dabei spielen. Die Erkenntnisse werden exemplarisch anhand der therapeutischen Arbeit mit drogengefährdeten Jugendlichen und dem Grimm’schen Märchen „Frau Trude“ praktisch dargestellt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Was sind Poesie- und Bibliotherapie?
- 2.1. Poesietherapie
- 2.2. Bibliotherapie
- 3. Wirkungsmechanismen
- 3.1. Fiktionalität
- 3.2. Emotionalität
- 3.3. Gewinnung von Sinn
- 4. Bibliotherapie: Märchenarbeit mit drogengefährdeten Jugendlichen
- 4.1. Vorüberlegungen
- 4.2. Therapeutische Märchenarbeit
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die heilsamen Möglichkeiten fiktionaler Welten in Bezug auf die produktive und rezeptive Auseinandersetzung mit Literatur. Sie beleuchtet die Rolle von Emotionen in diesem Kontext und analysiert die Wirkungsmechanismen von Poesietherapie und Bibliotherapie. Ziel ist es, die therapeutische Wirksamkeit dieser Verfahren darzustellen und einen Einblick in die praktische Anwendung zu geben.
- Definition und Abgrenzung von Poesietherapie und Bibliotherapie
- Analyse der Wirkungsmechanismen: Fiktionalität, Emotionalität und Gewinnung von Sinn
- Exemplarische Darstellung der therapeutischen Arbeit mit drogengefährdeten Jugendlichen anhand des Grimm'schen Märchens "Frau Trude"
- Zusammenfassende Darstellung der Analyseergebnisse und Ausblick auf zukünftige Forschungsfelder
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein, indem sie die kontroverse Debatte über die Wirkung literarischer Texte auf Leser*innen beleuchtet. Dabei wird die Frage aufgeworfen, ob es sich bei durch Literatur ausgelösten Emotionen um "echte" oder "Als-ob-Emotionen" handelt. Die Bedeutung von Poesietherapie und Bibliotherapie als therapeutische Verfahren wird hervorgehoben, insbesondere im Hinblick auf ihre Verbindung mit Leser*innen-Emotionen.
Kapitel 2 befasst sich mit den Begriffen der Poesietherapie und Bibliotherapie. Es werden die verschiedenen Definitionen in der Forschungsliteratur beleuchtet, die jeweiligen Methoden dargestellt und die Einordnung der Verfahren in den Bereich der expressiven Therapien erläutert.
Kapitel 3 widmet sich den Wirkungsmechanismen von Poesietherapie und Bibliotherapie. Hier werden die drei zentralen Aspekte Fiktionalität, Emotionalität und Gewinnung von Sinn detailliert analysiert.
Kapitel 4 zeigt die praktische Anwendung der Bibliotherapie am Beispiel der Arbeit mit drogengefährdeten Jugendlichen. Die therapeutische Märchenarbeit mit dem Grimm'schen Märchen "Frau Trude" wird vorgestellt und die Bedeutung des Märchens in diesem Kontext beleuchtet.
Schlüsselwörter
Poesietherapie, Bibliotherapie, Fiktionalität, Emotionalität, Gewinnung von Sinn, therapeutische Märchenarbeit, drogengefährdete Jugendliche, expressive Therapien.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Poesietherapie und Bibliotherapie?
Poesietherapie konzentriert sich auf die produktive Auseinandersetzung (Schreiben), während Bibliotherapie die rezeptive Auseinandersetzung (Lesen) mit Literatur zu therapeutischen Zwecken nutzt.
Wie können fiktionale Welten zur Heilung beitragen?
Durch Wirkungsmechanismen wie Fiktionalität, Emotionalität und die Gewinnung von Sinn helfen diese Therapien, eigene Gefühle zu verarbeiten und neue Perspektiven auf das Leben zu gewinnen.
Warum wurde das Märchen „Frau Trude“ für drogengefährdete Jugendliche gewählt?
Das Märchen dient als exemplarisches Beispiel für die therapeutische Märchenarbeit, um tiefsitzende Ängste oder Konflikte symbolisch anzusprechen und zu bearbeiten.
Sind die durch Literatur ausgelösten Emotionen „echt“?
Die Einleitung der Arbeit beleuchtet die Debatte, ob es sich um reale Emotionen oder „Als-ob-Emotionen“ handelt und wie diese therapeutisch genutzt werden können.
Zu welcher Gruppe von Therapien gehören diese Verfahren?
Poesie- und Bibliotherapie werden in den Bereich der expressiven Therapien eingeordnet.
- Citar trabajo
- Isabella Wagner (Autor), 2016, Gesund durch Lesen und Schreiben? Wie fiktionale Welten helfen können, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/371428