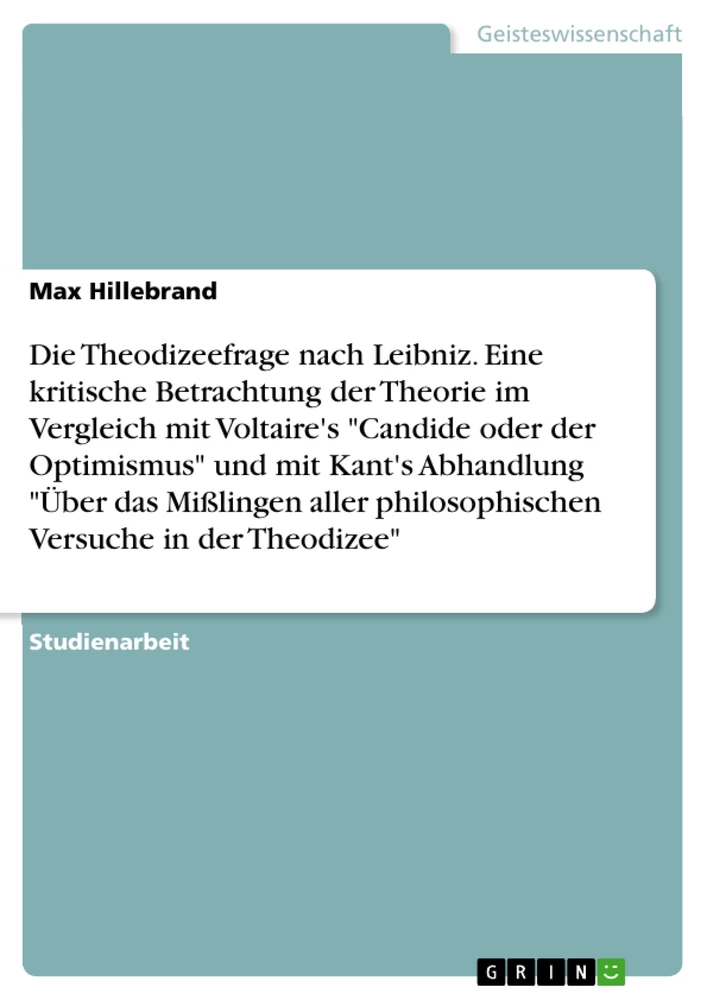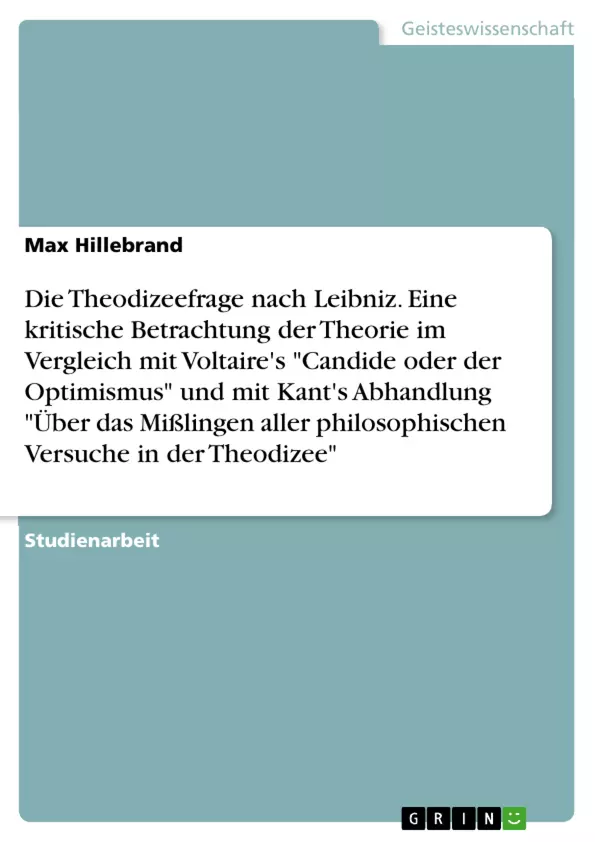Diese Hausarbeit untersucht die Theodizee von Gottfried Wilhelm Leibniz, als eines der bedeutendsten Werke der Philosophie, unter den Fragestellungen: „Was ist die Theodizeefrage? Haben die Ansichten von Leibniz bestand? Kann Leibniz die Frage letztendlich lösen?“. Aufgrund der umfassenden Arbeit von Leibniz ist es kaum möglich, alle Argumente wiederzugeben und zu analysieren. Folglich beschränkt sich der Autor auf die grundlegende Argumentation, die zu dem Beweis führt, dass unsere Welt die beste aller darstellt. Hierzu ist es notwendig, die Einteilung der Übel ebenfalls näher zu betrachten.
Voltaires „Candide“ und Immanuel Kants Abhandlung „Über das Mißlingen aller philosophischen Versuche in der Theodicee (1791)”, geben anschließend einen kritischen Blick auf die zuvor erarbeiteten Argumente. Dessen ungeachtet wird der Autor zunächst systematisch einleiten und mit einem kurzen Überblick über die Geschichte der Theodizeefrage bis in die Zeit der Aufklärung beginnen. Es folgt der Hauptteil mit der eigentlichen Analyse der Argumente. Letztendlich kommt der Schluss, mit der Funktion einer Zusammenfassung und Beantwortung der bereits erwähnten Fragestellungen.
Nicht aktueller könnte die Theodizeefrage sein. Terroranschläge und Kriege beherrschen noch immer den Nahen Osten. Seit Charlie Hebdo’ rückt Europa immer weiter in das Fadenkreuz von Terroristen und IS-Anhängern. Passend dazu veröffentlichte die Süddeutsche Zeitung eine erschreckende Chronologie: „2016 - Jahr des Terrors für Deutschland“.Insgesamt neun Ereignisse, die das Jahr geprägt haben, finden ihre Darstellung. In Anbetracht der Ereignisse scheint der Glaube an einen Gott, der uns vor dem Übel und Leid der Welt zu retten versucht, zu sinken. Trotz dessen entgegnete uns bereits Leibniz 1710, dass wir in der besten aller möglichen Welten’ leben. Aber wie ist diese Aussage vereinbar mit den Übeln der Welt? Konnte Gott keine bessere Welt schaffen?
Einen möglichen Erklärungsversuch dokumentierte Gottfried Wilhelm Leibniz in seinem Buch „Essais de Théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine du mal“, kurz Théodicée (später Theodizee). Er prägte damit, die religiösen und philosophischen Überlegungen des 18. Jahrhunderts und setzte die seit der Antike diskutierte Frage nach der Rechtfertigung Gottes fort und verlieh der Frage neuen Gehalt, in dem er Gott vor dem „Gerichtshof der Vernunft“ anklagte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Geschichtliche Einführung
- Leibniz: Leben in der Bestmöglichen Welt
- Die Übel der Welt
- Kritik: Candide oder der Optimismus
- Kant und das Mißlingen aller philosophischen Versuche in der Theodizee
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit der Theodizeefrage, also der Frage nach der Rechtfertigung Gottes angesichts des Übels in der Welt. Er analysiert die Argumente von Gottfried Wilhelm Leibniz, der in seinem Werk "Théodicée" behauptet, dass wir in der "besten aller möglichen Welten" leben. Der Text untersucht, ob diese Aussage mit den Übeln der Welt vereinbar ist und wie Leibniz die Frage nach dem Einklang von Gottes Allmacht und der Existenz von Übel beantwortet.
- Die historische Entwicklung der Theodizeefrage
- Leibniz' Argumentation für die beste aller möglichen Welten
- Kritik an Leibniz' Theodizee durch Voltaire und Kant
- Die Rolle von Vernunft und Glaube in der Theodizeefrage
- Die Bedeutung des Begriffs "Übel" im Kontext der Theodizee
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Theodizeefrage vor und erläutert ihre Aktualität im Kontext aktueller Ereignisse. Sie führt Leibniz' Konzept der "besten aller möglichen Welten" ein und skizziert den Fokus des Textes auf die Analyse von Leibniz' Argumenten.
- Geschichtliche Einführung: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die historische Entwicklung der Theodizeefrage, beginnend mit der Antike und den Philosophen, die sich mit der Rechtfertigung Gottes auseinandersetzten. Es beleuchtet unterschiedliche Ansätze zur Erklärung des Übels in der Welt und zeigt die Veränderung des Themas im Kontext der Aufklärung.
- Leibniz: Leben in der Bestmöglichen Welt: Dieses Kapitel behandelt Leibniz' Argumentation für die beste aller möglichen Welten. Es analysiert seine Annahmen über Gottes Existenz und Attribute und erläutert seine These, dass die Welt, obwohl sie Übel enthält, die bestmögliche Welt ist, die Gott hätte schaffen können.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter des Textes sind Theodizee, Rechtfertigung Gottes, Übel, bestmögliche Welt, Leibniz, Voltaire, Kant, Vernunft, Glaube, Allmacht, Allwissenheit, Allgüte, Freiheit, Gottesbeweise. Die Themenschwerpunkte liegen auf der philosophischen und religiösen Auseinandersetzung mit dem Problem des Übels in der Welt, der Analyse von Leibniz' Argumentation für die beste aller möglichen Welten und der kritischen Betrachtung dieser Argumentation durch Voltaire und Kant.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter der Theodizeefrage?
Die Theodizeefrage befasst sich mit der Rechtfertigung Gottes angesichts des Übels und Leids in der Welt.
Was ist Leibniz' zentrale These zur Welt?
Leibniz behauptet, dass wir in der „besten aller möglichen Welten“ leben, die Gott aufgrund seiner Allmacht und Güte geschaffen hat.
Wie kritisiert Voltaire die Theorie von Leibniz?
In seinem Werk „Candide“ verspottet Voltaire den Optimismus von Leibniz und zeigt durch die Leiden der Protagonisten die Unhaltbarkeit der These auf.
Welche Position vertritt Immanuel Kant zur Theodizee?
Kant argumentiert in seiner Abhandlung, dass alle philosophischen Versuche, die Theodizee rational zu lösen, zum Scheitern verurteilt sind.
Warum ist die Theodizeefrage heute noch aktuell?
Angesichts von Kriegen und Terrorismus stellt sich für viele Menschen weiterhin die Frage, wie ein gütiger Gott solches Leid zulassen kann.
- Quote paper
- Max Hillebrand (Author), 2016, Die Theodizeefrage nach Leibniz. Eine kritische Betrachtung der Theorie im Vergleich mit Voltaire's "Candide oder der Optimismus" und mit Kant's Abhandlung "Über das Mißlingen aller philosophischen Versuche in der Theodizee", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/371460