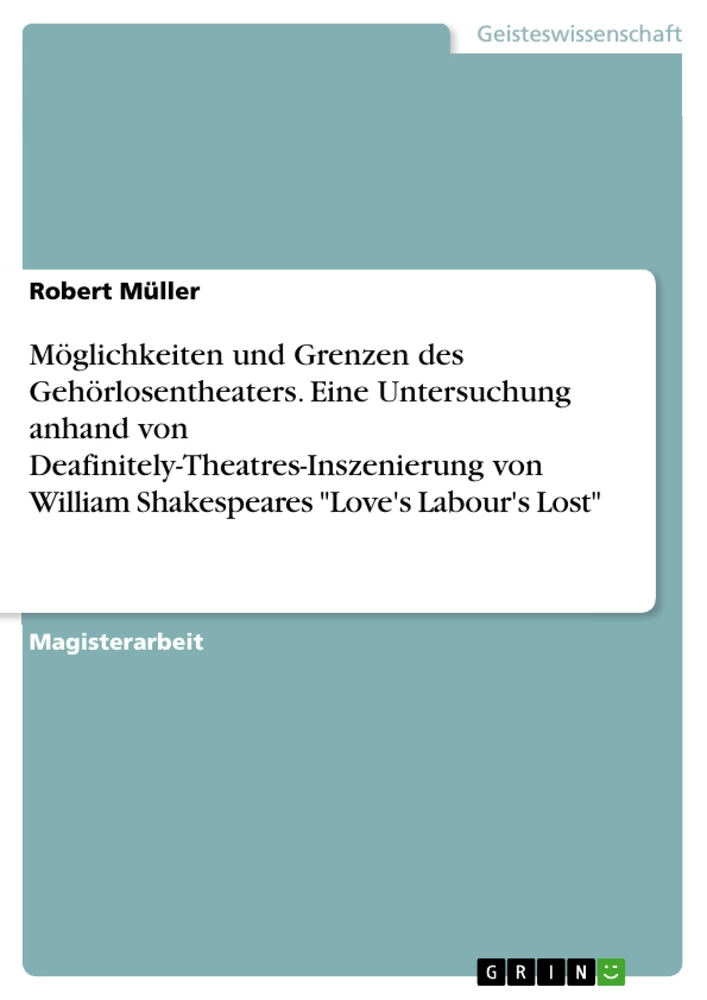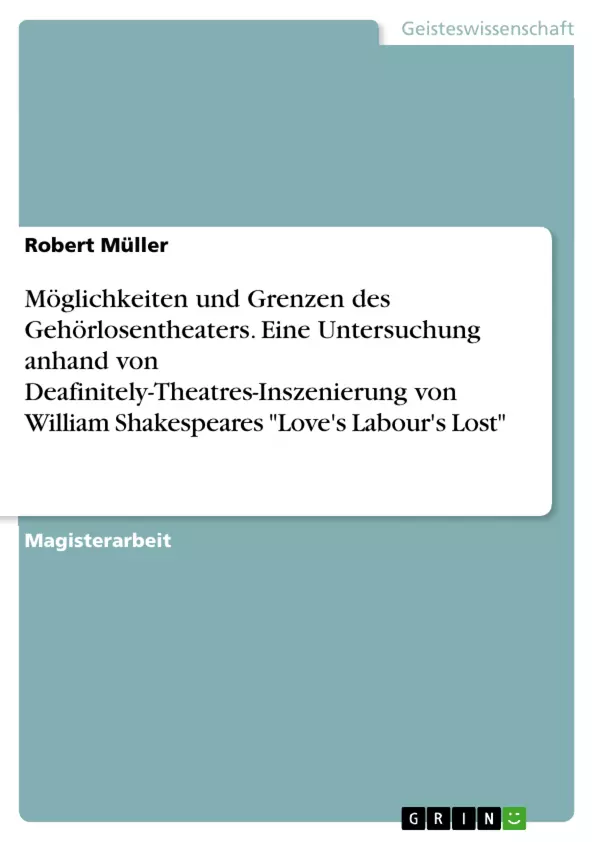An einem Dienstagnachmittag im Mai 2012 scheint die Sonne ins Rund des Globe Theatre in Londons Bankside. Im Yard stehen die Zuschauer Schulter an Schulter, die Galerien sind voll besetzt. Das Publikum fiebert mit den Figuren auf der Bühne mit, lacht über ihre amourösen Verirrungen und Verwirrungen und folgt ihnen auf eine zweistündige Reise in die Welt von William Shakespeare. Doch kein einziges Wort des berühmten Barden verlässt je die Lippen der Akteure. Wie kann das sein? Wo ist die bildreiche, wortgewaltige, blumige Sprache dieses vielleicht größten Dramatikers, den die Welt je gesehen hat, geblieben?
Auf dem Spielplan steht "Love's Labour's Lost" in einer Inszenierung von Deafinitely Theatre – einem tauben Ensemble unter Leitung einer gehörlosen Regisseurin. Die Theatergruppe hat es sich zum Ziel gesetzt, erstmals ein Werk William Shakespeares ausschließlich in British Sign Language (BSL) – ohne auch nur ein einziges gesprochenes Wort – auf die Bühne zu bringen.
Es gilt, herauszufinden, welche Signifikanz ein "Shakespeare ohne Worte" hat, welche Bedeutung einer Shakespeare-Inszenierung im rein visuell-räumlichen Medium der Gebärdensprache hinsichtlich der Verhältnisse von gehörloser und hörender Kultur beizumessen ist. Die Kultur und das kreative Schaffen von Gehörlosen hat in der Theaterwissenschaft – vor allem im deutschsprachigen Raum – bisher nur sehr wenig bis gar keine Aufmerksamkeit gefunden, wobei sich hier ein ungeahnt weites Feld an Forschungsgebieten eröffnet: angefangen von der Infragestellung des traditionellen Textbegriffs und des Brechens mit herkömmlichen Sehgewohnheiten über den Einsatz des Körpers als Medium zur Bedeutungsproduktion bis hin zum Verständnis von Kultur an sich.
Ausgehend von einer Annäherung an die Wesenszüge der Gehörlosengemeinschaft und die Charakteristika ihrer Kultur können die so gewonnenen Erkenntnisse in Relation zum künstlerischen Schaffen und zur kulturellen Praxis im Gehörlosentheater gesetzt werden, das an der Schnittstelle steht von ebenjenen selbsterschaffenen Konstrukten, auf denen unsere Welt basiert: "Eigenes vs. Fremdes", "Normal vs. Behindert".
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Abkürzungsverzeichnis
- 1. Ein Shakespeare ohne Worte
- 2. Die Konstruktion der Welt
- 2.1 Normalität versus Behinderung
- 2.2 Sprechen über das „Andere“ – das medizinische, soziale und kulturelle Modell
- 2.3 Der Versuch einer Deafinition
- 2.3.1 Medizinische Begriffsbestimmungen
- 2.3.2 Leben in der DEAF-WORLD: Die deaf community und die Deaf culture
- 2.4 Deaf versus disabled
- 3. Von der Unterdrückung einer Sprachgemeinschaft zum Ertönen der gar nicht so leisen Stimme der Gehörlosen
- 3.1 Falsche Annahmen und ihre fatale Wirkung
- 3.2 Erste Erwähnungen
- 3.3 Von der „Entdeckung“ der Gehörlosigkeit bis hin zum Bestreben, sie auszumerzen
- 3.4 Schulen und deaf clubs im Zeichen des Oralismus
- 3.5 Die Katastrophe von Mailand
- 3.6 Die Auswirkungen von Mailand
- 3.7 Der Wendepunkt: Die Erforschung der Gebärdensprache
- 3.7.1 Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Gebärden- und Lautsprache
- 3.7.2 Die Zusammensetzung von Gebärden und die Produktion von Sinn
- 3.7.3 Die Vorwürfe der bloßen Pantomime und Ikonizität
- 3.8 Das Entstehen eines neues Selbstbewusstseins: Die Gehörlosen verschaffen sich Gehör
- 3.9 Die gegenwärtige Situation der britischen deaf community
- 4. Gehörlose und die Bretter, die die Welt bedeuten
- 4.1 Theater und der Status Quo einer Gesellschaft
- 4.2 Von den Anfängen bis zu Children of a Lesser God
- 4.3 Die Politisierung des Theaters und die Instrumentalisierung von Performance für die Zwecke der deaf community
- 4.4 Für Gehörlose zugängliche Formen von Theater und ihre wesentlichen Merkmale
- 4.4.1 Gebärden als Teil der Inszenierung: theatre for the deaf & theatre of the deaf
- 4.4.2 Gebärdensprache abseits der Bühne: sign language interpreted performances
- 4.5 Kritik an den von Hörenden dominierten Theaterformen und ihrer Zugänglichkeit
- 4.6 Die Erwartungen eines gehörlosen Publikums an ein gelungenes Theatererlebnis
- 4.6.1 Inszenatorische Aspekte
- 4.6.2 Administrative und organisatorische Aspekte
- 5. Das Jahr 2012 - der Durchbruch im Umgang mit Andersartigkeit?
- 5.1 London 2012 und die Paralympischen Spiele - die Hoffnungsträger
- 5.2 Shakespeare's Globe und Deafinitely Theatre – ein Meilenstein für die Gehörlosen in Großbritannien
- 6. Deafinitely Theatres Love's Labour's Lost
- 6.1 Die Bearbeitung von Shakespeares Original: der Spieltext
- 6.1.1 Die intralinguale Übersetzung
- 6.1.2 Anmerkungen im Nebentext
- 6.2 Die Umsetzung auf der Bühne von Shakespeare's Globe: die Inszenierung
- 6.2.1 Prozessorientierte Analyse
- 6.2.2 Produktorientierte Analyse
- 6.2.2.1 Musikalische Begleitung und Szenenzusammenfassungen
- 6.2.2.2 Nutzung des Bühnenraums
- 6.2.2.3 Spielweise des Ensembles
- 6.2.2.4 Interaktion, Dynamik und Wirkung
- 7. Der Beitrag von Deafinitely Theatres Inszenierung zur Annäherung von hörender und gehörloser Kultur
- 7.1 Die Verhandlung von Sprachskepsis im Stück und auf einer Metaebene
- 7.2 Der „fremde“ Shakespeare: Der Wert von Übersetzungen
- 7.3 Poesie für die Augen: Shakespeare „sehen“
- 7.4 Eine zwar gemeinsame, aber auch gleichwertige Theatererfahrung?
- 7.5 Die Einsicht in das „Fremde“: der Austausch zwischen den Kulturen
- 7.6 Die „Eroberung“ des Globe
- 8. Ein Blick nach Deutschland
- 8.1 Vom Zweiten Weltkrieg bis heute
- 8.2 Die „gehörlose“ Theater- und Kulturlandschaft
- 8.3 Missstände und Probleme
- 8.3.1 Fallbeispiel München
- 8.3.2 Die Situation auf dem Arbeitsmarkt
- 9. Die Kraft von Shakespeares unausgesprochenen Worten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Möglichkeiten und Grenzen des Gehörlosentheaters anhand von Deafinitely Theatres Inszenierung von William Shakespeares Love's Labour's Lost. Sie analysiert die spezifischen Herausforderungen, die sich aus der gehörlosen Perspektive ergeben, und beleuchtet die Inszenierung als einen Meilenstein in der Entwicklung des Gehörlosentheaters in Großbritannien.
- Die Konstruktion der Welt: Normalität versus Behinderung und das „Andere“
- Die deaf community und die Deaf culture: Sprache, Identität und Kultur
- Theater und der Status Quo einer Gesellschaft: Die Politisierung des Theaters und die Instrumentalisierung von Performance
- Für Gehörlose zugängliche Formen von Theater: Theatre for the Deaf & Theatre of the Deaf
- Shakespeare's Globe und Deafinitely Theatre: Ein Meilenstein für die Gehörlosen in Großbritannien
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Dieses Kapitel stellt das Thema des Buches vor und erläutert die Relevanz von Shakespeares Werken für das Gehörlosentheater.
- Kapitel 2: In diesem Kapitel werden verschiedene Perspektiven auf Normalität, Behinderung und das „Andere“ beleuchtet. Die deaf community und die Deaf culture sowie deren spezifische Merkmale und Herausforderungen werden erläutert.
- Kapitel 3: Dieses Kapitel zeichnet die Geschichte der Unterdrückung und Marginalisierung von Gehörlosen nach und beschreibt die Entwicklung der Gebärdensprache sowie das Entstehen eines neuen Selbstbewusstseins in der Gehörlosengemeinschaft.
- Kapitel 4: Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung des Theaters für die Gehörlosengemeinschaft und untersucht die Geschichte des Gehörlosentheaters. Verschiedene Formen von Theater für Gehörlose und deren Merkmale werden dargestellt.
- Kapitel 5: Dieses Kapitel untersucht die Paralympischen Spiele 2012 in London als einen Hoffnungsträger für die Inklusion von Menschen mit Behinderung. Deafinitely Theatre und deren Inszenierung von Shakespeares Love's Labour's Lost werden als ein Meilenstein für die Gehörlosen in Großbritannien dargestellt.
- Kapitel 6: Dieses Kapitel analysiert Deafinitely Theatres Inszenierung von Love's Labour's Lost sowohl in Bezug auf die Bearbeitung des Spieltextes als auch auf die Inszenierung selbst. Die Umsetzung der Inszenierung auf der Bühne von Shakespeare's Globe wird detailliert betrachtet.
- Kapitel 7: Dieses Kapitel beleuchtet den Beitrag von Deafinitely Theatres Inszenierung zur Annäherung von hörender und gehörloser Kultur. Die Verhandlung von Sprachskepsis, der Wert von Übersetzungen und die Bedeutung von visuellem Theater werden diskutiert.
- Kapitel 8: Dieses Kapitel wirft einen Blick auf die Situation des Gehörlosentheaters in Deutschland und zeigt die Herausforderungen und Missstände auf, denen die Gehörlosengemeinschaft in Deutschland gegenübersteht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Gehörlosentheater, Deaf culture, Gebärdensprache, Inklusion, Theater für Gehörlose, Deafinitely Theatre, Love's Labour's Lost, Shakespeare, Übersetzung, Bühnenkunst und die Situation von Gehörlosen in Großbritannien und Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Kann man Shakespeare ohne gesprochene Worte aufführen?
Ja, die Untersuchung zeigt am Beispiel von "Love's Labour's Lost", wie das Deafinitely Theatre das Stück ausschließlich in Gebärdensprache (BSL) inszenierte.
Was ist der Unterschied zwischen "Theatre for the Deaf" und "Theatre of the Deaf"?
Die Arbeit unterscheidet zwischen Theaterformen, die für Gehörlose zugänglich gemacht werden, und solchen, die aus der Gehörlosenkultur selbst entstehen.
Welche Bedeutung hat die Gebärdensprache für die Inszenierung?
Die Gebärdensprache dient als visuell-räumliches Medium, das den traditionellen Textbegriff infrage stellt und den Körper als primäres Medium der Bedeutungsproduktion nutzt.
Wie ist die Situation des Gehörlosentheaters in Deutschland?
Die Arbeit zeigt auf, dass das Gehörlosentheater in Deutschland im Vergleich zu Großbritannien mit größeren strukturellen Problemen und mangelnder Aufmerksamkeit in der Wissenschaft kämpft.
Was war die "Katastrophe von Mailand" für die Gehörlosen?
Der Kongress von Mailand 1880 führte zum Verbot der Gebärdensprache im Unterricht, was weitreichende negative Folgen für die Bildung und Kultur von Gehörlosen hatte.
- Quote paper
- Robert Müller (Author), 2013, Möglichkeiten und Grenzen des Gehörlosentheaters. Eine Untersuchung anhand von Deafinitely-Theatres-Inszenierung von William Shakespeares "Love's Labour's Lost", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/371595