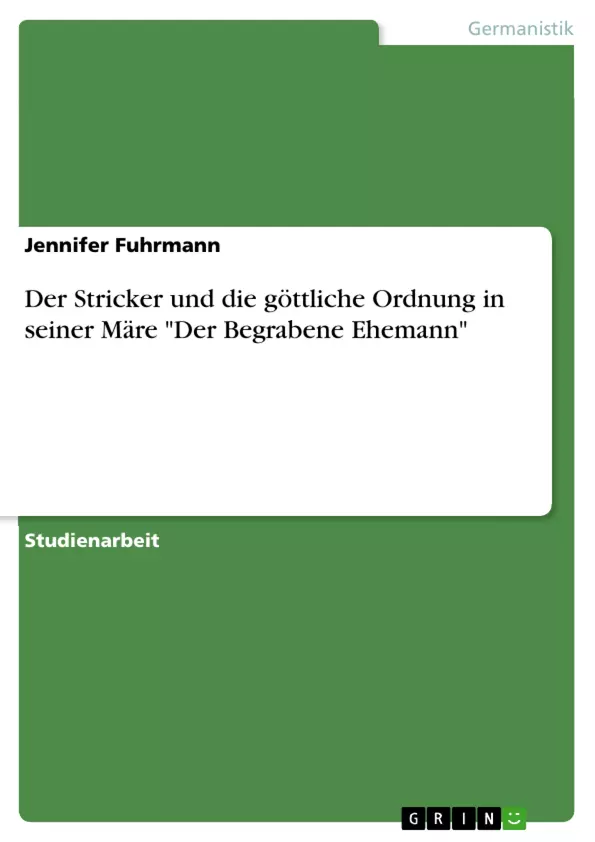Der Stricker zählt zu den bekanntesten Dichtern der Märendichtung. Seine Werke umfassen verschiedene Themenbereiche, von denen in dieser Seminararbeit aber nur ein Stück aus der Ehethematik behandelt wird. Diese Arbeit befasst sich mit der Märe "Der Begrabene Ehemann" vom Stricker.
An diesem Werk soll untersucht werden, wie mit dem göttlichen Prinzip der Ordnung umgegangen wird. Dieses Thema war zu Zeiten des Stricker im Alltag präsent und wurde daher auch von ihm aufgegriffen. Es soll untersucht werden, wie sich der Stricker mit der göttlichen Ordnung auseinandergesetzt hat und sie in seiner Märe thematisierte.
Für die Arbeit an diesem Thema konnten einige Forschungstexte zu Rate gezogen werden, wie „Die Ordnung, der Witz und das Chaos“ von Klaus Grubmüller, welcher sich besonders für das Gebiet der ordo1als dienlich erwies. Die Grundlage für die Arbeit am mittelhochdeutschen Text bildete das Buch „Verserzählungen“, welches von Hanns Fischer herausgegeben wurde.
Im Ersten Kapitel wird genauer auf den Stricker und seine Ansicht zur göttlichen Ordnung eingegangen. In Kapitel Zwei wird die Handlung der Märe bearbeitet und anschließend untersucht, wie es sich dort mit Ordnung verhält. Kapitel Drei bildet das Fazit, in dem vorangegangene Erkenntnisse noch einmal zusammengefügt und erläutert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Stricker
- Der Stricker und die göttliche Ordnung
- Der Begrabene Ehemann
- Ordnungsverstoß und Replik in Der Begrabene Ehemann.
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der Märe "Der Begrabene Ehemann" vom Stricker und untersucht, wie der Dichter mit dem göttlichen Prinzip der Ordnung umgeht. Dabei soll herausgearbeitet werden, wie der Stricker die göttliche Ordnung in seiner Märe thematisiert und welche Bedeutung sie in seiner Zeit hatte.
- Der Stricker als Begründer der deutschen Märendichtung
- Der Umgang mit dem göttlichen Ordnungsprinzip im Mittelalter
- Die Rolle der Ehe im mittelalterlichen Gesellschaftsbild
- Die Bedeutung der Märe "Der Begrabene Ehemann" für das Verständnis des Strickers
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt den Stricker als einen der bekanntesten Dichter der Märendichtung vor und führt in die Thematik der göttlichen Ordnung in "Der Begrabene Ehemann" ein. Sie erläutert die Bedeutung der Ordnung im Mittelalter und skizziert den Aufbau der Arbeit.
1. Der Stricker
Dieses Kapitel befasst sich mit dem Leben und Werk des Strickers, seiner Bedeutung für die Märendichtung und seiner Sicht auf die göttliche Ordnung. Es werden seine literarischen Merkmale, seine Bildung und sein Bezug zur Theologie hervorgehoben.
2. Der Begrabene Ehemann
In diesem Kapitel wird die Handlung der Märe "Der Begrabene Ehemann" zusammengefasst und untersucht, wie sich die göttliche Ordnung im Kontext der Handlung zeigt. Das Augenmerk liegt auf den Ordnungsverstößen und deren Folgen im Rahmen der Märe.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Märendichtung, den Stricker, die göttliche Ordnung, das Mittelalter, die Ehethematik, "Der Begrabene Ehemann", Ordnungsverstoß, Replik, Epimythion und die literarische Gattung der Märe.
Häufig gestellte Fragen
Wer war "Der Stricker"?
Der Stricker war ein bedeutender mittelhochdeutscher Dichter und gilt als Begründer der deutschen Märendichtung im 13. Jahrhundert.
Worum geht es in "Der Begrabene Ehemann"?
Diese Märe behandelt eine Ehethematik, in der durch List und Witz die gesellschaftliche und göttliche Ordnung auf die Probe gestellt wird.
Was bedeutete die "göttliche Ordnung" im Mittelalter?
Die "ordo" war das Prinzip, nach dem Gott jedem Menschen und Stand seinen festen Platz in der Welt zugewiesen hatte.
Wie thematisiert der Stricker Ordnungsverstöße?
Er nutzt oft komische Situationen, um moralische Lehren (Epimythion) zu vermitteln und die Folgen von Abweichungen von der Norm aufzuzeigen.
Welche Rolle spielt die Ehe in seinen Mären?
Die Ehe dient als Modell für die kleinste Zelle der gesellschaftlichen Ordnung, an der Konflikte zwischen Trieb, List und Moral exemplifiziert werden.
- Citation du texte
- Jennifer Fuhrmann (Auteur), 2017, Der Stricker und die göttliche Ordnung in seiner Märe "Der Begrabene Ehemann", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/371652