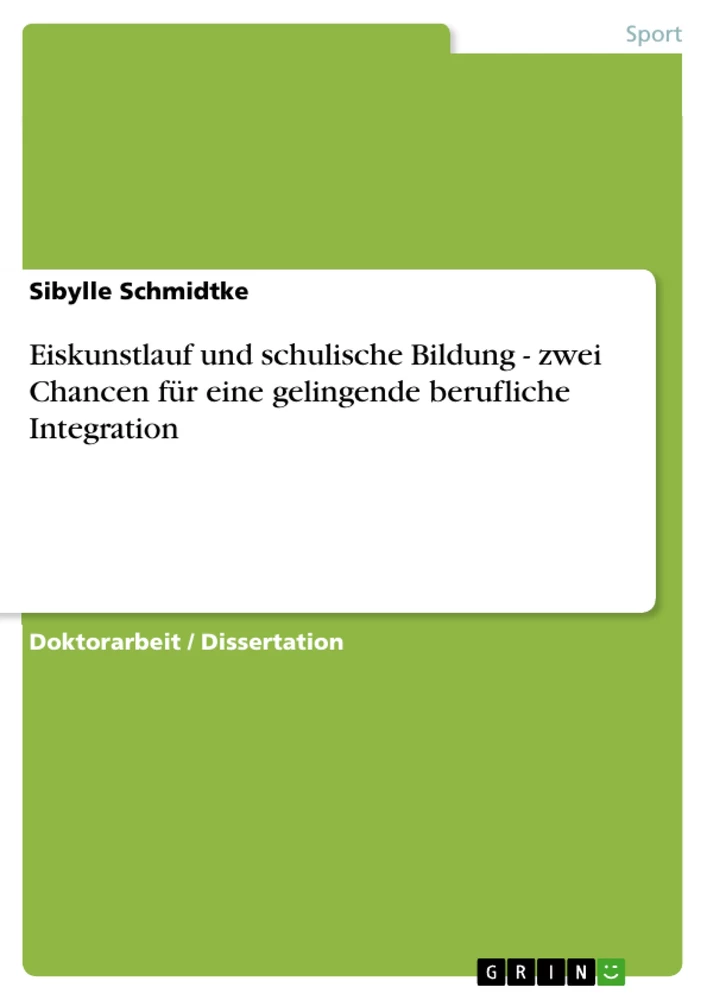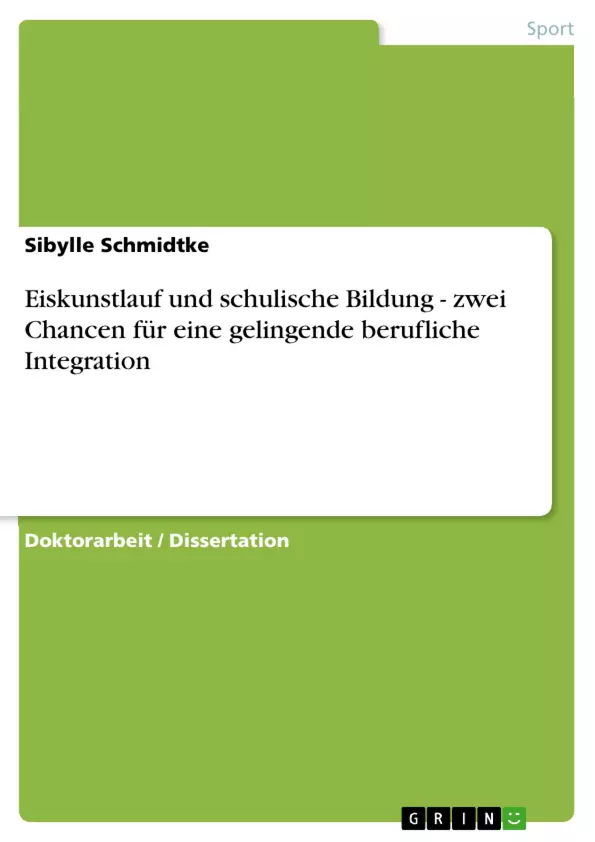Eiskunstlauf gehört zu den Sportarten, die bereits in sehr jungen Jahren begonnen werden müssen, damit Chancen auf den „Sprung“ in die hochleistungssportliche Karriere bestehen. Nicht selten erfolgen die ersten Schritte auf dem Eis im Vorschulalter.
Aus dem reinen Freizeitvergnügen wird häufig durch Trainer, die auf Talentsuche sind, aus der Kür eine Pflicht. Es folgt jahrelanges intensives Training unter Einschränkung oder Zurückstellung anderweitiger Interessen und Potenzialnutzungen. Ehrgeizige Trainer und Eltern geben im frühen Kindesstadium Ziele vor, die das Leben des jungen Leistungssportlers stark bestimmen. Die Hauptaufgabe des heranwachsenden Eisläufers besteht letztlich darin, die Anforderungen von Schule und Ausbildung mit denen des Sports zu verbinden. Dies sind auch die Voraussetzungen für die spätere berufliche Entwicklung.
Die Lebensbereiche Sport und Schule bzw. Ausbildung stehen in zeitlicher und leistungsmäßiger Konkurrenz. Hier stellt sich vor allem bei Kinderleistungssportlern die Frage, wie sich die sportspezifische Sozialisation zunächst auf Schule bzw. Ausbildung und anschließend auf die berufliche Integration auswirkt. Der Leistungssport steht damit in einem fundamentalen Spannungsverhältnis zur Ausbildung und einer späteren Berufskarriere. Zwischen Sport und Ausbildung bzw. Beruf besteht damit im Zeitablauf ein wachsender Zielkonflikt.
Es ist zu klären, welche aus dem Hochleistungssport resultierenden individuell entwickelten Fähigkeiten bzw. Defizite (personale Ressourcen) und welche externen Einflussmomente (Bekanntheitsgrad durch die Medien, Ansehen der Sportart Eiskunstlauf, sportbegeisterte Berufskollegen) bzw. Unterstützungsleistungen von der Familie, dem Trainer und dem Verband (Beziehungen) diese Entwicklung beeinflussen.
Interessant und neu im sozial- und sportwissenschaftlichen Bereich ist die Fragestellung, inwieweit sich diese sehr speziellen und vielfältigen Fähigkeiten eines erfolgreichen Eiskunstläufers auf den nach- und außersportlichen schulischen bzw. beruflichen Werdegang auswirken. Zeichnen sich erfolgreiche Sportler durch besonders hohe Werte in Disziplin, Ehrgeiz, Zielorientierung und Zeitmanagement aus und behalten sie diese dauerhaft für ihr weiteres Leben bei? Kann die Selbstsicherheit, sich vor einem Publikum zu präsentieren und es mit einzubeziehen („in den Bann zu ziehen“), auf die Ausbildungssituation bzw. später den Beruf übertragen werden und ist dies förderlich?
Inhaltsverzeichnis
- I. Themenaufriss
- 1. Problemstellung
- 2. Gegenstand und Ziel der Arbeit
- II. Eiskunstlauf: Eine Sportart stellt sich vor
- 1. Geschichte
- 1.1 Wettbewerbe
- 1.2 Regeln
- 1.3 Technik
- 1.4 Ein kritischer Blick auf die Leistungsbeurteilung bei Wettkämpfen
- III. Sozialwissenschaftliche Perspektiven
- 1. Sozialökologischer Ansatz
- 2. Der Ansatz der konstruktivistischen Sozialisationsforschung
- 2.1 Das Konzept des Kindes als Akteur
- 2.1.1 Agency und Sozialisation
- 2.1.2 Reichweite und Grenzen des Akteurskonzepts
- 3. Handlungstheoretische Grundlagen
- 3.1 Soziale Lern- und Erwartungs-Wert-Theorien
- 3.2 Das handlungstheoretische Partialmodell der Persönlichkeit
- 4. Selbstdarstellung als Persönlichkeitseigenschaft oder Impression-Management?
- 4.1 Begriffsverortung und -abgrenzung von Persönlichkeit
- 4.2 Die Impression-Management-Theorie
- 5. Spezielle Lerneffekte
- 5.1 Der Imagefaktor
- 5.2 Körperbild und Körpereinstellung
- 5.3 Die Selbstdarstellung und personale Zusammenhänge
- 6. Strukturelle und systemspezifische Einflüsse im Leistungssport Eiskunstlauf
- 6.1 Der Zeitfaktor
- 6.2 Motivations- und Disziplinierungsmethoden bis Mitte der 1990er Jahre
- 6.3 Konsequenzen für den Handlungsspielraum des Eiskunstläufers
- 6.4 Das Ausscheiden aus dem Leistungssport
- 7. Berufliche Sozialisation
- 7.1 Begriffsverortung der beruflichen Sozialisation
- 7.2 Berufsbeeinflussende Sozialisationsinstanzen in der Kindheit
- 7.3 Die Einflussfaktoren Schicht und Geschlecht auf den beruflichen Habitus
- 7.4 Hauptphasen und -instanzen beruflicher Sozialisation
- 7.5 Selektion und Anforderungsprofile von Arbeitgebern
- 7.6 Zusammenschau und Abgleich der erlernten Fähigkeiten im Eiskunstlauf mit den Anforderungen im Berufsleben
- 8. Ableitung theoretischer Ansätze für den empirischen Teil
- IV. Empirische Untersuchungen und Befunde
- 1. Methodisches Vorgehen
- 1.1 Fragebogen „Eiskunstlauf und Beruf“
- 1.2 Stichprobe
- 2. Untersuchungsvariablen und Operationalisierung
- 2.1 Berufskarriere
- 2.2 Hochleistungssport-Karriere
- 3. Durchführung
- 4. Idealtypisches Basismodell
- 5. Statistische Auswertungen und Ergebnisdiskussion
- 5.1 Grundlegende Ergebnisse zur Charakterisierung der Stichprobe
- 5.2 Ergebnisse zum idealtypischen Basismodell
- 5.3 Typen von empirisch nachweisbaren beruflichen Werdegängen
- 5.3.1 Einfluss des Alters
- 5.3.2 Eiskunstlauf und der berufliche Werdegang
- 5.3.3 Präsentations- und Selbstdarstellungsfähigkeit
- 5.3.4 Eiskunstlauf, Beruf und Schicht
- 5.3.5 Bereichsspezifisches und generalisiertes Kontrollgefühl
- 5.4 Diskussion zum Themenschwerpunkt Eiskunstlauf und Beruf
- V. Entwicklung und Ausblick
- 1. Veränderungen seit der aktiven Zeit der Untersuchungsgruppe
- 1.1 Optimierung des Bewertungssystems seit den 1990er Jahren
- 1.2 Eiskunstlauf als Spiegel gesamtgesellschaftlicher Entwicklungen
- 1.3 Sportliche Motivations- und Disziplinierungsmethoden nach 1995
- 1.4 Pädagogische Ansätze für den Trainingsbereich
- 1.5 Unterstützende Institutionen: Laufbahnberatung an Olympiastützpunkten
- 2. Ausblick: Schule und Leistungssport
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Dissertation untersucht den Einfluss von Eiskunstlauf auf die schulische und berufliche Sozialisation. Sie analysiert die spezifischen Kompetenzen, die im Eiskunstlauf erworben werden, und deren Bedeutung für den Übergang in den Beruf. Die Arbeit verfolgt das Ziel, einen Beitrag zur Laufbahnberatung von Eiskunstläufern zu leisten.
- Die Bedeutung des Eiskunstlaufs für die Entwicklung von Persönlichkeitseigenschaften und sozialen Kompetenzen.
- Die Rolle des Eiskunstlaufs in der beruflichen Sozialisation und der Einfluss von spezifischen Fähigkeiten auf die Berufswahl und den Karriereweg.
- Der Zusammenhang zwischen Eiskunstlauf und schulischer Bildung, insbesondere in Bezug auf die Vereinbarkeit von Sport und Ausbildung.
- Die Herausforderungen und Chancen für Eiskunstläufer bei der Gestaltung ihres Lebens nach der aktiven Sportlerkarriere.
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel I: Themenaufriss: Dieses Kapitel stellt die Problemstellung und das Ziel der Arbeit vor. Es beschreibt den Gegenstand der Untersuchung und legt die theoretischen Grundlagen fest.
- Kapitel II: Eiskunstlauf: Eine Sportart stellt sich vor: Dieses Kapitel gibt eine Einführung in die Sportart Eiskunstlauf. Es behandelt die Geschichte, die Regeln, die Technik und die Leistungsbeurteilung.
- Kapitel III: Sozialwissenschaftliche Perspektiven: Dieses Kapitel diskutiert verschiedene sozialwissenschaftliche Ansätze, die für die Untersuchung des Einflusses von Eiskunstlauf auf die Sozialisation relevant sind. Dazu gehören der sozialökologische Ansatz, die konstruktivistische Sozialisationsforschung und die Handlungstheorie.
- Kapitel IV: Empirische Untersuchungen und Befunde: Dieses Kapitel beschreibt die empirische Untersuchung, die im Rahmen der Dissertation durchgeführt wurde. Es stellt die Methodik, die Stichprobe und die Ergebnisse der Untersuchung dar.
- Kapitel V: Entwicklung und Ausblick: Dieses Kapitel diskutiert die Entwicklung des Eiskunstlaufs seit der aktiven Zeit der Untersuchungsgruppe und gibt einen Ausblick auf die Bedeutung des Eiskunstlaufs für die schulische und berufliche Bildung.
Schlüsselwörter
Eiskunstlauf, Sozialisation, berufliche Integration, schulische Bildung, Leistungssport, Persönlichkeit, Selbstmanagement, Impression-Management, Motivation, Disziplinierung, Karriere, Lebenslauf, Berufswahl, Empirische Forschung, Fragebogen, Stichprobe, Ergebnisse, Entwicklungen, Ausblick.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst Eiskunstlauf als Leistungssport die schulische Bildung?
Da Eiskunstlauf bereits im Kindesalter intensives Training erfordert, entsteht ein Spannungsverhältnis zwischen sportlichen Anforderungen und schulischen Leistungen, das ein hohes Maß an Zeitmanagement erfordert.
Welche personalen Ressourcen entwickeln Eiskunstläufer für das Berufsleben?
Erfolgreiche Sportler zeichnen sich oft durch hohe Werte in Disziplin, Ehrgeiz, Zielorientierung und die Fähigkeit zur Selbstdarstellung (Präsentationskompetenz) aus.
Was versteht man unter „Impression-Management“ im Kontext des Eiskunstlaufs?
Es beschreibt die Fähigkeit, sich vor Publikum gezielt zu präsentieren und einen bestimmten Eindruck zu hinterlassen – eine Kompetenz, die auch in Bewerbungssituationen und im Berufsalltag nützlich sein kann.
Welche Herausforderungen bestehen beim Ausscheiden aus dem Leistungssport?
Ehemalige Sportler müssen den Übergang von einer hochspezialisierten sportlichen Identität in eine zivile Berufskarriere bewältigen, wobei Laufbahnberatungen an Olympiastützpunkten unterstützend wirken können.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen sozialer Schicht und beruflichem Erfolg bei Sportlern?
Die Dissertation untersucht empirisch, inwieweit Faktoren wie die soziale Herkunft (Schicht) den beruflichen Habitus und den Werdegang nach der sportlichen Karriere beeinflussen.
- Quote paper
- Sibylle Schmidtke (Author), 2006, Eiskunstlauf und schulische Bildung - zwei Chancen für eine gelingende berufliche Integration, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/371951