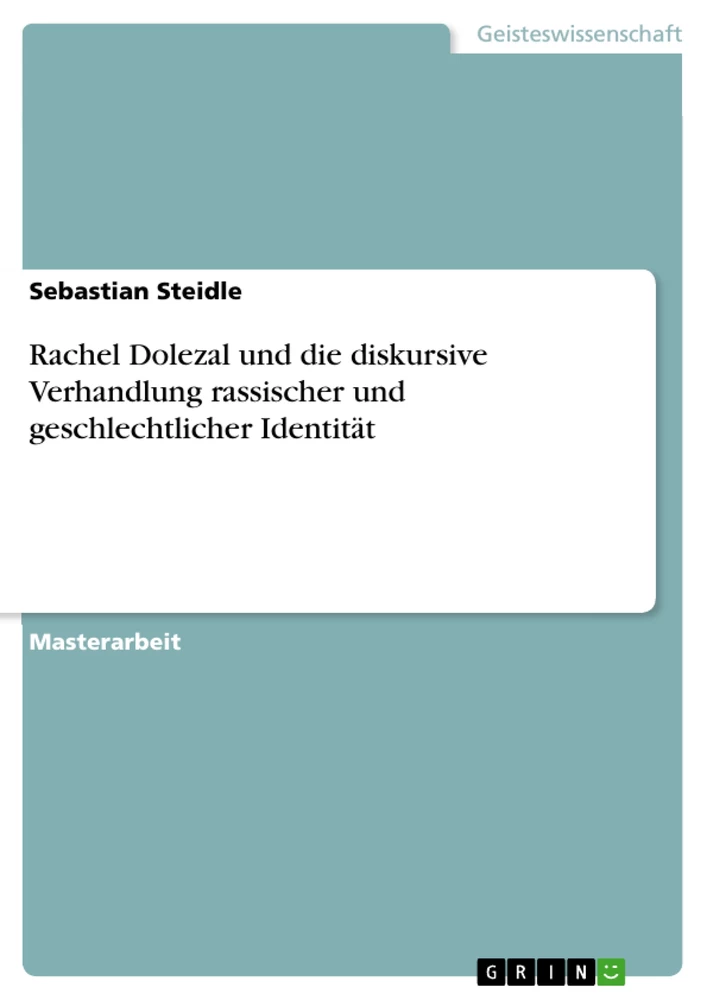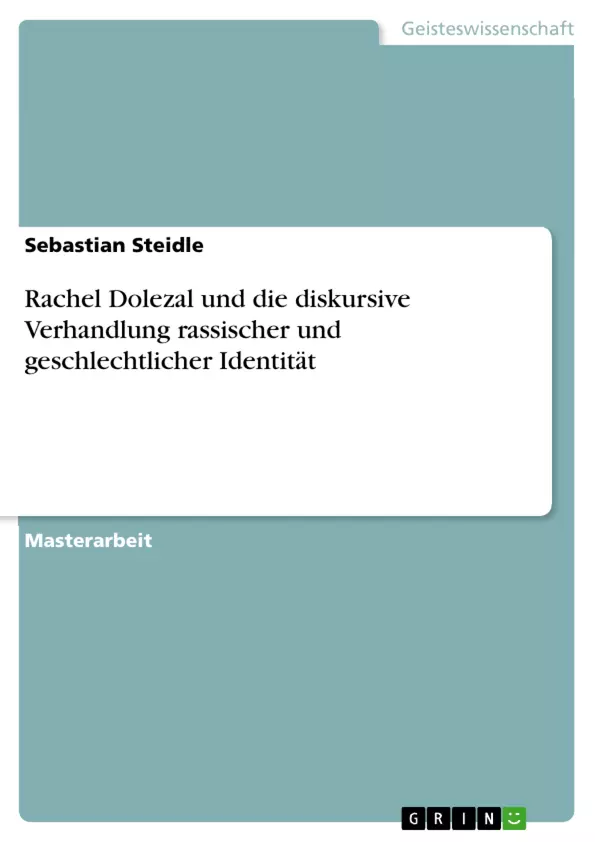Die Arbeit beschäftigt sich mit der Konstruktion von Geschlechtern und Rassen anhand der Analyse der medialen Bearbeitung der Person Rachel Dolezals. Fokus wird hier insbesondere auf die Frage gelegt, welche Vorstellungen darüber existieren, ob das Geschlecht oder die Rasse gewechselt werden könne (Transgender bzw. Transracial), und was überhaupt eine Frau zur Frau und eine Schwarze zur Schwarzen macht.
Am elften Juni 2015 sorgte Rachel Dolezal, Dozentin für afrikanische und afroamerikanische Studien an der Eastern Washington University und Präsidentin der lokalen Abteilung der National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), in den USA und darüber hinaus für einen medialen Skandal. Die Frau, die sich seit Jahren für die Rechte von Afroamerikanern einsetzt und die von sich selbst behauptete, als Schwarze unter der anhaltenden Rassendiskriminierung in Amerika zu leiden, wurde von ihren Eltern als Weiße "geoutet".
Rachel Dolezal hatte zu diversen Anlässen angegeben, Tochter einer weißer Mutter und eines schwarzen Vaters zu sein. An ihrer Identität als Schwarze schien bis dahin kaum Zweifel aufgekommen zu sein. Im Juni 2015 traten jedoch ihre (biologischen und sozialen) Eltern in Kontakt mit der Presse und verkündeten, dass ihre Tochter keinerlei schwarze Vorfahren habe und dass es einen "Fakt" darstelle, dass ihre Tochter Kaukasierin sei . Von der Frau mit schwarzem, gekräuseltem Haar und hellbraunem Hautteint, wurden Fotos veröffentlicht, welche sie als Teenagerin mit blondem, glattem Haar, bleicher Haut und Sommersproßen zeigten. Im Anschluss daran wurde Rachel Dolezal zum Subjekt einer landesweiten Debatte darüber, ob eine Person ihre Rasse wechseln könne. Immer wieder wurde hierbei der Bezug auf die Transgenderthematik gesucht, also die Frage, ob eine Person ihr Geschlecht wechseln könne.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Der Fall Rachel Dolezal
- 2. Methodologische Vorgehensweise
- 2.1 Untersuchungsgegenstand und Fragestellung
- 2.2 Forschungsmethode: Wissenssoziologische Diskursanalyse
- 2.3 Datenerhebung und Auswertung
- 3. Die soziale Praxis des Kategorisierens
- 3.1 Die Kategorisierungsschemata Geschlecht und Rasse
- 3.2 Die Kategorien Transgender und Transracial
- 4. Grundzüge der Debatte
- 5. Die diskursive Deviantisierung Rachel Dolezals
- 6. Die Diskurse des Feldes
- 6.1 Der Konservative Diskurs
- 6.2 Der Liberale Diskurs
- 6.3 Der Postmoderne Diskurs
- 7. Das dominante Transgendernarrativ
- 8. Konkurrierende Essenzkonstruktionen
- 8.1 Biologischer Essentialismus
- 8.2 Mentaler Essentialismus
- 8.3 Soziologischer Essentialismus
- 8.3.1 Soziologischer Geschlechteressentialismus und der Transgenderkritische-Feministische Diskurs
- 9. Die Logik und Norm von Repräsentation und Authentizität
- 10. (Schicksals-)Gemeinschaften oder intime Qualitäten?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die öffentliche Debatte um Rachel Dolezal, die sich trotz weißer biologischer Eltern als schwarz identifizierte. Ziel ist es, die diskursiven Strategien zu analysieren, mit denen Dolezals Identität verhandelt und bewertet wurde. Die Arbeit beleuchtet die komplexen Zusammenhänge von Rasse, Geschlecht und Identität im Kontext gesellschaftlicher Kategorisierung.
- Diskursive Konstruktion von Rasse und Geschlecht
- Die Rolle von Medien in der Identitätsbildung
- Konzepte von Authentizität und Repräsentation
- Vergleichende Analyse mit dem Fall Caitlyn Jenner
- Konkurrierende Essentialismus-Konzepte
Zusammenfassung der Kapitel
1. Der Fall Rachel Dolezal: Das Kapitel präsentiert den Fall Rachel Dolezal, eine weiße Frau, die sich öffentlich als schwarz identifizierte und in verschiedenen Positionen in afroamerikanischen Organisationen tätig war. Ihre Enttarnung durch ihre Eltern löste eine breite öffentliche Debatte aus, die sich um die Fragen der Authentizität von Identität, der Bedeutung von Rasse und der Legitimität von Selbstzuschreibungen drehte. Der Fall wird im Kontext ähnlicher Debatten um Transgender-Identitäten, insbesondere der von Caitlyn Jenner, eingeführt und die unterschiedlichen Reaktionen darauf kontrastiert.
2. Methodologische Vorgehensweise: Dieses Kapitel beschreibt die methodischen Grundlagen der Arbeit. Es definiert den Untersuchungsgegenstand als die diskursive Konstruktion von Identität im Fall Rachel Dolezal. Die gewählte Forschungsmethode ist die wissenssoziologische Diskursanalyse, die die Entstehung und Verbreitung von Wissen über Identität in den Medien untersucht. Die Datenerhebung beinhaltet die Analyse von Print- und Online-Medienbeiträgen, die die Debatte um Rachel Dolezal dokumentieren. Die Auswertung fokussiert auf die Argumentationsstrukturen und die verwendeten Kategorien.
3. Die soziale Praxis des Kategorisierens: Hier werden die sozialen Praktiken der Kategorisierung von Geschlecht und Rasse beleuchtet. Das Kapitel untersucht, wie diese Kategorien gesellschaftlich konstruiert und angewendet werden und welche impliziten Annahmen dahinterstehen. Es werden die Konzepte von Transgender und Transracial diskutiert und deren Bedeutung im Kontext der Debatte um Rachel Dolezal analysiert. Der Fokus liegt auf der Frage, inwieweit diese Kategorien biologische Fakten oder soziale Konstruktionen darstellen.
4. Grundzüge der Debatte: In diesem Abschnitt wird die öffentliche Debatte um Rachel Dolezal umfassend zusammengefasst, die unterschiedlichen Positionen und Argumente der beteiligten Akteure werden dargestellt. Das Kapitel analysiert die verschiedenen Deutungsrahmen, durch die das Handeln Rachel Dolezals erklärt und bewertet wurde. Es beleuchtet die Spannungen zwischen biologischen, sozialen und selbst gewählten Identitätszuschreibungen. Die Vielfältigkeit der Reaktionen auf den Fall Dolezal wird umfassend dargestellt und interpretiert.
5. Die diskursive Deviantisierung Rachel Dolezals: Dieser Abschnitt fokussiert darauf, wie Rachel Dolezal in der öffentlichen Debatte als abweichend und illegitim dargestellt wurde. Es wird analysiert, welche diskursiven Strategien verwendet wurden, um ihr Verhalten zu verurteilen und zu delegitimieren. Die Analyse untersucht die Rolle von Moralvorstellungen und gesellschaftlichen Normen in der Beurteilung ihrer Identität. Es werden verschiedene Strategien der Disqualifikation und Diffamierung Dolezals im öffentlichen Diskurs beleuchtet.
6. Die Diskurse des Feldes: Das Kapitel unterteilt die Debatte in verschiedene Diskurse (konservativ, liberal, postmodern), analysiert deren jeweilige Argumentationsmuster und die verwendeten Kategorien. Die verschiedenen Perspektiven und Interpretationen des Falls werden im Detail vorgestellt und deren Unterschiede und Gemeinsamkeiten herausgearbeitet. Der Einfluss der jeweiligen ideologischen Ausrichtung auf die Deutung des Falls wird ausführlich untersucht.
7. Das dominante Transgendernarrativ: Dieses Kapitel vergleicht die öffentliche Wahrnehmung des Falls Dolezal mit der des Falls Caitlyn Jenner. Es wird analysiert, wie die positive Resonanz auf Jenners Transgender-Prozess im Gegensatz zu den negativen Reaktionen auf Dolezals Selbstzuschreibung als schwarz steht. Der Fokus liegt auf der Darstellung des Geschlechts als im Vergleich zu Rasse als stärker gesellschaftlich beeinflussbar und akzeptabel. Die verschiedenen Normen und Erwartungen der jeweiligen Debatten werden analysiert.
8. Konkurrierende Essenzkonstruktionen: Hier werden verschiedene Theorien zur Konstruktion von Identität und Essentialismus diskutiert (biologisch, mental, soziologisch). Der Abschnitt untersucht die verschiedenen Auffassungen über die Natur von Rasse und Geschlecht und deren Auswirkungen auf die Beurteilung der Identitätsansprüche von Dolezal. Es werden verschiedene theoretische Perspektiven auf das Verhältnis von Identität, Körper und Gesellschaft diskutiert.
9. Die Logik und Norm von Repräsentation und Authentizität: In diesem Kapitel wird die Frage der Authentizität im Kontext von Rasse und Identität untersucht. Es wird diskutiert, welche Kriterien für die Anerkennung von Identität relevant sind und wie diese Kriterien gesellschaftlich konstruiert und angewendet werden. Die unterschiedlichen Ansprüche an die "echte" Repräsentation von Gruppen werden analysiert, und die Ambivalenz und Widersprüchlichkeit im Umgang mit solchen Ansprüchen.
10. (Schicksals-)Gemeinschaften oder intime Qualitäten?: Dieser Abschnitt untersucht die Frage, inwieweit die Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe durch gemeinsame Erfahrungen oder durch eine subjektive Identifikation definiert wird. Es werden verschiedene Modelle der Gruppenbildung und Identitätsfindung diskutiert und deren Bedeutung für die Beurteilung des Falls Dolezal analysiert. Die Analyse stellt die Komplexität von Gemeinschaftsbildung in Frage.
Schlüsselwörter
Rachel Dolezal, Transracial, Transgender, Rasse, Geschlecht, Identität, Diskursanalyse, Medien, Authentizität, Repräsentation, Essentialismus, Identitätspolitik, USA, mediale Darstellung, soziale Kategorisierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Die diskursive Konstruktion von Identität im Fall Rachel Dolezal"
Was ist das zentrale Thema der Arbeit?
Die Arbeit analysiert die öffentliche Debatte um Rachel Dolezal, eine weiße Frau, die sich als schwarz identifizierte. Der Fokus liegt auf der diskursiven Konstruktion von Identität und den Strategien, mit denen Dolezals Identität verhandelt und bewertet wurde. Die Arbeit untersucht die komplexen Zusammenhänge von Rasse, Geschlecht und Identität im Kontext gesellschaftlicher Kategorisierung.
Welche Methode wird in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit verwendet die wissenssoziologische Diskursanalyse. Diese Methode untersucht die Entstehung und Verbreitung von Wissen über Identität in den Medien, anhand der Analyse von Print- und Online-Medienbeiträgen zur Debatte um Rachel Dolezal.
Welche Aspekte von Rachel Dolezals Fall werden untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene Aspekte, darunter die diskursive Deviantisierung Dolezals, die unterschiedlichen Diskurse (konservativ, liberal, postmodern) in der Debatte, konkurrierende Essentialismus-Konzepte (biologisch, mental, soziologisch), die Logik und Norm von Repräsentation und Authentizität, sowie die Frage nach (Schicksals-)Gemeinschaften oder intimen Qualitäten als Grundlage von Gruppenzugehörigkeit.
Wie werden Rasse und Geschlecht in der Arbeit betrachtet?
Die Arbeit beleuchtet die sozialen Praktiken der Kategorisierung von Geschlecht und Rasse, untersucht wie diese Kategorien gesellschaftlich konstruiert und angewendet werden und welche impliziten Annahmen dahinterstehen. Sie diskutiert die Konzepte von Transgender und Transracial und deren Bedeutung im Kontext der Debatte um Rachel Dolezal.
Welche Rolle spielen Medien in der Arbeit?
Medien spielen eine zentrale Rolle, da die Arbeit die diskursive Konstruktion von Identität in den Medien analysiert. Die Datenerhebung basiert auf der Auswertung von Print- und Online-Medienbeiträgen, die die Debatte um Rachel Dolezal dokumentieren.
Wie wird der Fall Rachel Dolezal mit dem Fall Caitlyn Jenner verglichen?
Die Arbeit vergleicht die öffentliche Wahrnehmung von Rachel Dolezal und Caitlyn Jenner, um die unterschiedlichen Reaktionen auf Transracial- und Transgender-Identitäten zu analysieren und die verschiedenen Normen und Erwartungen der jeweiligen Debatten herauszuarbeiten.
Welche Schlüsselkonzepte werden in der Arbeit behandelt?
Schlüsselkonzepte sind unter anderem: Diskursive Konstruktion von Rasse und Geschlecht, Authentizität und Repräsentation, Essentialismus, Identitätspolitik, mediale Darstellung und soziale Kategorisierung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit umfasst zehn Kapitel: Das erste Kapitel stellt den Fall Rachel Dolezal vor. Kapitel zwei beschreibt die methodische Vorgehensweise. Kapitel drei beleuchtet die soziale Praxis des Kategorisierens. Kapitel vier fasst die Grundzüge der Debatte zusammen. Kapitel fünf analysiert die diskursive Deviantisierung Dolezals. Kapitel sechs untersucht die verschiedenen Diskurse in der Debatte. Kapitel sieben vergleicht den Fall Dolezal mit dem Fall Caitlyn Jenner. Kapitel acht diskutiert konkurrierende Essenzkonstruktionen. Kapitel neun behandelt die Logik und Norm von Repräsentation und Authentizität. Kapitel zehn untersucht die Frage nach (Schicksals-)Gemeinschaften oder intimen Qualitäten.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die diskursiven Strategien zu analysieren, mit denen Dolezals Identität verhandelt und bewertet wurde, und die komplexen Zusammenhänge von Rasse, Geschlecht und Identität im Kontext gesellschaftlicher Kategorisierung zu beleuchten.
- Citation du texte
- Bachelor of Arts Sebastian Steidle (Auteur), 2017, Rachel Dolezal und die diskursive Verhandlung rassischer und geschlechtlicher Identität, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/372015