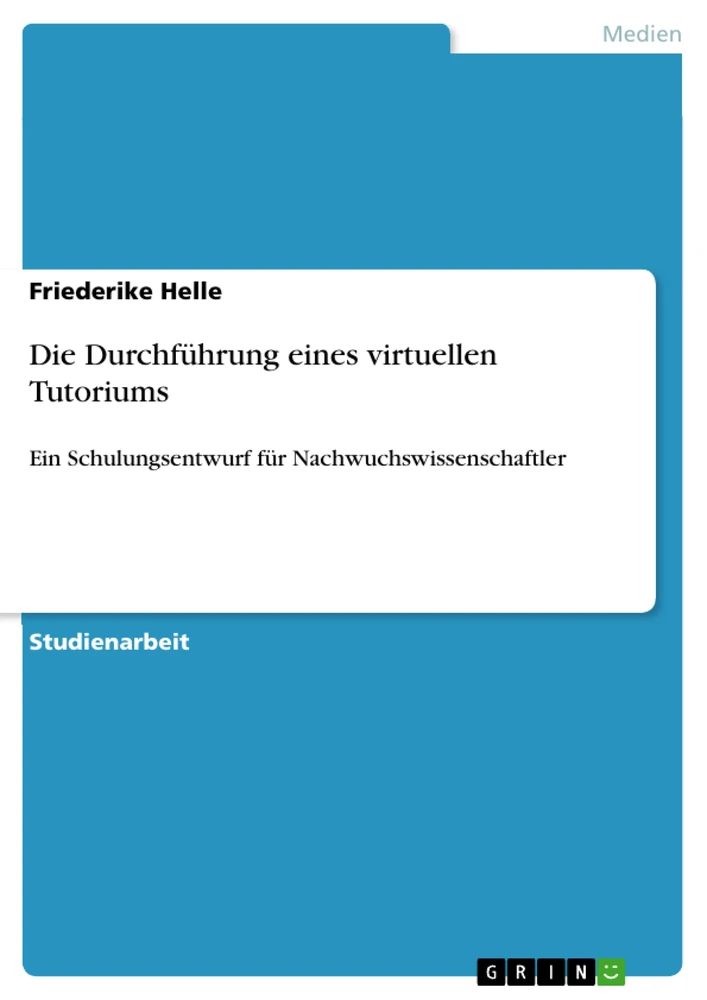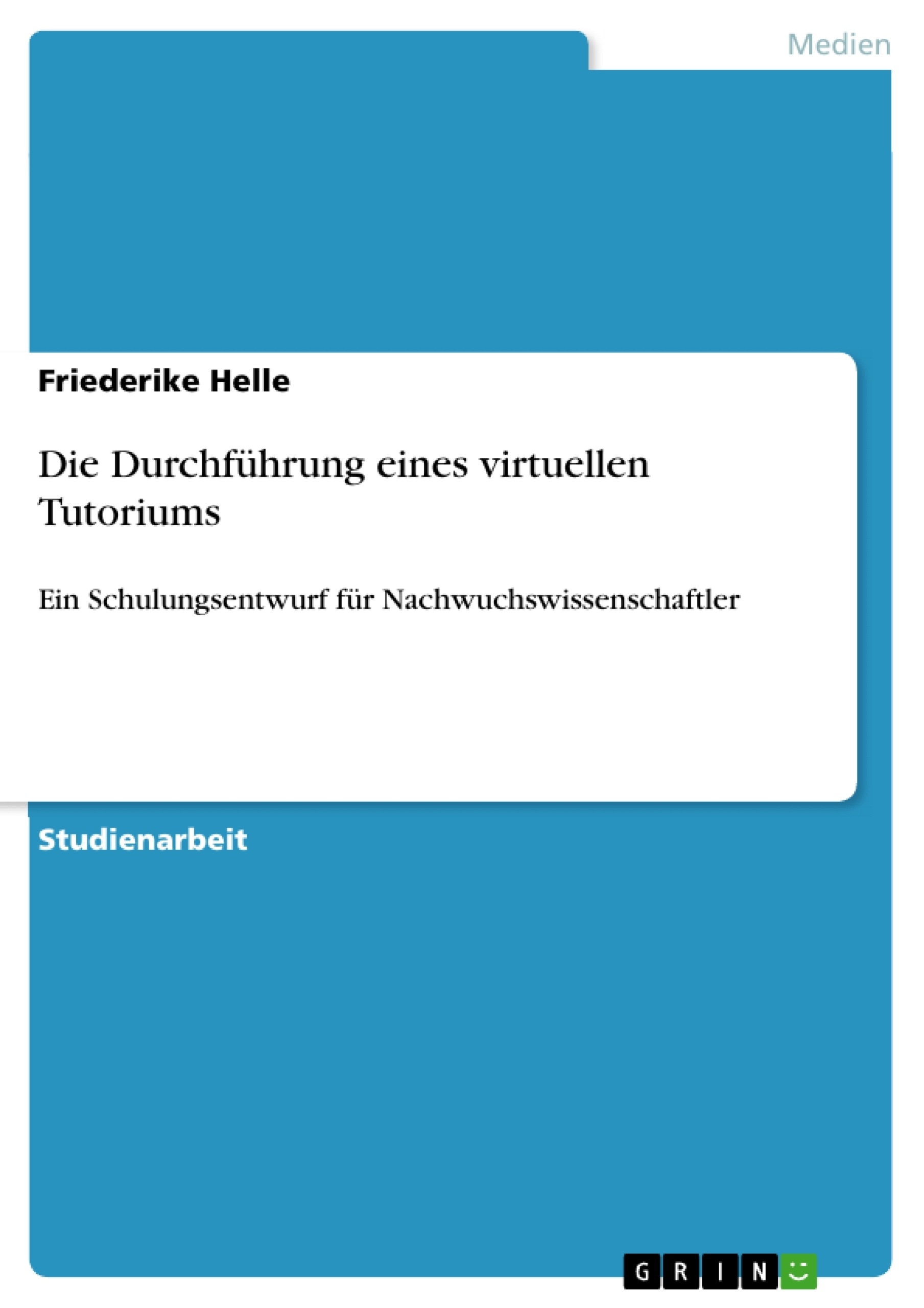Die vorliegende Hausarbeit zielt darauf ab, Nachwuchswissenschaftler mittels eines Schulungsentwurfs nach dem Vier Komponenten Instruktions Modell (4CID-Modell) zur Durchführung virtueller Tutorien zu befähigen.
Die Auffassung, virtueller Unterricht sei dem Präsenzunterricht im Allgemeinen überlegen, begründen Befürworter des E-Learning damit, dass multimediale Werkzeuge zu jeder Zeit und für jeden verfügbar sind. Für viele Erwachsene, deren Tagesablauf durch die Vereinbarung von Familie und Job bestimmt ist, bieten dieser Vorteil und die damit einhergehende Flexibilität die Möglichkeit, zusätzlich ein Studium zu absolvieren. Daraus ergibt sich für Präsenz- und Fernuniversitäten der Bedarf an zeit- und ortsunabhängigem E-Learning, wie zum Beispiel virtuellen Tutorien und somit auch an in E-Learning geschulten Lehrenden bzw. Tutoren. Der Duden definiert den Begriff Tutor u. a. als „Lehrer, Ratgeber und Betreuer von Studierenden und SchülerInnen“. Quilling und Nicolini (2009) zufolge setzt sich das Profil eines E-Learning Coaches aus den vier Kompetenzfeldern methodisch-didaktische Kompetenz, medientechnische Kompetenz, Kommunikations- und Sozialkompetenz sowie Fachkompetenz zusammen (Quilling & Nicolini, 2009, S. 121). Die Frage nach dem Qualifikationsprofil des idealen Tutors beantwortet Rautenstrauch (zitiert nach Böhm, 2006, S. 26) mit einer Reihe von Eigenschaften und Kompetenzen: demnach verfügt der ideale Tutor unter anderem über didaktische Kenntnisse, autodidaktische Fähigkeiten, technische, Moderations- und Fachkompetenzen, kommunikative Fähigkeiten, Wissen über Lerntypen und -prozesse, Kreativität und die Fähigkeit, eine begrenzte Zahl von Lernenden gleichzeitig zu betreuen. Die in beiden Profilen erwähnten didaktischen Kompetenzen bedürfen einer Ausbildung, die im Fall deutscher Hochschullehrer bisher weitgehend dem Zufall überlassen wurde. Somit waren sie in der Erarbeitung eigener Lehrkompetenzen auf sich allein gestellt (Winteler & Krapp, 1999, S. 45). Um daraus resultierenden Qualitätsmängeln in der Lehre - bestehend aus fehlerhaft oder gar nicht erlernten Lehrkompetenzen - gezielt vorzubeugen, wird im Folgenden eine Schulung für Nachwuchswissenschaftler zum Erwerb der Zielkompetenz, ein virtuelles Tutorium durchzuführen, erarbeitet und vorgestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zielsetzung
- 4CID-Modell
- Szenario
- Virtualität
- Theoretischer Exkurs
- Pfadabhängigkeit
- Unterschied zwischen Didaktik und Instruktionsdesign
- Bezugstheorie des 4CID-Modells
- Hierarchische Kompetenzanalyse
- Hierarchiefunktion
- Hierarchieerstellung
- (Non-) Rekurrente Fertigkeiten
- Bildung von Aufgabenklassen
- Funktion
- Vereinfachende Annahmen und Aufgabenklassen
- Entwicklung von Lernaufgaben
- Lernaufgaben
- Variabilität
- Mediale Umsetzung
- Fidelity
- Didaktische Szenarien
- Prozedurale und unterstützende Information
- Unterstützende Information
- Prozedurale Information
- Part-task Practice
- Fazit
- Verortung im ADDIE-Phasenmodell
- Stärken-Schwächen-Abschätzung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung eines Schulungsentwurfs für Nachwuchswissenschaftler, um sie in der Durchführung von virtuellen Tutorien zu befähigen. Dabei wird das Vier Komponenten Instruktions Modell (4CID-Modell) als Grundlage für den Entwurf genutzt. Der Fokus liegt auf der didaktischen und medialen Gestaltung des virtuellen Tutoriums und soll so zu einer Verbesserung der Qualität von E-Learning-Angeboten beitragen.
- Das 4CID-Modell als Grundlage für die Entwicklung eines Schulungsentwurfs für die Durchführung von virtuellen Tutorien
- Hierarchische Kompetenzanalyse und die Identifizierung von rekurrenten und non-rekurrenten Fertigkeiten im Kontext virtueller Tutorien
- Entwicklung von Lernaufgaben, die auf die spezifischen Anforderungen virtueller Tutorien zugeschnitten sind
- Einbindung von unterstützenden und prozeduralen Informationen in die Lernumgebung
- Der Einsatz von Part-task Practice zur Automatisierung von rekurrenten Aufgaben
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des virtuellen Tutoriums und die Zielsetzung der Hausarbeit ein. Sie stellt das 4CID-Modell vor und beschreibt das zugrundeliegende Szenario. Der theoretische Exkurs beleuchtet die Pfadabhängigkeit des 4CID-Modells, den Unterschied zwischen Didaktik und Instruktionsdesign sowie die Bezugstheorie des Modells. Das Kapitel "Hierarchische Kompetenzanalyse" geht auf die Identifizierung von rekurrenten und non-rekurrenten Fertigkeiten ein, die für die Durchführung eines virtuellen Tutoriums notwendig sind. Im Kapitel "Bildung von Aufgabenklassen" werden die notwendigen Aufgabenklassen zur Schulung der Fertigkeiten des virtuellen Tutoriums definiert. "Entwicklung von Lernaufgaben" beschäftigt sich mit der Gestaltung von Lernaufgaben, die den Lernenden die Anwendung der erlernten Fertigkeiten in einem realistischen Kontext ermöglichen. Das Kapitel "Prozedurale und unterstützende Information" thematisiert die Gestaltung von unterstützenden und prozeduralen Informationen, die den Lernenden bei der Bewältigung der Lernaufgaben zur Seite stehen. "Part-task Practice" stellt die Bedeutung von zusätzlichen Übungen zur Automatisierung der rekurrenten Abläufe innerhalb der Zielkompetenz dar.
Schlüsselwörter
Virtuelles Tutorium, 4CID-Modell, E-Learning, Instruktionsdesign, Hierarchische Kompetenzanalyse, Rekurrente und non-rekurrente Fertigkeiten, Lernaufgaben, Unterstützende Information, Prozedurale Information, Part-task Practice, Didaktik
Häufig gestellte Fragen
Was ist das 4CID-Modell?
Das Vier Komponenten Instruktions Modell (4CID) ist ein Ansatz des Instruktionsdesigns, der speziell für das Erlernen komplexer kognitiver Fertigkeiten entwickelt wurde.
Welche Kompetenzen benötigt ein idealer E-Tutor?
Ein virtueller Tutor benötigt methodisch-didaktische Kompetenz, medientechnische Kompetenz, Kommunikations- und Sozialkompetenz sowie Fachkompetenz.
Was sind rekurrente und non-rekurrente Fertigkeiten?
Rekurrente Fertigkeiten sind Routineaufgaben, die automatisiert werden können (z. B. Technik-Check). Non-rekurrente Fertigkeiten erfordern Problemlösung und individuelles Urteilsvermögen (z. B. Moderation von Diskussionen).
Warum ist eine Schulung für Nachwuchswissenschaftler notwendig?
Lehrkompetenzen werden oft dem Zufall überlassen. Eine gezielte Schulung beugt Qualitätsmängeln in der virtuellen Lehre vor und professionalisiert die Tutorenrolle.
Was versteht man unter „Part-task Practice“ im 4CID-Modell?
Es handelt sich um zusätzliches Üben von Teilaufgaben, um Routinefertigkeiten (rekurrente Fertigkeiten) so weit zu automatisieren, dass sie im Gesamtablauf keine kognitive Überlastung verursachen.
Welche Rolle spielen „unterstützende Informationen“?
Diese Informationen helfen den Lernenden bei der Bewältigung von komplexen, nicht-routinemäßigen Aufgaben, indem sie theoretisches Hintergrundwissen und Strategien bereitstellen.
- Citar trabajo
- Friederike Helle (Autor), 2016, Die Durchführung eines virtuellen Tutoriums, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/372113