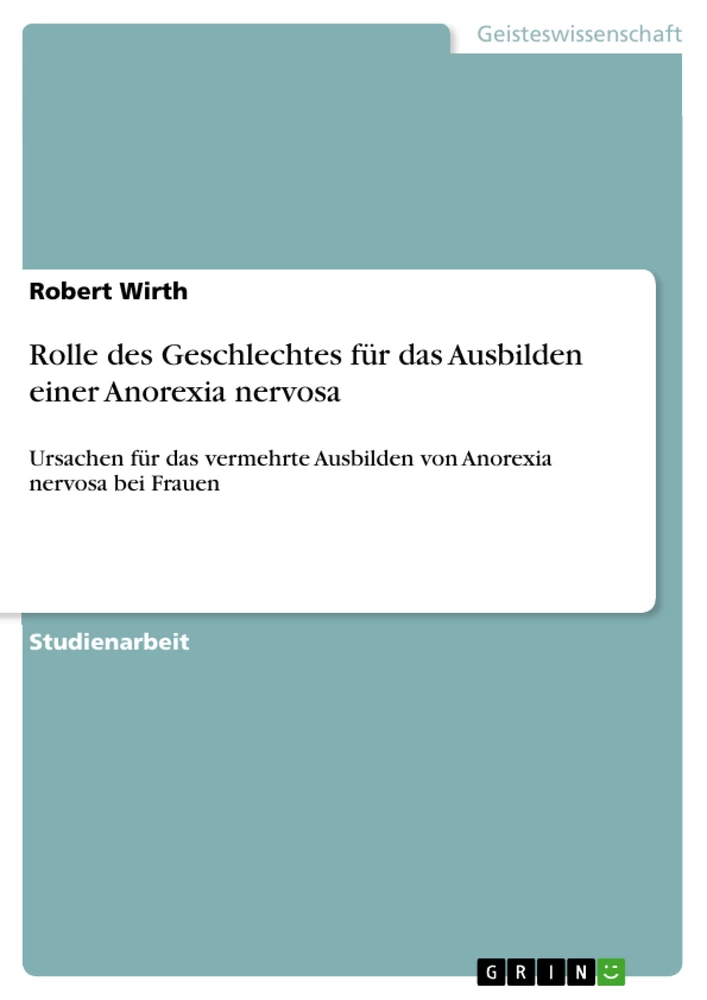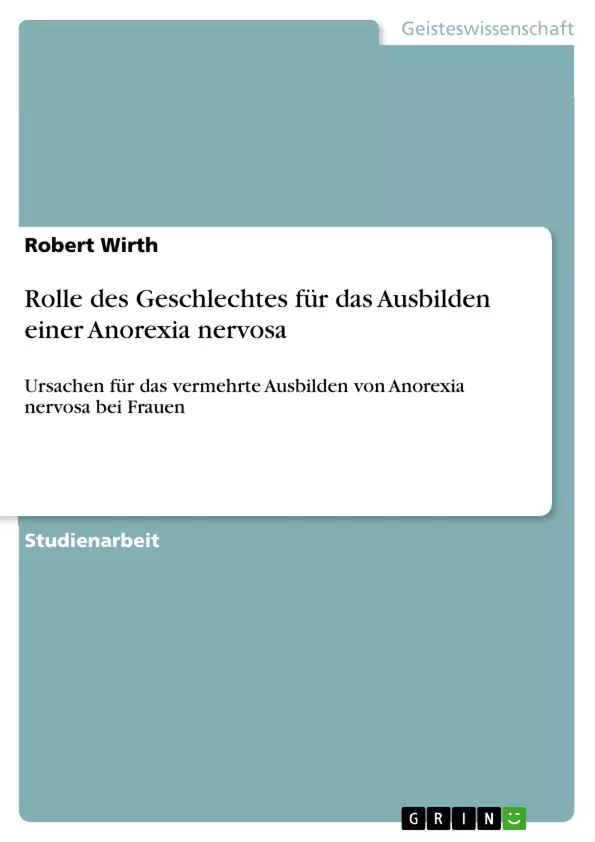Die Erkrankung Anorexia nervosa ist ein in den Medien immer wieder auftauchendes Phänomen. Betrachtet man die Fachliteratur, die sich mit dem Krankheitsbild der Anorexia nervosa befasst, stellt man schnell fest, dass dort überwiegend von weiblichen Betroffenen die Rede ist.
In dieser Arbeit soll untersucht werden, welche Ursachen es haben könnte, dass mehr Frauen und Mädchen von der Erkrankung betroffen sind als Männer oder Jungen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Anorexia nervosa
- 2.1. Soziodemografische Daten
- 2.2. Lebenswelt der anorektischen Kinder und Jugendlichen
- 2.2.1. Familiendynamik
- 2.2.2. Soziologische Einflüsse
- 3. Warum sind bedeutend mehr Frauen von einer Anorexia nervosa betroffen?
- 3.1. Frauenrolle
- 3.2. Adoleszenz
- 3.3. Schönheitsideale
- 4. Warum werden Männer anorektisch?
- 4.1. Männerrolle
- 4.2. Adoleszenz
- 4.3. Schönheitsideale
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Ursachen für das vermeintlich häufigere Auftreten von Anorexia nervosa bei Frauen im Vergleich zu Männern. Zunächst wird das Krankheitsbild der Anorexia nervosa kurz beschrieben und die soziodemografischen Daten analysiert, um die Geschlechterverteilung der Betroffenen zu beleuchten. Anschließend werden mögliche Faktoren beleuchtet, die zur Entstehung der Erkrankung bei Frauen und Männern beitragen könnten.
- Geschlechterverteilung bei Anorexia nervosa
- Soziodemografische Faktoren
- Einfluss der Geschlechterrollen
- Rolle der Adoleszenz
- Einfluss von Schönheitsidealen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Anorexia nervosa ein und stellt die Forschungsfrage nach den Gründen für die höhere Prävalenz bei Frauen im Vergleich zu Männern. Sie verweist auf eine Studie von Nemetz (2008), die einen deutlichen Unterschied in der Geschlechterverteilung der Betroffenen in Pro-Ana-Foren zeigt. Die Einleitung umreißt den Aufbau der Arbeit und kündigt die einzelnen Kapitel mit ihren jeweiligen Schwerpunkten an.
2. Anorexia nervosa: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über das Krankheitsbild der Anorexia nervosa. Es beschreibt die Erkrankung als eine schwerwiegende psychische Erkrankung mit selbst herbeigeführtem Gewichtsverlust, Körperschemastörung und weiteren körperlichen Auswirkungen. Der irreführende Aspekt der Bezeichnung „Anorexia“ wird erläutert, und es wird auf die psychische Komponente der Erkrankung hingewiesen. Das Kapitel beleuchtet die Geschichte der Anorexia nervosa und deren Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Abschließend werden soziodemografische Daten präsentiert, die die deutlich höhere Prävalenz bei Frauen belegen.
2.2. Lebenswelt der anorektischen Kinder und Jugendlichen: Dieses Kapitel befasst sich mit den multifaktoriellen Ursachen der Anorexia nervosa. Es konzentriert sich auf familiendynamische und soziologische Einflüsse, die besonders im Zusammenhang mit der höheren Prävalenz bei Frauen relevant erscheinen. Es werden die Werke von Bruch (2002), Selvini Palazzoli (2003) und Minuchin et al. (1995) erwähnt, die die Bedeutung der Familiendynamik hervorheben. Das Kapitel beschreibt die oft beobachtete Anpassungsfähigkeit anorektischer Kinder und Jugendlicher und den damit verbundenen hohen Leistungsdruck in ihren Familien. Ein Zitat einer Betroffenen verdeutlicht den psychischen Leidensdruck und die Selbstkontrolle im Umgang mit Hungergefühl.
Schlüsselwörter
Anorexia nervosa, Geschlechterunterschiede, Soziodemografie, Familiendynamik, Schönheitsideale, Adoleszenz, Geschlechterrollen, Essstörung, Pro-Ana-Foren, Prävalenz.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse der Geschlechterverteilung bei Anorexia Nervosa
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Ursachen für das vermeintlich häufigere Auftreten von Anorexia nervosa bei Frauen im Vergleich zu Männern. Sie analysiert soziodemografische Daten, Geschlechterrollen, die Adoleszenz und den Einfluss von Schönheitsidealen auf die Entstehung der Erkrankung bei beiden Geschlechtern.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, ein Kapitel über Anorexia nervosa mit soziodemografischen Daten und die Lebenswelt anorektischer Kinder und Jugendlicher (inkl. Familiendynamik und soziologischen Einflüssen). Weitere Kapitel befassen sich gezielt mit den Gründen für die höhere Prävalenz bei Frauen (Frauenrolle, Adoleszenz, Schönheitsideale) und bei Männern (Männerrolle, Adoleszenz, Schönheitsideale).
Welche Quellen werden genannt?
Die Arbeit bezieht sich auf die Werke von Nemetz (2008), Bruch (2002), Selvini Palazzoli (2003) und Minuchin et al. (1995), wobei die letztgenannten Autoren die Bedeutung der Familiendynamik bei Anorexia nervosa hervorheben.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel unterteilt, beginnend mit einer Einleitung, die die Forschungsfrage und den Aufbau der Arbeit beschreibt. Es folgen Kapitel zur Beschreibung der Anorexia nervosa, zur Analyse soziodemografischer Daten und der Lebenswelt Betroffener, sowie Kapitel zur Untersuchung der Geschlechterverteilung bei Frauen und Männern.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter sind: Anorexia nervosa, Geschlechterunterschiede, Soziodemografie, Familiendynamik, Schönheitsideale, Adoleszenz, Geschlechterrollen, Essstörung, Pro-Ana-Foren, Prävalenz.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die konkreten Schlussfolgerungen der Arbeit sind aus dem gegebenen Textfragment nicht vollständig ersichtlich. Jedoch wird deutlich, dass die Arbeit auf multifaktorielle Ursachen der Anorexia Nervosa hinweist und den Einfluss von soziokulturellen Faktoren, Familiendynamik und gesellschaftlichen Schönheitsidealen untersucht.
Welche Daten werden analysiert?
Die Arbeit analysiert soziodemografische Daten zur Geschlechterverteilung bei Anorexia nervosa und untersucht den Einfluss von familiären und soziologischen Faktoren.
Worum geht es im Kapitel zur Lebenswelt anorektischer Kinder und Jugendlicher?
Dieses Kapitel beleuchtet die multifaktoriellen Ursachen der Anorexia nervosa, indem es sich auf familiendynamische und soziologische Einflüsse konzentriert, die besonders im Zusammenhang mit der höheren Prävalenz bei Frauen relevant erscheinen. Es werden die Werke von Bruch, Selvini Palazzoli und Minuchin et al. erwähnt, welche die Bedeutung der Familiendynamik hervorheben. Das Kapitel beschreibt die Anpassungsfähigkeit anorektischer Kinder und Jugendlicher und den damit verbundenen hohen Leistungsdruck in ihren Familien.
- Quote paper
- Robert Wirth (Author), 2017, Rolle des Geschlechtes für das Ausbilden einer Anorexia nervosa, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/372132