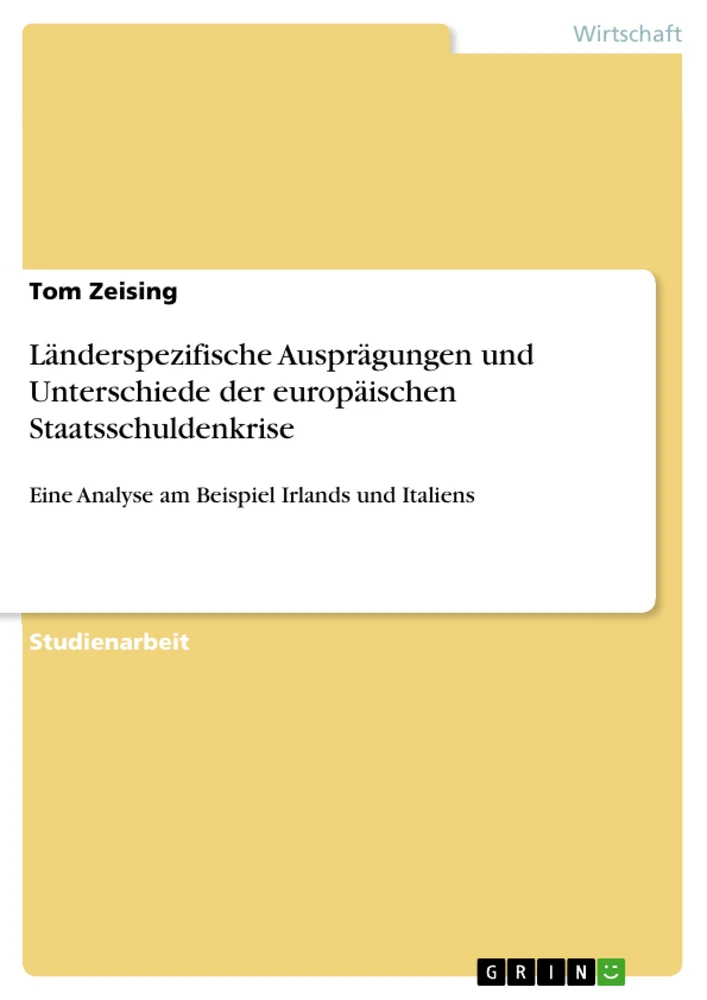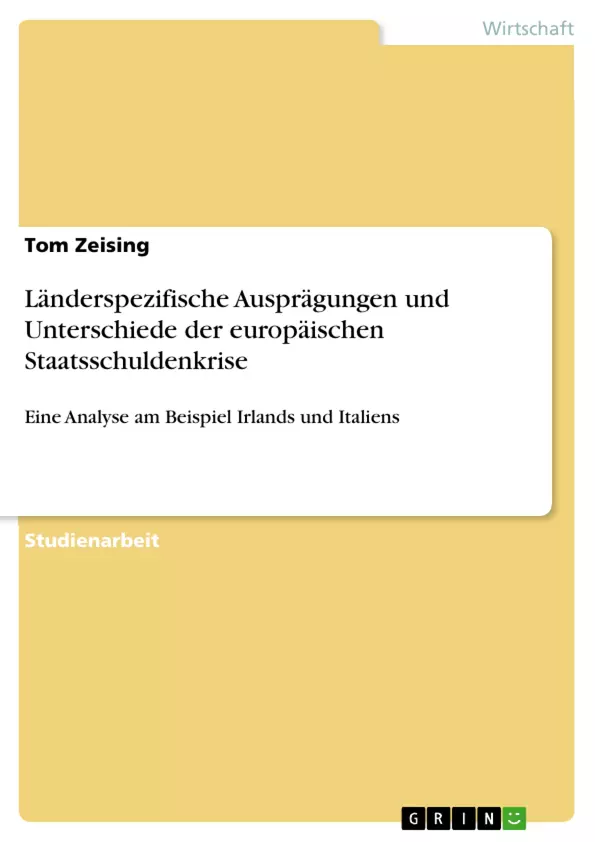Die Arbeit soll zum einen die allgemeinen Gegebenheiten, sowie die grundsätzliche Beschaffenheit der europäischen Staatsschuldenkrise beleuchten, sowie die genauen Unterschiede im Verlauf und in der Ausprägung innerhalb der betroffenen Staaten erklären.
Dies fordert einleitend einen Grundlagenteil, in dem ein Überblick über die historische Entwicklung, sowie dem sich daraus ableitenden besonderen Aufbau der Europäischen Union, gegeben wird. Daran anschließend werden detailliert die aktuelle Ausgangslage, sowie der Verlauf der Staatsschuldenkrise in Irland analysiert. Mit den hieraus gewonnenen Ergebnissen, kann nun auch Italien analysiert werden. In beiden Fällen stehen die länderspezifischen Unterschiede besonders im Fokus.
Nach diesem analytischen Teil, werden bestehende Handlungsempfehlungen eruiert, sowie basierend auf den gewonnenen Ergebnissen selbst erarbeitete Ansätze konkretisiert. In Hinblick auf die Zukunft der Europäischen Union wird im abschließenden und letzten Kapitel ein resümierendes Fazit gezogen, sowie ein Ausblick in die Zukunft gewährt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Problemstellung
- 1.2. Zielsetzung und Aufbau
- 2. Thematische Grundlagen
- 2.1. Die Gründung der Europäischen Gemeinschaft
- 2.2. Der Vertrag von Maastricht
- 2.3. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt
- 3. Die Staatsschuldenkrise in Irland
- 3.1. Grundlagen der irischen Wirtschaft
- 3.2. Irland während und nach der Finanzkrise
- 4. Die Schuldenkrise in Italien
- 4.1. Grundlagen der Italienischen Wirtschaft
- 4.2 Italien während und nach der Finanzkrise
- 5. Handlungsempfehlungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der europäischen Staatsschuldenkrise und untersucht die Unterschiede im Verlauf und in der Ausprägung innerhalb der betroffenen Staaten. Sie beleuchtet die allgemeinen Gegebenheiten der Krise und analysiert detailliert die Situation in Irland und Italien, wobei die länderspezifischen Unterschiede im Vordergrund stehen. Basierend auf den gewonnenen Ergebnissen werden Handlungsempfehlungen eruiert und eigene Ansätze konkretisiert.
- Historische Entwicklung der Europäischen Union
- Analyse der Staatsschuldenkrise in Irland und Italien
- Länderspezifische Unterschiede der Staatsschuldenkrise
- Eruierung von Handlungsempfehlungen
- Ausblick auf die Zukunft der Europäischen Union
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung stellt die Problemstellung der europäischen Staatsschuldenkrise dar und erläutert die Notwendigkeit, die Unterschiede innerhalb der betroffenen Staaten zu untersuchen.
- Kapitel 2: Thematische Grundlagen: Dieses Kapitel liefert einen Überblick über die historische Entwicklung der Europäischen Union und beleuchtet die Strukturen, die zur Entstehung der Staatsschuldenkrise beigetragen haben.
- Kapitel 3: Die Staatsschuldenkrise in Irland: Dieses Kapitel analysiert die aktuelle Ausgangslage und den Verlauf der Staatsschuldenkrise in Irland, wobei die länderspezifischen Unterschiede im Fokus stehen.
- Kapitel 4: Die Schuldenkrise in Italien: Dieses Kapitel analysiert die Situation in Italien im Kontext der Staatsschuldenkrise und untersucht die länderspezifischen Unterschiede im Vergleich zu Irland.
- Kapitel 5: Handlungsempfehlungen: Dieses Kapitel erörtert bestehende Handlungsempfehlungen und entwickelt eigene Ansätze zur Bewältigung der Staatsschuldenkrise.
Schlüsselwörter
Europäische Staatsschuldenkrise, Irland, Italien, Finanzkrise, Europäische Union, Wirtschaftswachstum, Staatsschulden, Handlungsempfehlungen, Unterschiede, länderspezifische Besonderheiten.
Häufig gestellte Fragen
Wie unterschied sich die Schuldenkrise in Irland von der in Italien?
In Irland war die Krise primär eine Bankenkrise durch platzende Immobilienblasen, während Italien mit langfristig hoher Staatsverschuldung und geringem Wachstum kämpfte.
Was ist der Stabilitäts- und Wachstumspakt?
Eine Vereinbarung der EU-Staaten zur Sicherung der Haushaltsdisziplin, die Defizitobergrenzen (3% des BIP) und Schuldenstandsgrenzen (60% des BIP) festlegt.
Welche Rolle spielte der Vertrag von Maastricht?
Er legte die Konvergenzkriterien für die Einführung des Euro fest und schuf die rechtliche Basis für die europäische Wirtschafts- und Währungsunion.
Welche Handlungsempfehlungen gibt es zur Krisenbewältigung?
Diskutiert werden Strukturreformen, strengere Haushaltskontrollen durch die EU und Mechanismen wie der ESM zur Stabilisierung gefährdeter Staaten.
Wie beeinflusste die Finanzkrise 2008 die europäische Schuldenlage?
Die Rettung von Banken und Konjunkturprogramme führten zu einem massiven Anstieg der Staatsverschuldung, was die strukturellen Schwächen der Eurozone offenlegte.
- Citation du texte
- Tom Zeising (Auteur), 2017, Länderspezifische Ausprägungen und Unterschiede der europäischen Staatsschuldenkrise, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/372239