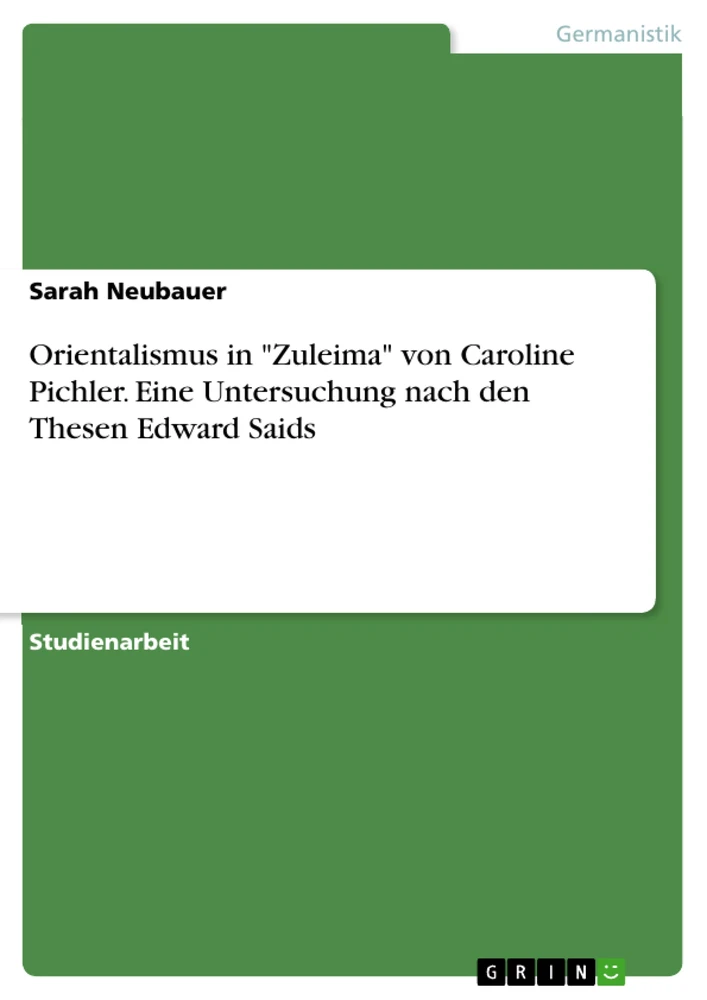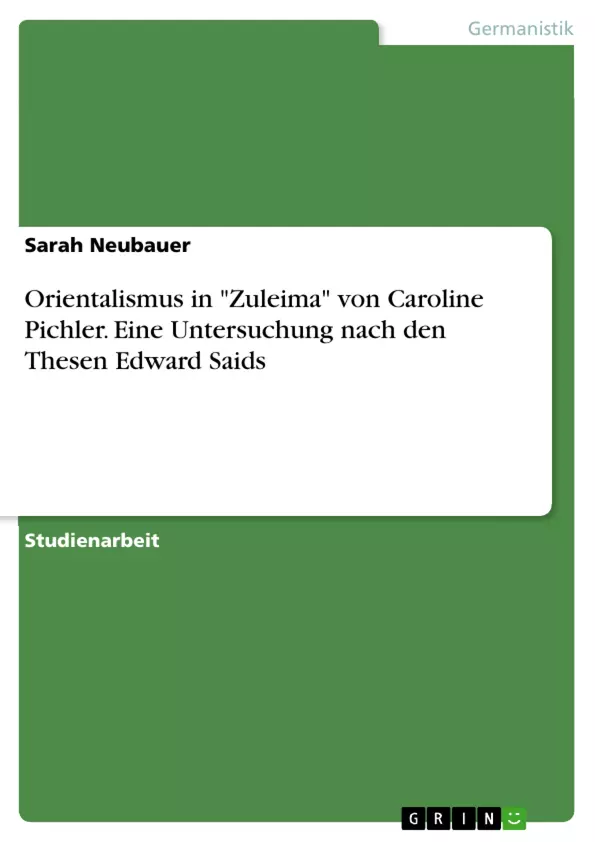In dem 1978 von Edward Said publizierten Werk Orientalismus thematisiert der Autor das Verhältnis zwischen Okzident und Orient, zwischen Herrscher und Beherrschten. So sei der Blick der europäisch-westlichen Gesellschaften auf Gesellschaften des Nahen Osten eurozentrisch und von Gefühlen der Überlegenheit sowie von Herrschaftswillen geprägt. Der Westen, der sich selbst als aufgeklärt empfindet, sieht den Orient dagegen als irrational, mysteriös und unaufgeklärt an, assoziiert diesen aber auch mit sexueller Lust und Sinnlichkeit und tendiert zudem oftmals dazu, den Orient romantisch zu verklären.
Auch in Caroline Pichlers Novelle Zuleima lassen sich Elemente auffinden, die den Orientalismus-Thesen Saids entsprechen: So wird der Orient unter anderem als besonders sinnlich und leidenschaftlich, jedoch in gewisser Weise auch als gefährlich dargestellt, außerdem erfolgt an einigen Textstellen eine romantische Verklärung desselben. Jedoch scheint die Novelle nicht durchgängig orientalistische Deutungsmuster zu beinhalten, da beispielsweise bestimmte Komponenten nicht dem von Edward Said beschriebenen Verhältnis zwischen Herrscher und Beherrschten entsprechen. Aus diesem Grunde geht die nachfolgende Hausarbeit der Frage nach, ob es sich bei dem Werk Caroline Pichlers nach Saids Thesen um einen orientalistischen Text handelt, beziehungsweise wo und warum in diesem orientalistische Deutungsmuster vorliegen (könnten).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zusammenfassung der zentralen Thesen des Werks Orientalismus Edward Saids
- Untersuchung der Novelle Zuleima Caroline Pichlers auf orientalistische Deutungsmuster
- Zusammenfassung der Ergebnisse
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob die Novelle Zuleima von Caroline Pichler nach den Thesen Edward Saids als orientalistischer Text zu betrachten ist. Im Fokus steht die Analyse der Novelle auf orientalistische Deutungsmuster, wobei insbesondere die Darstellung des Orients und die verschiedenen Erzählebenen berücksichtigt werden.
- Die Thesen Edward Saids zum Orientalismus
- Die Darstellung des Orients in Zuleima
- Die Rolle der Erzählebenen
- Die Positionen der Figuren
- Die Frage nach orientalistischen Deutungsmustern in Zuleima
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage der Arbeit dar, die sich mit der Frage beschäftigt, ob Caroline Pichlers Novelle Zuleima als orientalistischer Text zu verstehen ist.
- Zusammenfassung der zentralen Thesen des Werks Orientalismus Edward Saids: Dieses Kapitel fasst die zentralen Thesen des Werkes Orientalismus von Edward Said zusammen. Dabei wird die Beziehung zwischen Okzident und Orient als ein „hegemoniales Macht- und Herrschaftsverhältnis“ dargestellt. Der Blick auf den Orient aus westlicher Perspektive wird als eurozentrisch und von einem Überlegenheitsgefühl geprägt beschrieben. Der Orient wird als „anders“ dargestellt, sowohl negativ als auch romantisch verklärt. Said betont, dass der Orient ein reines Konstrukt ist, das durch westliche Denkmuster geschaffen wurde.
Schlüsselwörter
Orientalismus, Edward Said, Caroline Pichler, Zuleima, Novelle, Orient, Okzident, eurozentrischer Blick, Machtverhältnis, Herrschaftsverhältnis, Darstellung, Deutungsmuster, romantische Verklärung, Konstrukt.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Kernaussage von Edward Saids „Orientalismus“?
Said argumentiert, dass der „Orient“ ein westliches Konstrukt ist, das dazu dient, den Osten als irrational und minderwertig darzustellen, um die westliche Überlegenheit und Herrschaft zu rechtfertigen.
Wie wird der Orient in Caroline Pichlers Novelle „Zuleima“ dargestellt?
Der Orient wird als Ort der Sinnlichkeit, Leidenschaft und Gefahr gezeichnet, wobei auch Elemente der romantischen Verklärung vorkommen.
Entspricht „Zuleima“ vollständig Saids Orientalismus-Thesen?
Nicht durchgängig. Die Arbeit untersucht, ob bestimmte Figurenkonstellationen oder Erzählweisen vom typischen Herrschaftsverhältnis zwischen Okzident und Orient abweichen.
Was bedeutet „eurozentrischer Blick“?
Es bezeichnet die Beurteilung fremder Kulturen ausschließlich nach den Maßstäben und Werten der eigenen (westlichen) Gesellschaft, oft verbunden mit einem Überlegenheitsgefühl.
Warum ist der Orient laut Said ein „Konstrukt“?
Weil das westliche Bild des Orients wenig mit der Realität vor Ort zu tun hat, sondern aus Vorurteilen, literarischen Klischees und politischen Interessen zusammengesetzt wurde.
- Quote paper
- B.A. Sarah Neubauer (Author), 2015, Orientalismus in "Zuleima" von Caroline Pichler. Eine Untersuchung nach den Thesen Edward Saids, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/372445