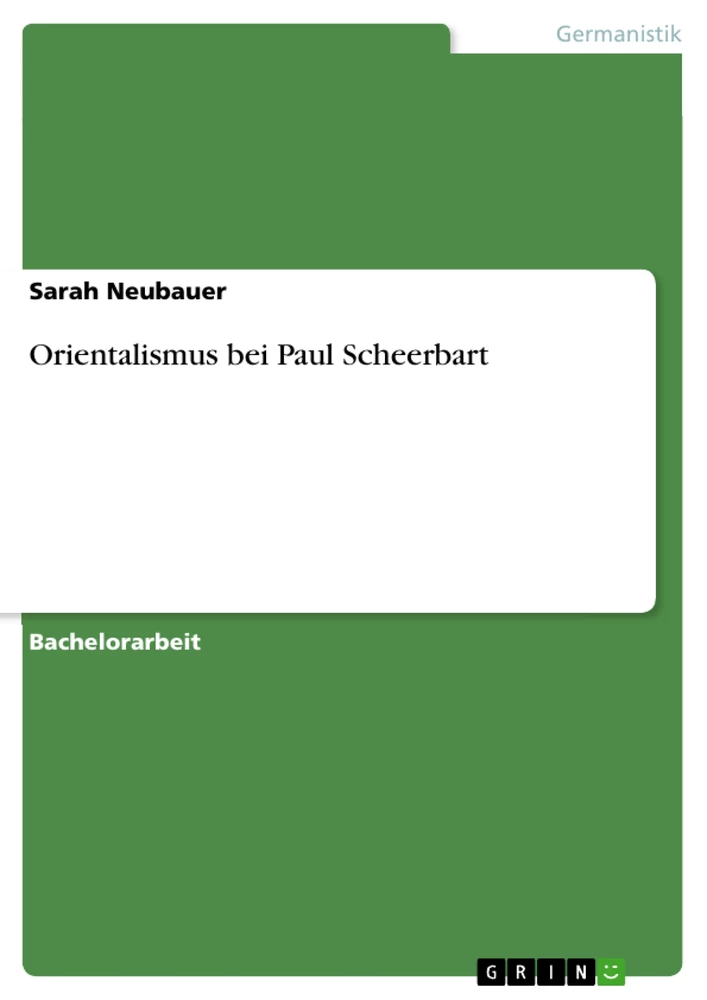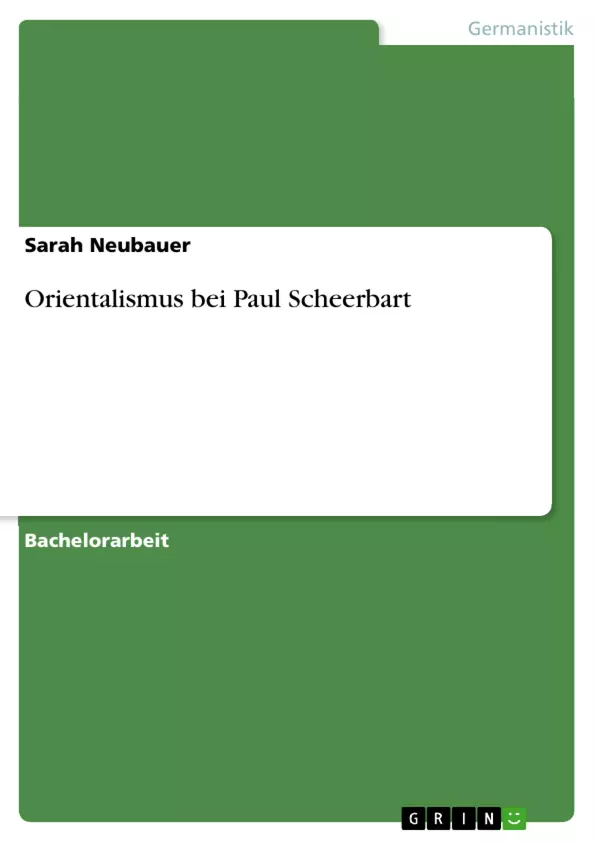Diese Arbeit geht der Frage nach, inwiefern es sich bei dem Roman "Tarub, Bagdads berühmte Köchin" und der Novelle "Weltmacht" Paul Scheerbarts um orientalistische Texte nach den Thesen Saids handelt, oder ob in diesen eher ein 'anderer Orientalismus', wie er von Polaschegg beschrieben wird, dargestellt wird. Es soll also untersucht werden, wie die Darstellung des Orients bei Scheerbart erfolgt und ob sie, beziehungsweise inwiefern sie, zu einer der durch Said und Polaschegg präsentierten Orient-Rezeptionen tendiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zusammenfassung der zentralen Thesen des Werks Orientalismus Edward Saids
- Zusammenfassung der zentralen Thesen des Werks Der andere Orientalismus: Regeln deutsch-morgenländischer Imagination im 19. Jahrhundert Andrea Polascheggs
- Untersuchung des Romans Tarub, Bagdads berühmte Köchin Paul Scheerbarts auf orientalistische Deutungsmuster nach den Thesen Saids und Polascheggs
- Untersuchung der Novelle Weltmacht Paul Scheerbarts auf orientalistische Deutungsmuster nach den Thesen Saids und Polascheggs
- Zusammenfassung der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht die Darstellung des Orients in den Werken Paul Scheerbarts, insbesondere in seinem Roman "Tarub, Bagdads berühmte Köchin" und seiner Novelle "Weltmacht". Dabei steht im Mittelpunkt, ob Scheerbarts Werke den Thesen des Orientalismus von Edward Said entsprechen oder ob sie eher dem "anderen Orientalismus" von Andrea Polaschegg zuzuordnen sind. Die Arbeit analysiert, wie Scheerbart den Orient darstellt und ob diese Darstellung mit den von Said und Polaschegg präsentierten Orient-Rezeptionen übereinstimmt.
- Orientalismus und "anderer Orientalismus" im Kontext von Scheerbarts Werken
- Analyse der orientalistischen Deutungsmuster in "Tarub, Bagdads berühmte Köchin"
- Untersuchung der orientalistischen Elemente in "Weltmacht"
- Vergleich der Ergebnisse mit den Thesen von Said und Polaschegg
- Bedeutung der orientalistischen Darstellung in Scheerbarts Schaffen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel zwei bietet eine knappe Zusammenfassung der zentralen Thesen des Werks "Orientalismus" von Edward Said. Kapitel drei befasst sich mit den zentralen Thesen von Andrea Polascheggs Werk "Der andere Orientalismus: Regeln deutsch-morgenländischer Imagination im 19. Jahrhundert". Kapitel vier analysiert den Roman "Tarub, Bagdads berühmte Köchin" auf orientalistische Deutungsmuster im Lichte der Thesen von Said und Polaschegg. Kapitel fünf untersucht die Novelle "Weltmacht" auf gleiche Weise. Kapitel sechs fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und beantwortet die Ausgangsfrage der Arbeit.
Schlüsselwörter
Orientalismus, "anderer Orientalismus", Edward Said, Andrea Polaschegg, Paul Scheerbart, Tarub, Bagdads berühmte Köchin, Weltmacht, Orient, Okzident, Morgenland, Abendland, deutsch-morgenländische Imagination, literarische Darstellung, Kulturvergleich.
Häufig gestellte Fragen
Was untersucht die Bachelorarbeit zum Orientalismus bei Paul Scheerbart?
Die Arbeit prüft, ob Scheerbarts Werke den Thesen von Edward Said entsprechen oder dem „anderen Orientalismus“ nach Andrea Polaschegg zuzuordnen sind.
Was sind die zentralen Thesen von Edward Saids „Orientalismus“?
Said beschreibt Orientalismus als ein westliches Konstrukt zur Beherrschung und Einordnung des Orients durch klischeehafte und machtgeladene Deutungsmuster.
Was versteht Andrea Polaschegg unter dem „anderen Orientalismus“?
Polaschegg analysiert spezifisch deutsch-morgenländische Imaginationsregeln des 19. Jahrhunderts, die sich von den machtpolitischen Ansätzen Saids unterscheiden können.
Welche Werke von Paul Scheerbart werden analysiert?
Untersucht werden der Roman „Tarub, Bagdads berühmte Köchin“ und die Novelle „Weltmacht“.
Wie erfolgt die Darstellung des Orients bei Scheerbart?
Die Arbeit analysiert, ob Scheerbart den Orient als exotisches Klischee nutzt oder ob seine literarische Darstellung eigene, innovative Wege geht.
Was ist das Ziel des Vergleichs zwischen Said und Polaschegg?
Ziel ist es, die literarische Orient-Rezeption Scheerbarts präzise in die kulturwissenschaftliche Debatte einzuordnen.
- Citar trabajo
- Sarah Neubauer (Autor), 2016, Orientalismus bei Paul Scheerbart, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/372448