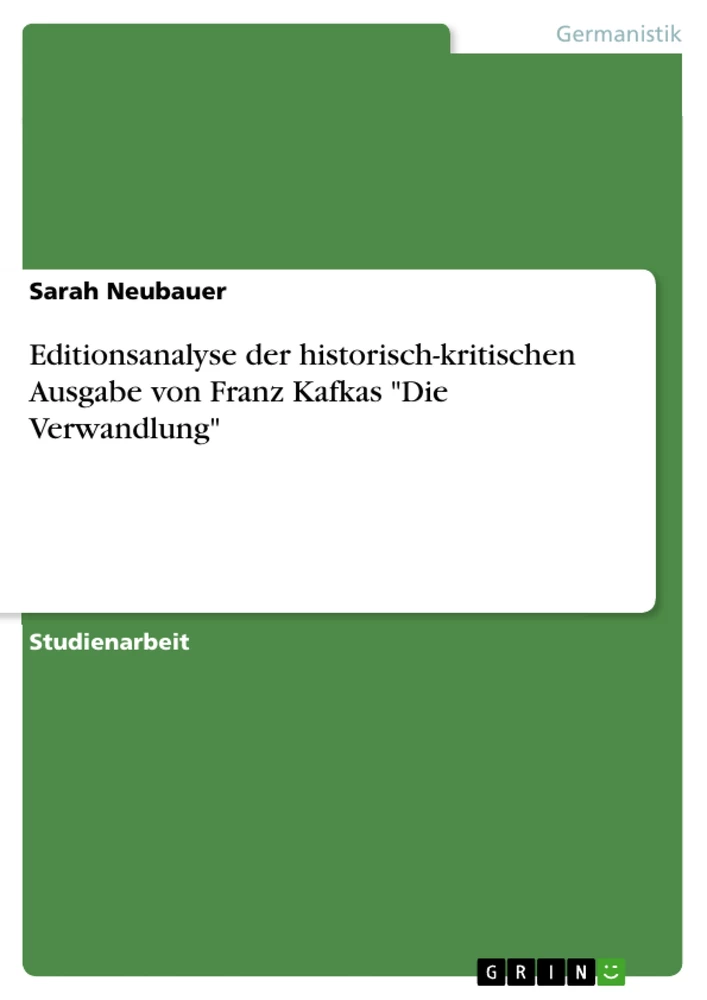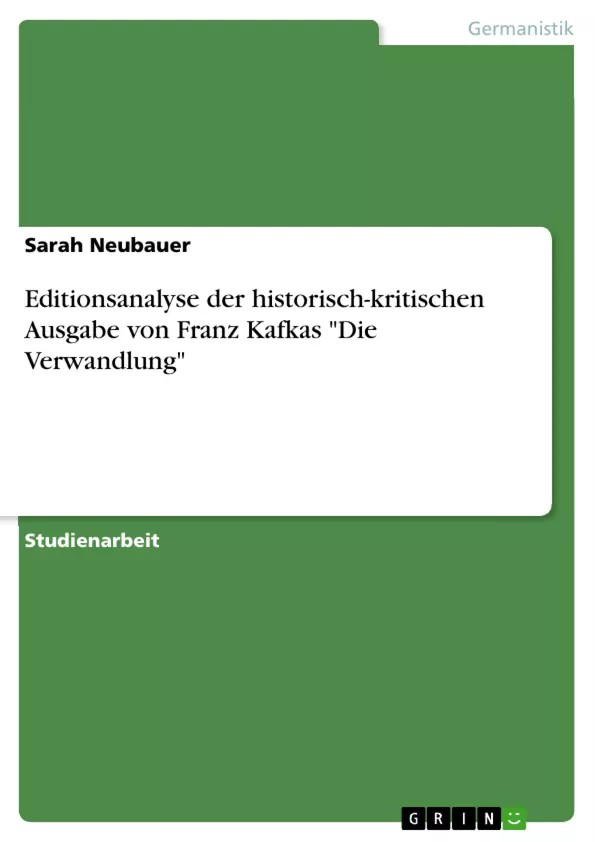Diese Arbeit widmet sich als Editionsanalyse der Untersuchung der historisch-kritischen Franz Kafka-Ausgabe der Verwandlung. Es sollen hierbei die verschiedenen Aspekte und Vorgehensweisen, die für das Erstellen einer Edition relevant sind, genauer untersucht werden. Dabei soll mit der Frankfurter Kafka-Ausgabe (FKA) als Beispiel insbesondere die konkrete Umsetzung editionswissenschaftlicher Praktiken analysiert werden.
Nach dieser kurzen Einleitung als Einstieg in die Thematik soll daher im zweiten Punkt die Textkonstitution der historisch-kritischen Franz Kafka-Ausgabe der Verwandlung beschrieben werden. Anschließend werden in einem dritten Punkt die verschiedenen Varianten und Variantenapparate vorgestellt, die die Edition umfasst. Dabei handelt es sich um die Leseausgabe (3.1) sowie um den Einblendungsapparat (3.2) und den Einzelstellenapparat (3.3). Danach werden im vierten Kapitel der Editionsanalyse die Beitexte und der Editionsvorgang im Fokus des Interesses stehen. Genauer gesagt wird dabei der Prospekt (4.1) untersucht, aber auch die textkritischen Zeichen (4.2). Platz für Kritik und Verbesserungsvorschläge bietet dagegen das fünfte Kapitel. Hier wird die FKA als Editionsbeispiel kritisch reflektiert und es werden mögliche Alternativen vorgestellt. In einem sechsten Punkt erfolgt dann die Zusammenfassung der gewonnenen Erkenntnisse aus der vorangegangenen Analyse. Mit dem siebten und letzten Kapitel, dem Literaturverzeichnis, schließt die Arbeit letztlich ab.
Franz Kafkas Erzählung „Die Verwandlung“ erschien im Jahr 2003 im Stroemfeld als historisch-kritische Franz Kafka-Ausgabe. Herausgegeben wurde die FKA dabei von Roland Reuß und Peter Staengle. Die Edition wurde zum Teil sogar als revolutionär empfunden, da sie mitunter Faksimiles des gesamten Manuskripts der Verwandlung Kafkas beinhaltet, wodurch ein unverfälschter Einblick in die Textgenese gewährt wird. Zu sehen sind diese Faksimiles jedoch auch auf einer beiliegenden CD-ROM. Dementsprechend macht sich die FKA die Vorteile dieses elektronischen Mediums zunutze und zeigt sich als Edition zwischen Tradition und Moderne: man nutzt als Zusatz zum gedruckten Medium ebenfalls neue Techniken, um das Alte dauerhafter konservieren zu können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Textkonstitution
- Varianten und Variantenapparate
- Die Leseausgabe
- Der Einblendungsapparat
- Der Einzelstellenapparat
- Beitexte und Editionsvorgang
- Der Prospekt
- Die textkritischen Zeichen
- Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die historisch-kritische Ausgabe von Franz Kafkas "Die Verwandlung" und untersucht die verschiedenen Aspekte und Vorgehensweisen, die für das Erstellen einer Edition relevant sind. Dabei wird insbesondere die konkrete Umsetzung editionswissenschaftlicher Praktiken anhand der Frankfurter Kafka-Ausgabe (FKA) analysiert.
- Die Textkonstitution der FKA und ihre verschiedenen Bestandteile
- Die verschiedenen Varianten und Variantenapparate, die in der Edition enthalten sind
- Die Bedeutung von Beitexten und Editionsvorgang für die Interpretation der Verwandlung
- Die Rolle der Faksimile-Edition und des elektronischen Mediums in der Editionswissenschaft
- Die kritische Reflexion der FKA als Editionsbeispiel und mögliche Alternativen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik der Editionsanalyse ein und stellt die historisch-kritische Ausgabe von Franz Kafkas "Die Verwandlung" (FKA) vor. Die Arbeit widmet sich der Untersuchung der verschiedenen Aspekte und Vorgehensweisen, die für das Erstellen einer Edition relevant sind.
Textkonstitution
Dieses Kapitel beschreibt die Textkonstitution der FKA, die insgesamt drei Hefte umfasst. Das erste Heft enthält eine Leseausgabe, das zweite Heft ist eine Faksimile-Edition mit diplomatischen Umschriften, und das dritte Heft beinhaltet den Text mit zusätzlichen Informationen zur Entstehungsgeschichte.
Varianten und Variantenapparate
Dieses Kapitel stellt die verschiedenen Varianten und Variantenapparate der FKA vor. Dazu gehören die Leseausgabe, der Einblendungsapparat und der Einzelstellenapparat. Die einzelnen Varianten und Apparate werden näher erläutert und ihre Bedeutung für die Edition dargestellt.
Beitexte und Editionsvorgang
Dieses Kapitel untersucht die Beitexte und den Editionsvorgang der FKA. Es wird der Prospekt als wichtiger Bestandteil der Edition analysiert, sowie die textkritischen Zeichen, die in der Edition verwendet werden.
Schlüsselwörter
Historisch-kritische Ausgabe, Franz Kafka, Die Verwandlung, Frankfurter Kafka-Ausgabe (FKA), Editionswissenschaft, Textkonstitution, Variantenapparat, Faksimile-Edition, Beitexte, Editionsvorgang, Textgenese, Leseausgabe, diplomatische Umschrift.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Besondere an der Frankfurter Kafka-Ausgabe (FKA)?
Die FKA gilt als revolutionär, da sie vollständige Faksimiles der Manuskripte (z. B. von "Die Verwandlung") enthält und so einen unverfälschten Blick auf die Textgenese ermöglicht.
Wie ist die Textkonstitution dieser Ausgabe aufgebaut?
Die Ausgabe umfasst meist drei Teile: eine Leseausgabe, eine Faksimile-Edition mit diplomatischen Umschriften und einen textkritischen Apparat.
Was versteht man unter einem "Variantenapparat"?
Ein Variantenapparat dokumentiert alle Änderungen, Streichungen und Korrekturen, die der Autor während des Schreibprozesses am Text vorgenommen hat.
Welche Rolle spielt die beigelegte CD-ROM?
Die CD-ROM nutzt die Vorteile elektronischer Medien, um die Faksimiles digital zugänglich zu machen und die Textgenese interaktiv erforschbar zu machen.
Wer sind die Herausgeber der FKA von "Die Verwandlung"?
Die historisch-kritische Ausgabe wurde von Roland Reuß und Peter Staengle im Stroemfeld Verlag herausgegeben.
- Quote paper
- Sarah Neubauer (Author), 2017, Editionsanalyse der historisch-kritischen Ausgabe von Franz Kafkas "Die Verwandlung", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/372854