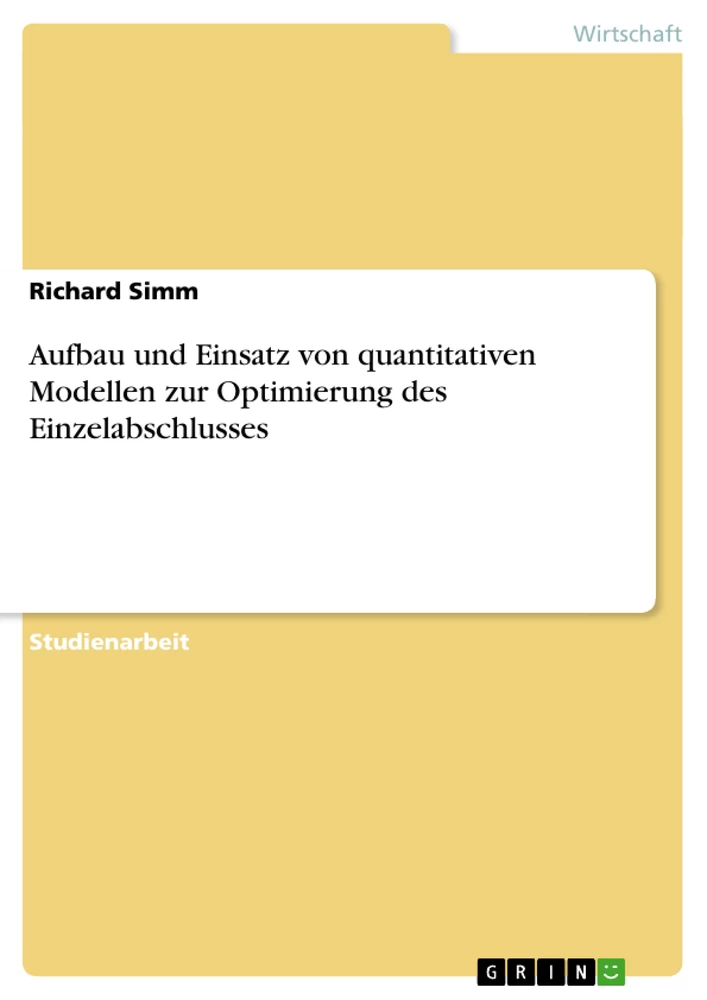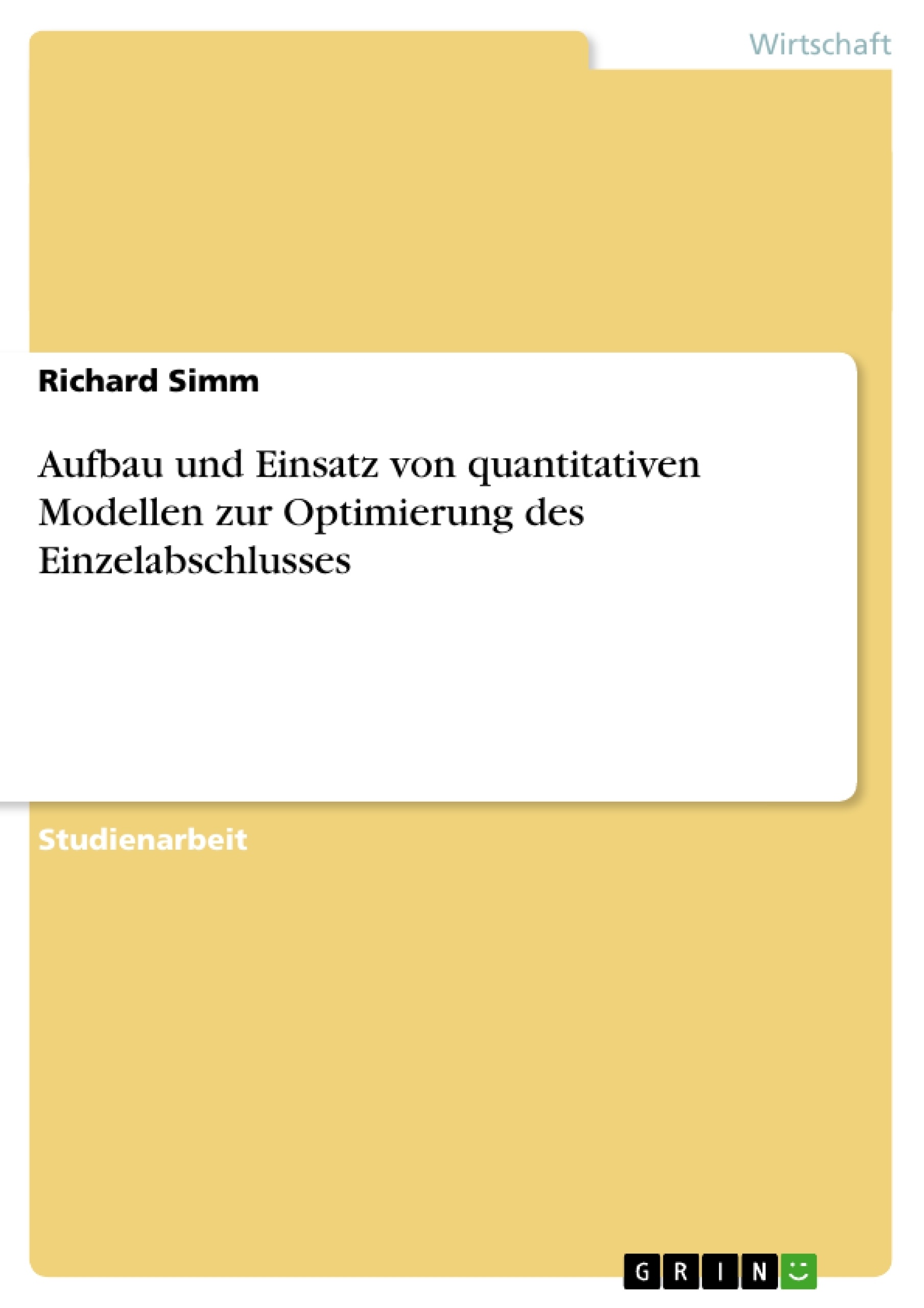Einleitung
Die Grundlage für die hier vorgelegte Seminararbeit bildet die Verknüpfung eines mathematischen Entscheidungsmodells1 mit dem Einsatz einer gezielten Bilanzpolitik bzw. Rechnungslegungspolitik im Rahmen der Aufstellung eines Jahresabschlusses gemäß § 264 i.V.m. § 242 HGB. Abgeleitet von dem Anspruch der modernen Betriebswirtschaftslehre2 soll diese Verknüpfung einen Beitrag zur Optimierung der Rechnungslegungspolitik darstellen, indem für den Entscheidungsträger ein Modell entwickelt wird, mit dem er eine Entscheidungssituation zwischen mehreren Alternativen, die auf die aktuelle Darstellung der Bilanz oder auf deren zukünftige Entwicklung einwirken, lösen kann.3 Demnach wird der betriebswirtschaftlichen Praxis als Entscheidungsträger ein Werkzeug angeboten, das eine möglichst geringe Abweichung von der aufgestellten Zielsetzung unter bestmöglicher Ausnutzung der von dem Gesetzgeber erlaubten Instrumentarien, sprich Alternativen wie z.B. Wahlrechten und Ermessenspielräumen, garantiert. Mit der Entwicklung von leistungsstarker Software für den Personal Computer liegt es an der betriebswirtschaftlichen Modellkonzipierung, den oben aufgestellten Anspruch der Optimierung zu erfüllen. 4 Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht das viertel Kapitel mit dem Aufbau und Einsatz sowie einem Beispiel für mathematische Optimierungsmodelle, die inhaltlich an die Forschungsarbeiten5 von Freidank angelehnt sind. Durch die in Kapitel zwei und drei beschriebenen Themenkomplexe wird die inhaltliche Grundlage für die Ausgestaltung der mathematischen Optimierungsmodelle geschaffen. Aufbauend auf dem Begriff der Rechnungslegungspolitik im handelsrechtlichen Einzelabschluss werden zunächst die möglichen traditionellen Zielsetzungen für die Rechnungslegungspolitik in Kapitel zwei ermittelt. Einen besonderen Aspekt stellen die Einflussmöglichkeiten des Shareholder Value-Ansatzes dar. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit dem möglichen rechnungslegungspolitischen Instrumentarium für den Jahresabschluss und den Lagebericht. Aus aktuellem Anlass wird die mögliche Ausgestaltung des in der zweiten Hälfte des Jahres 2004 geplanten Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes betrachtet.6 Die Arbeit wird mit der Schlussbetrachtung und einem Ausblick abgerundet, der u.a. auf die Einsatzmöglichkeiten von Optimierungsmodellen für die internationale Rechnungslegung eingeht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Rechnungslegungspolitik im handelrechtlichen Einzelabschluss
- Objekte, Funktion und Adressaten des Jahresabschlusses als Grundlage für die Rechnungslegungspolitik
- Der Begriff der Rechnungslegungspolitik
- Zielsetzungen für die Rechnungslegungspolitik
- Grundlegendes
- Aus der Finanzpolitik abgeleitete Zielsetzungen
- Beeinflussung zivilrechtlicher Ansprüche
- Regulation öffentlich-rechtlicher Ansprüche
- Aus den Individualvorstellungen des Managements abgeleitete Zielsetzungen
- Aus der Publizitätspolitik abgeleitete Zielsetzungen
- Die Integration des Shareholder Value-Ansatzes in den Zielplan der Rechnungslegungspolitik
- Instrumente der Rechnungslegungspolitik
- Grundlegendes
- Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen
- Sachverhaltsdarstellende Maßnahmen
- Formelle Instrumente
- Materielle Instrumente
- Grundlegendes
- Ermessensspielräume
- Wahlrechte
- Bilanzansatzwahlrechte
- Bewertungswahlrechte
- Ausweiswahlrechte
- Mögliche Ausgestaltung des geplanten Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes
- Optimierungsmodelle für den handelsrechtlichen Jahresabschluss
- Grundlegendes
- Entscheidungsmodelle für den Jahresabschluss
- Allgemeines
- Zielfunktion
- Festlegung der Restriktionen
- Ausgewählte Jahresabschlusskennzahlen als Restriktionen
- Weitere Restriktionen
- Restriktionen der erfolgswirksamen Aktionsparameter
- Lösungsmöglichkeiten
- Anwendung des Modells an einem Beispiel
- Darstellung der Ausgangslage
- Ergebnisse der Optimierung
- Ausblick und Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Optimierung des handelsrechtlichen Einzelabschlusses mithilfe von quantitativen Modellen. Sie analysiert die Rechnungslegungspolitik im Rahmen des Jahresabschlusses und untersucht die Instrumente, die zur Gestaltung des Jahresabschlusses eingesetzt werden können. Dabei werden insbesondere die Möglichkeiten der Optimierung durch die Anwendung von Entscheidungsmodellen beleuchtet.
- Rechnungslegungspolitik und ihre Zielsetzungen
- Instrumente der Rechnungslegungspolitik
- Quantitative Modelle zur Jahresabschlussoptimierung
- Anwendungsbeispiele für Optimierungsmodelle
- Bedeutung des Shareholder Value-Ansatzes
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und erläutert die Relevanz der Jahresabschlussoptimierung. Kapitel 2 beleuchtet die Rechnungslegungspolitik im handelsrechtlichen Einzelabschluss und behandelt die Objekte, die Funktion und die Adressaten des Jahresabschlusses sowie die verschiedenen Zielsetzungen der Rechnungslegungspolitik. Kapitel 3 beschäftigt sich mit den Instrumenten der Rechnungslegungspolitik, wobei sowohl sachverhaltsgestaltende als auch sachverhaltsdarstellende Maßnahmen betrachtet werden. Hierbei werden auch die Möglichkeiten der Gestaltung durch formelle und materielle Instrumente, insbesondere durch Wahlrechte, beleuchtet. Kapitel 4 stellt verschiedene Optimierungsmodelle für den handelsrechtlichen Jahresabschluss vor. Dabei werden die Voraussetzungen für den Einsatz dieser Modelle, die Vorgehensweise bei der Optimierung sowie die Anwendung des Modells an einem konkreten Beispiel erläutert.
Schlüsselwörter
Rechnungslegungspolitik, Jahresabschluss, Einzelabschluss, Optimierung, Quantitative Modelle, Entscheidungsmodelle, Restriktionen, Zielfunktion, Shareholder Value, Bilanzrechtsmodernisierung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel quantitativer Modelle in der Rechnungslegung?
Ziel ist die Optimierung der Rechnungslegungspolitik. Mathematische Entscheidungsmodelle helfen dabei, unter Ausnutzung gesetzlicher Wahlrechte und Ermessensspielräume die beste Alternative für die Bilanzgestaltung zu finden.
Welche Instrumente nutzt die Rechnungslegungspolitik?
Man unterscheidet sachverhaltsgestaltende Maßnahmen (vor dem Bilanzstichtag) und sachverhaltsdarstellende Maßnahmen. Letztere umfassen formelle und materielle Instrumente wie Bilanzansatz- und Bewertungswahlrechte.
Was versteht man unter einer Zielfunktion im Optimierungsmodell?
Die Zielfunktion definiert das mathematische Ziel der Optimierung, beispielsweise die Minimierung der Steuerlast oder die Maximierung des ausgewiesenen Gewinns im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten.
Wie beeinflusst der Shareholder Value-Ansatz den Jahresabschluss?
Der Shareholder Value-Ansatz integriert die Interessen der Eigenkapitalgeber in den Zielplan der Rechnungslegungspolitik, was oft eine stärkere Fokussierung auf die Darstellung der Ertragskraft zur Folge hat.
Welche Rolle spielen Restriktionen in diesen Modellen?
Restriktionen sind Nebenbedingungen, die eingehalten werden müssen. Dazu zählen gesetzliche Vorschriften des HGB, steuerliche Regelungen oder einzuhaltende Kennzahlen (z.B. Mindesteigenkapitalquote).
- Quote paper
- Richard Simm (Author), 2004, Aufbau und Einsatz von quantitativen Modellen zur Optimierung des Einzelabschlusses, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/37312