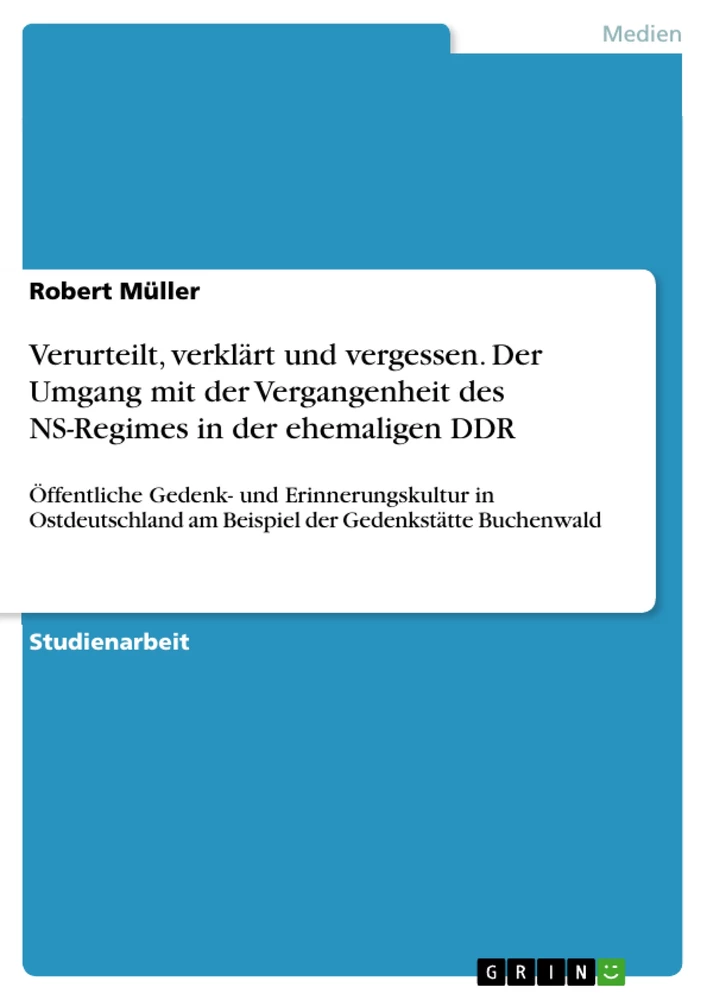Diese Arbeit macht es sich zur Aufgabe den Umgang mit der Vergangenheit des NS-Regimes in der ehemaligen DDR und die öffentliche Gedenk- und Erinnerungskultur in Ostdeutschland am Beispiel der Gedenkstätte Buchenwald nachzuvollziehen.
Zunächst wird hierbei auf die verschiedenen Phasen der Auseinandersetzung mit der national-sozialistischen Vergangenheit in der DDR eingegangen, bevor die Gedenkstättenpolitik des SED-Staates in ihrer Funktion als Mittel zur Rechtfertigung des eigenen Bestehens untersucht wird. Im Folgenden wird konkret die Nationale Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald, ihre Entstehung, ihre Konzeption und die in ihr vorgefundenen Elemente sowohl unter gestalterischen als auch inhaltlichen Gesichtspunkten betrachtet, analysiert und bewertet. Abschließend soll der Umgang mit der Gedenkstätte, einem Ort mit eben jener bereits angedeuteten mehrfachen Vergangenheit, nach dem Zusammenbruch der DDR und in Zukunft Gegenstand der Auseinandersetzung sein.
Weimar in Thüringen. Der Ettersberg. Ein Ort mit vielfacher Vergangenheit. Nicht nur sollen hier bereits Goethe und vielleicht auch Schiller, die beiden Ikonen der deutschen Klassik, die mit die größten Schätze des deutschen Kulturgutes schufen, bereits unter den dichten Bäumen des Buchenwalds unweit der Ettersburg gewandelt sein. Auch wurde eben jener Buchenwald Schauplatz von Verbrechen gegen alles, was die Menschheit, die vermeintliche Krönung der Schöpfung, glaubte, sich im Laufe ihres Daseins als verbindliche Ideale und Grundwerte errungen zu haben. Verbrechen, denen Worte nicht gerecht werden. Doch zeichnet sich dieser Ort des Grauens durch eine Besonderheit aus: Seine „doppelte Vergangenheit“.
Inhaltsverzeichnis
- Verurteilt, verklärt und vergessen – der Ettersberg bei Weimar und seine Vergangenheit
- Nach der „Stunde null“ - Der Umgang mit der NS-Vergangenheit in der SBZ und der DDR
- Die frühe Nachkriegszeit (1945 - 1948/49)
- Nach der Staatsgründung und während des Kalten Krieges
- Das Verhältnis zu den verschiedenen Opfergruppen
- Die Suche nach Selbstlegitimation – die Mahn- und Gedenkstättenpolitik der DDR
- Nach 1945 bis zum Beginn der 50er Jahre – „Spontaner Antifaschismus“
- Bis zum Ende der 50er Jahre – Zentralisierung und Mythisierung
- Bis 1989 – „Erstarrtes Gedenken“
- Die Lager im Buchenwald und das Gedenken an sie
- Der lange Weg zur Entstehung der Nationalen Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald
- „Durch Sterben und Kämpfen zum Sieg\" - ein Rundgang durch die Anlage des Mahnmals
- Das Umdenken in den 1980er Jahren
- Das böse Erwachen nach dem Ende der DDR – die Umgestaltung und Neukonzeption der Gedenkstätte
- Der Umgang mit der „doppelten Vergangenheit“ - die Zukunft von Gedenkstätten wie Buchenwald
- Der Umgang der DDR mit der NS-Vergangenheit
- Die Gedenkstättenpolitik des SED-Staates
- Die Nationale Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald
- Die „doppelte Vergangenheit“ von Buchenwald
- Die Zukunft von Gedenkstätten in Ostdeutschland
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Umgang der DDR mit der NS-Vergangenheit und der öffentlichen Gedenk- und Erinnerungskultur in Ostdeutschland am Beispiel der Gedenkstätte Buchenwald. Die Untersuchung analysiert die verschiedenen Phasen der Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit in der DDR und beleuchtet die Gedenkstättenpolitik des SED-Staates in ihrer Funktion als Mittel zur Rechtfertigung des eigenen Bestehens. Im Fokus steht die Nationale Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald, ihre Entstehung, ihre Konzeption und die in ihr vorgefundenen Elemente sowohl unter gestalterischen als auch inhaltlichen Gesichtspunkten. Abschließend wird der Umgang mit der Gedenkstätte nach dem Zusammenbruch der DDR und in Zukunft betrachtet.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die besondere Vergangenheit des Ettersbergs bei Weimar, die durch die Verbrechen des Nazi-Regimes und die Nutzung als sowjetisches Speziallager geprägt ist. Das zweite Kapitel analysiert den Umgang mit der NS-Vergangenheit in der SBZ und der DDR in verschiedenen Phasen, insbesondere die Entnazifizierung und die Rolle der sowjetischen Speziallager. Das dritte Kapitel untersucht die Gedenkstättenpolitik der DDR, die zur Selbstlegitimation des Staates genutzt wurde. Im vierten Kapitel wird die Entstehung, Konzeption und Gestaltung der Nationalen Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald beleuchtet. Das fünfte Kapitel befasst sich mit dem Umgang mit der Gedenkstätte Buchenwald nach dem Ende der DDR und in Zukunft.
Schlüsselwörter
NS-Vergangenheit, DDR, Gedenkstättenpolitik, Selbstlegitimation, Buchenwald, „doppelte Vergangenheit“, Erinnerungskultur, Ostdeutschland.
- Quote paper
- Robert Müller (Author), 2013, Verurteilt, verklärt und vergessen. Der Umgang mit der Vergangenheit des NS-Regimes in der ehemaligen DDR, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/373174