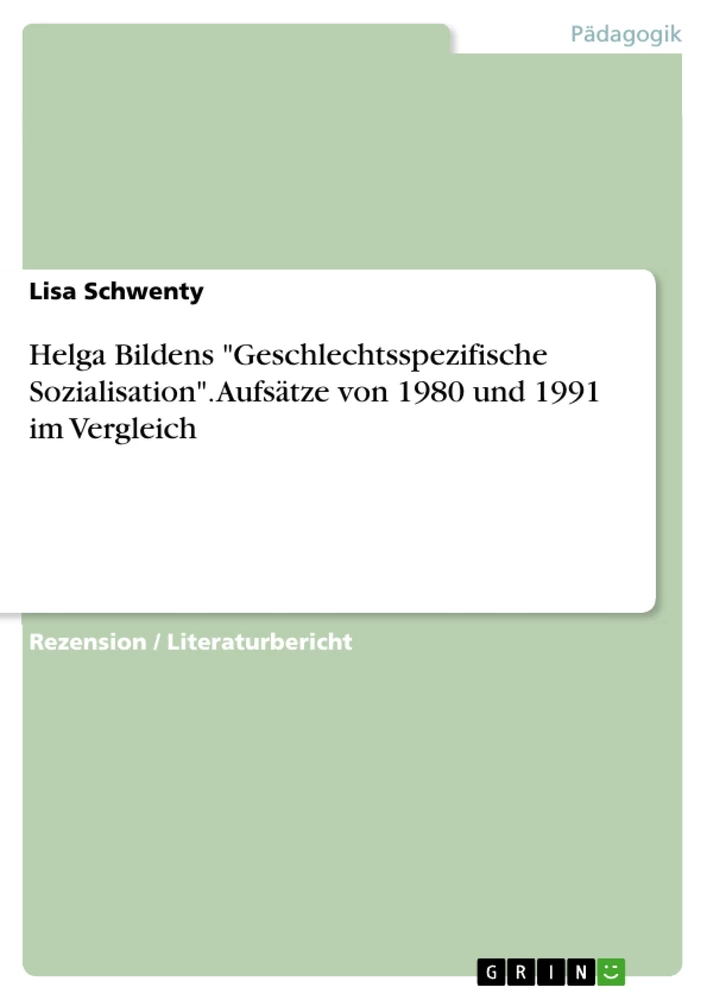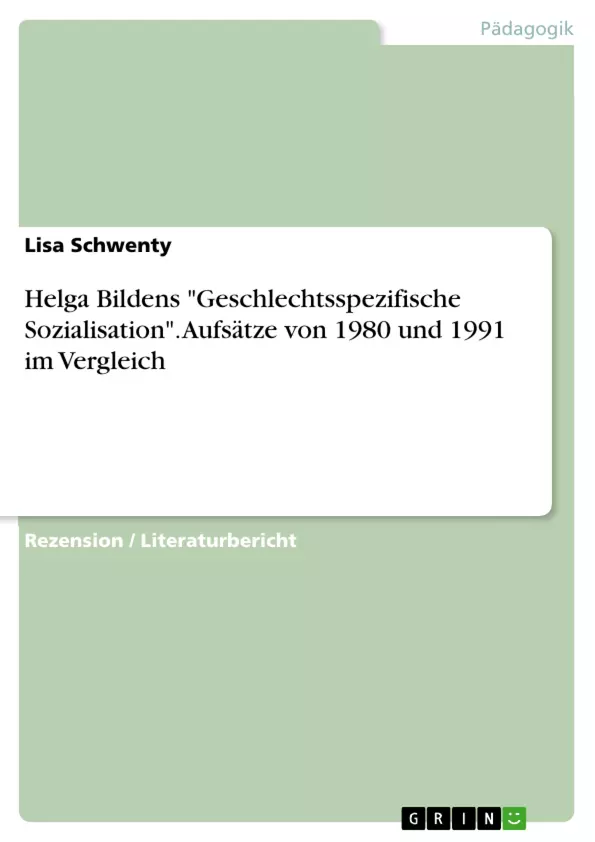Noch heute wird in vielen Büchern und Filmen mit Geschlechterrollen gespielt, auch im Alltag begegnen uns täglich Stereotype. Es stellt sich die Frage, woher diese Denkweisen sowie mögliche geschlechtsspezifische Unterschiede eigentlich kommen. Sind Unterschiede angeboren oder werden sie anerzogen? Inwieweit spielt Prägung durch die Gesellschaft eine Rolle bei der geschlechtsbezogenen Identitätsbildung?
Helga Bilden zählt zu den Personen, die sich schon vor mehreren Jahrzehnten mit den Hintergründen von Stereotypenbildung auseinander gesetzt haben. Die vorliegende Arbeit untersucht zwei Beiträge zur "Geschlechtsspezifischen Sozialisation'', die davon handeln, wie sich Menschen im Zusammenspiel mit ihrer Umwelt gesellschaftlich und kulturell geprägt zu Männern und Frauen entwickeln.
Bilden definiert Sozialisation als einen Prozess, der ,,aus einem Neugeborenen ein in seiner Gesellschaft handlungsfähiges Subjekt'' (1991, S. 279) konstruiert. In den beiden hier behandelten Publikationen setzt sie sich mit Aneignungsprozessen, dem Zusammenhang von Sozialisation und Geschlecht, und der Frage, woher angebliche oder auch empirisch beobachtete geschlechtsspezifische Unterschiede stammen auseinander. Auf dieser Grundlage versucht sie, die Entstehung bestimmter Differenzen zu erklären. Weiterhin thematisiert sie Geschlechterrollen, Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern, das Frauenbild, die Identitätsbildung und auch die Sozialstruktur der Gesellschaft.
Die Entscheidung für die beiden Publikationen Helga Bildens habe ich getroffen, da mich neben den unterschiedlichen Ansichten zur Forschung der menschlichen Entwicklung und den Sozialisationsprozessen vor allem interessiert, wie sich die gesellschaftlichen Vorstellungen sowie der Blick auf die Thematik gewandelt haben. Deshalb werde ich im Folgenden zwei Texte der gleichen Autorin zum gleichen Thema untersuchen, die jedoch im zeitlichen Abstand von elf Jahren entstanden sind.
Nach dieser kurzen Einführung in das Thema folgt zunächst eine knappe Vorstellung der Autorin. Dabei werde ich mich ausschließlich auf die Bereiche beziehen, die relevant sind, um ihr Interessengebiet und ihr Anliegen in den zugrundeliegenden Texten vorzustellen. Danach beginne ich, die beiden behandelten Beiträge separat vorzustellen, zunächst den von 1980 und im Anschluss den elf Jahre später erschienenen Text von 1991.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vorstellung der Autorin
- Geschlechtsspezifische Sozialisation 1980
- Geschlechtsspezifische Sozialisation 1991
- Vergleich
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert zwei Beiträge Helga Bildens zur „Geschlechtsspezifischen Sozialisation“, die sich mit der Entstehung geschlechtsspezifischer Unterschiede und der Identitätsbildung im Kontext von Sozialisationsprozessen auseinandersetzen. Ziel ist es, die Entwicklung der gesellschaftlichen Vorstellungen und den Blick auf die Thematik im zeitlichen Abstand von elf Jahren zu untersuchen.
- Sozialisationsprozesse und ihre Auswirkungen auf die geschlechtsspezifische Identitätsbildung
- Die Rolle von gesellschaftlichen Normen und Werten in der Entstehung von Geschlechterrollen
- Der Einfluss der Arbeitsteilung auf die Sozialisation von Männern und Frauen
- Die Bedeutung von Bildungseinrichtungen und der Familie in der geschlechtsspezifischen Sozialisation
- Die Entwicklung der Geschlechterforschung und die Veränderung von Konzepten und Begrifflichkeiten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der geschlechtsspezifischen Sozialisation ein und stellt die beiden zu untersuchenden Texte von Helga Bilden vor.
Die Vorstellung der Autorin gibt einen kurzen Überblick über Helga Bildens Lebenslauf und ihre Arbeitsschwerpunkte, insbesondere im Bereich der Geschlechterforschung.
Die Zusammenfassung des Textes „Geschlechtsspezifische Sozialisation“ aus dem Jahr 1980 beleuchtet Bildens Grundvorstellungen zur Sozialisation, die Rolle des biologischen Geschlechts, die Entstehung von Geschlechterrollen und die Bedeutung der Arbeitsteilung.
Die Zusammenfassung des Textes „Geschlechtsspezifische Sozialisation“ aus dem Jahr 1991 behandelt die Weiterentwicklung von Bildens Ansichten, den Einfluss der Frauenbewegung auf die Geschlechterforschung und die Bedeutung von Bildung und Familie in der Sozialisation.
Schlüsselwörter
Geschlechtsspezifische Sozialisation, Geschlechterrollen, Identitätsbildung, Sozialisationsprozesse, Arbeitsteilung, Geschlechterforschung, Frauenbewegung, Familienstrukturen, Bildungseinrichtungen, gesellschaftliche Normen und Werte.
- Quote paper
- Lisa Schwenty (Author), 2014, Helga Bildens "Geschlechtsspezifische Sozialisation". Aufsätze von 1980 und 1991 im Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/373209