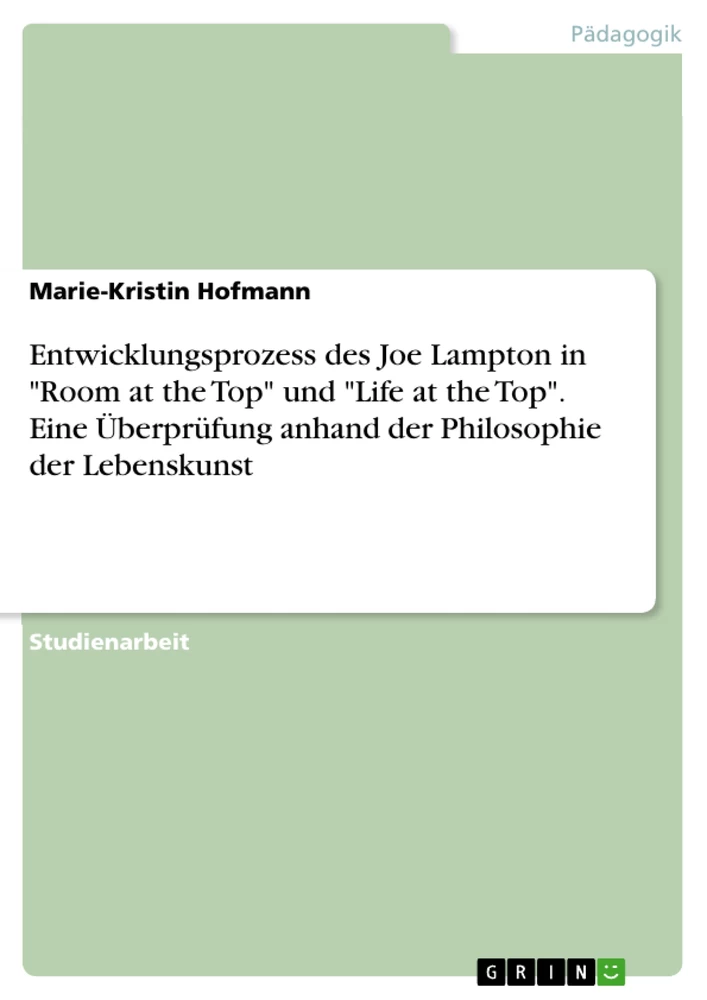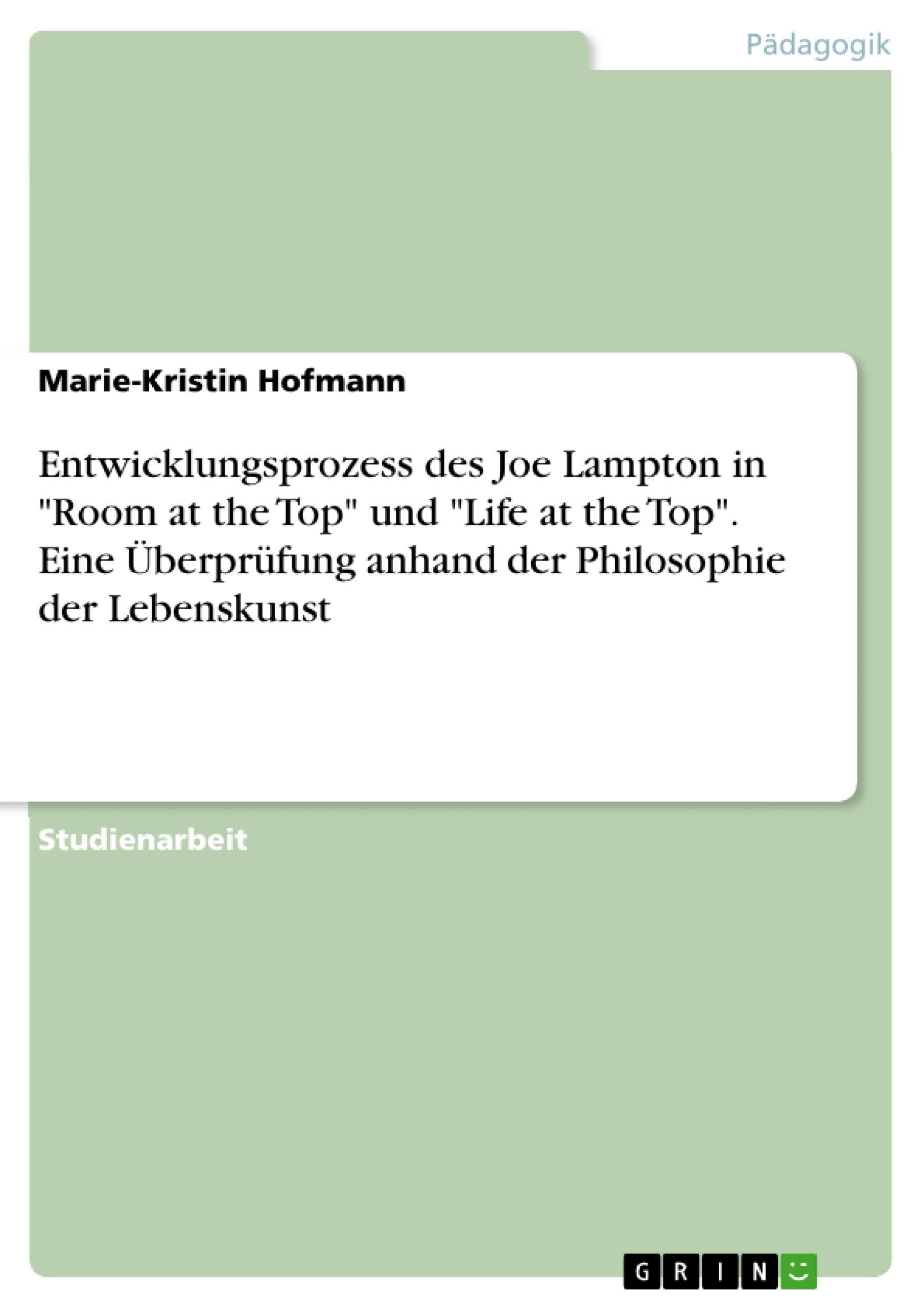Der Philosoph Wilhelm Schmid hat in seinen philosophischen Schriften das Kriterium des Bejahenswerten etabliert. Können wir unser Leben bejahen, dann ist es erstrebenswert. In diesem Sinne versucht Schmid in der Philosophie eine neue Lebenskunst zu begründen, die dem Menschen Möglichkeiten zur Gestaltung des eigenen Lebens eröffnet.
Diese Arbeit fasst die wichtigsten Aspekte seiner Lebenskunst zusammen, die eine Bedeutung für das Leben des Hauptprotagonisten Joe Lampton in der Dilogie "Room at the Top" und "Life at the Top" haben. Die literarische Analyse behandelt dann die Frage, ob sich Joe in seiner Art der Lebensführung im Verlauf der beiden Bücher positiv entwickelt hat. Dementsprechend werden beide Werke im Anschluss an die Behandlung der Aspekte Schmids hinsichtlich dieser überprüft und letztlich miteinander verglichen. Hierbei wird analysiert, inwiefern Joes Leben als bejahenswert betrachtet werden kann oder nicht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung: Das Kriterium des Bejahenswerten
- Zusammenfassung der Aspekte der Lebenskunst nach Schmid...
- 2. Das Selbst und die Anderen....
- 2.1 Beziehungen zu Anderen
- 2.1.1 Beziehungen zu Anderen
- 2.1.2 Die Sorge um sich und Andere
- 2.2 Die Frage der Wahl..
- 2.2.1 Der Akt der Wahl
- 2.2.2 Arten der Wahl.
- 3. Analyse: Room at the top.
- 3.1 Arten der Wahl
- 3.2 Reflexion
- 3.3 Beziehungen zu Anderen..
- 3.4 Sorge um Andere....
- 4. Analyse: Life at the top
- 4.1 Arten der Wahl
- 4.2 Reflexion.
- 4.3 Beziehungen zu Anderen..
- 4.4 Sorge um Andere ........
- 5. Joe Lamptons Entwicklungsprozess vom successful zombie zum warm giant.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit untersucht die Entwicklung des Protagonisten Joe Lampton in den beiden Romanen "Room at the Top" und "Life at the Top" anhand der Philosophie der Lebenskunst von Wilhelm Schmid. Die Analyse zielt darauf ab, zu ergründen, ob sich Joe im Laufe der beiden Bücher positiv entwickelt und ob sein Leben als bejahenswert betrachtet werden kann.
- Das Kriterium des Bejahenswerten und die Lebenskunst nach Wilhelm Schmid
- Die Beziehung zwischen dem Selbst und den Anderen
- Die Frage der Wahl und ihre Bedeutung für die Gestaltung des Lebens
- Die Analyse von Joes Entscheidungen und Handlungen in beiden Romanen
- Joes Entwicklungsprozess vom "successful zombie" zum "warm giant"
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
- Kapitel 2: Zusammenfassung der Aspekte der Lebenskunst nach Schmid
- Kapitel 3: Analyse: Room at the Top
- Kapitel 4: Analyse: Life at the Top
- Kapitel 5: Joe Lamptons Entwicklungsprozess vom successful zombie zum warm giant
Die Einleitung stellt das Kriterium des Bejahenswerten nach Wilhelm Schmid vor und erläutert, wie es sich auf die Analyse von Joes Entwicklungsprozess in den Romanen "Room at the Top" und "Life at the Top" bezieht.
Dieses Kapitel behandelt zwei wichtige Aspekte der Lebenskunst nach Schmid: das Selbst und die Anderen sowie die Frage der Wahl. Es beleuchtet, wie diese Aspekte für das Leben des Protagonisten relevant sind.
Dieses Kapitel analysiert Joes Entscheidungen und Handlungen im ersten Roman "Room at the Top" im Hinblick auf die Aspekte der Lebenskunst, die in Kapitel 2 dargestellt wurden. Es beleuchtet insbesondere seine Wahlmöglichkeiten und seine Beziehungen zu anderen Menschen.
Dieses Kapitel setzt die Analyse aus Kapitel 3 fort und untersucht Joes Entscheidungen und Handlungen im zweiten Roman "Life at the Top". Es vergleicht seine Entwicklung im Verlauf der beiden Bücher und zeigt, wie sich seine Beziehungen zu anderen Menschen und seine Sichtweise auf das Leben verändert haben.
Dieses Kapitel fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und diskutiert Joes Entwicklungsprozess. Es beleuchtet, ob er im Verlauf der beiden Romane eine positive Entwicklung durchgemacht hat und ob sein Leben als bejahenswert betrachtet werden kann.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit folgenden Schlüsselbegriffen und Themen: Lebenskunst, Wilhelm Schmid, Selbst, Andere, Wahl, Beziehungen, Sorge, bejahenswertes Leben, Entwicklungsprozess, "Room at the Top", "Life at the Top", Joe Lampton, "successful zombie", "warm giant".
- Quote paper
- Marie-Kristin Hofmann (Author), 2013, Entwicklungsprozess des Joe Lampton in "Room at the Top" und "Life at the Top". Eine Überprüfung anhand der Philosophie der Lebenskunst, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/373248