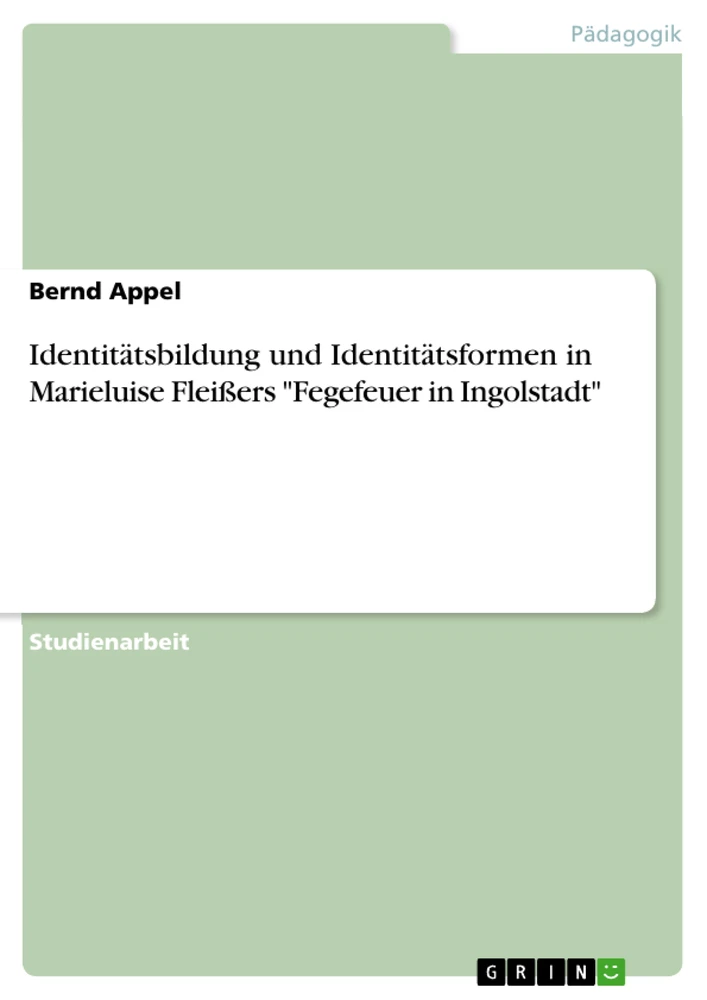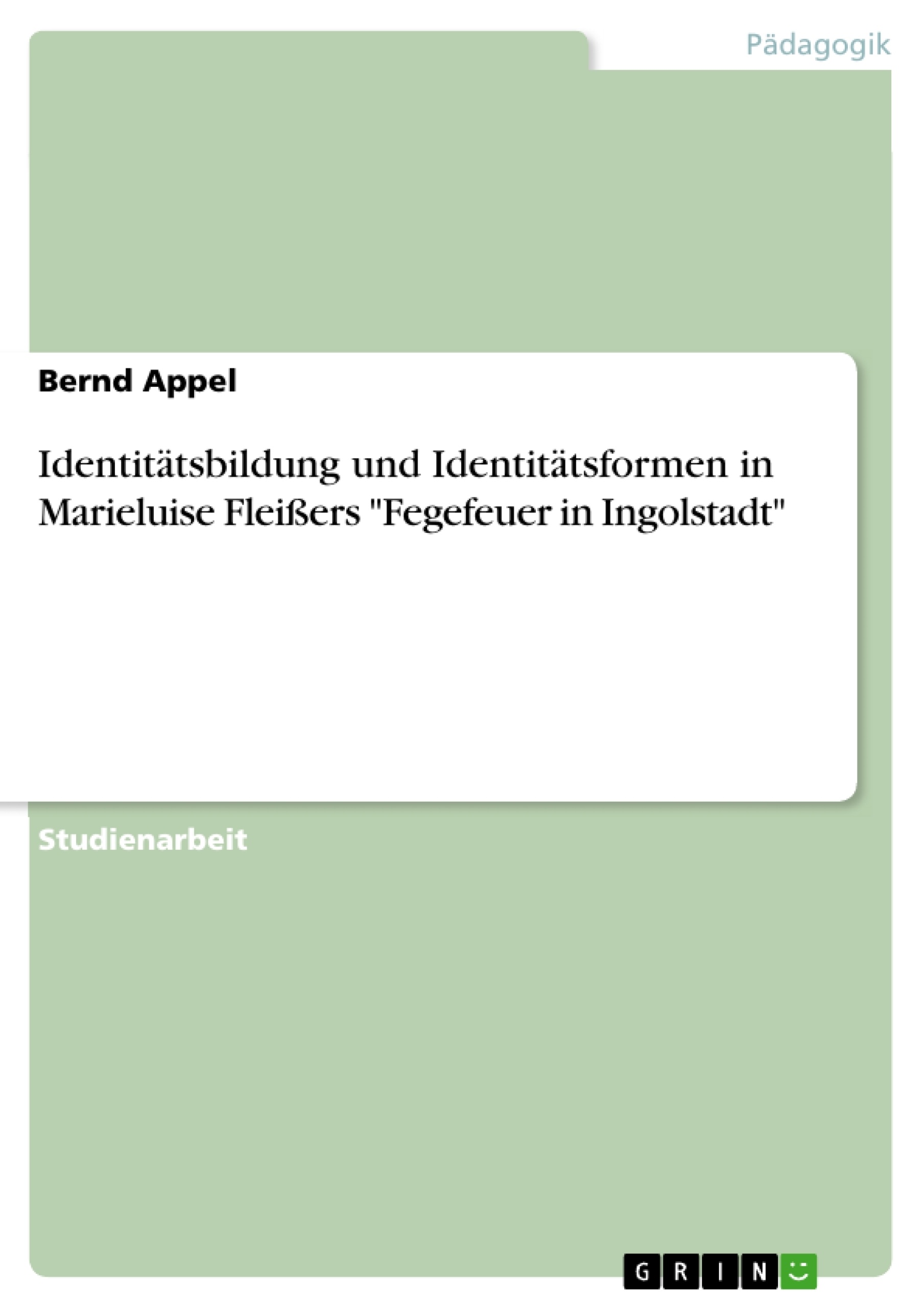Das Werk „Fegefeuer in Ingolstadt“ gehört mit zu den berühmtesten Werken der österreichischen Autorin Marieluise Fleißer und gilt heute noch als ein Meisterwerk der Neuen Sachlichkeit. In dieser Arbeit wird der Versuch unternommen, die sexuellen und sprachlichen Identitätsformen der Jugendlichen bei Fleißer näher zu untersuchen und diese in Relation zueinander zu setzen. Das Ziel dieser Arbeit soll es dabei sein, das Misslingen der figuralen Beziehungen und die Misserfolge sprachlicher Identifikation zu analysieren und zu begründen. Dabei wurde ein Hauptaugenmerk auf die beiden Hauptfiguren des Dramas, die Außenseiter Olga und Roelle, gelegt. Im ersten Teil der Arbeit werden im Rahmen der Fragestellung zunächst die sexuellen Identitäten der einzelnen Figuren untersucht, um herauszufinden, inwiefern sich in Fleißers Werk bestimmte Paarbildungen erkennen und aufeinander beziehen lassen. Der zweite Teil der Arbeit widmet sich den sprachlichen Identitäten der Figuren, indem versucht wird, die Rolle der Sprache für die Subjektkonstituierung und die Beziehungen der Figuren zueinander aufzuzeigen und zu erörtern.
Das Drama, welches in der Literatur auch als „Psychosexuelle Dramatik“ oder als „Dramaturgie dauernder Drohung“ begriffen wird, handelt von der Einsamkeit der Jugendlichen in der Zeit der Weimarer Republik. Es steht unter dem Blick vier großer Hauptthematiken: „Kleinstadtenge, Religion, Sexualität, Rudelgesetz“. Dabei sind es vor allem die Fragen der Identität und der gesellschaftlichen Orientierung, die Fleißer in ihrem Werk exemplarisch verarbeitet. Im Vordergrund stehen dabei vor allem die sexuelle und sprachliche Identitätsbildung sowie die Identitätsformen der Jugendlichen. Ihre Gefühle füreinander sowie ihr Versuch, eine Position im sozialen Raum der Gesellschaft einzunehmen, werden in diesem Zusammenhang aufgearbeitet.
Fleißer selbst bezeichnete das Drama als das „Herzstück“ ihrer Autorschaft. Lange Zeit unbeachtet, dauerte es knapp 50 Jahre nach der Erstveröffentlichung 1920 und Uraufführung des Dramas am 25. April 1926 bis es in den 1970er Jahren von der Frauenforschung und der Feminismusbewegung wiederentdeckt und nach einer Überarbeitung der Autorin erneut auf den deutschen Theaterbühnen gespielt wurde.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sexuelle Identitäten
- Paarkonstruktionen im Werk Marieluise Fleißers:
- Sexuelle Identitätsbildung im Werk Marieluise Fleißers:
- Sprachliche Identitäten
- Sprachliche Identitätsbildung im Werk Marieluise Fleißers…...
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die sexuellen und sprachlichen Identitätsformen der Jugendlichen in Marieluise Fleißers „Fegefeuer in Ingolstadt“. Sie analysiert das Misslingen der figurale Beziehungen und die Misserfolge sprachlicher Identifikation, insbesondere anhand der Hauptfiguren Olga und Roelle. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die Herausforderungen der Identitätsfindung in Fleißers Werk zu beleuchten.
- Die Darstellung der sexuellen Identitätsbildung in „Fegefeuer in Ingolstadt“
- Die Analyse von Paarkonstruktionen und ihren Bedeutungen für die Figuren
- Die Rolle der Sprache bei der Subjektkonstituierung und in den Beziehungen der Figuren
- Die Herausforderungen der Identitätsfindung in einer von gesellschaftlichen Normen geprägten Welt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Werk „Fegefeuer in Ingolstadt“ vor und skizziert die zentralen Themen: Identität und gesellschaftliche Orientierung. Die Arbeit konzentriert sich auf die sexuelle und sprachliche Identitätsbildung der Jugendlichen, insbesondere auf die Figuren Olga und Roelle.
Das Kapitel „Sexuelle Identitäten“ beleuchtet die Frage nach der Verortung von Männlichkeit und Weiblichkeit in Fleißers Werk. Es analysiert Paarkonstruktionen, insbesondere die ambivalenten Beziehungen zwischen Olga und Roelle sowie Peps und Hermine. Die Analyse zeigt, wie die Figuren mit unterschiedlichen Attributen aufeinander bezogen werden.
Das Kapitel „Sprachliche Identitäten“ widmet sich der Rolle der Sprache bei der Subjektkonstituierung und in den Beziehungen der Figuren zueinander. Es untersucht, wie Sprache die Identitätsbildung der Figuren beeinflusst und wie sie ihre Beziehungen gestalten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Identitätsbildung, Identitätsformen, „Fegefeuer in Ingolstadt“, Marieluise Fleißer, Sexualität, Sprache, Subjektkonstituierung, Paarbildung, gesellschaftliche Normen und die Weimarer Republik.
- Quote paper
- Bernd Appel (Author), 2010, Identitätsbildung und Identitätsformen in Marieluise Fleißers "Fegefeuer in Ingolstadt", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/373255