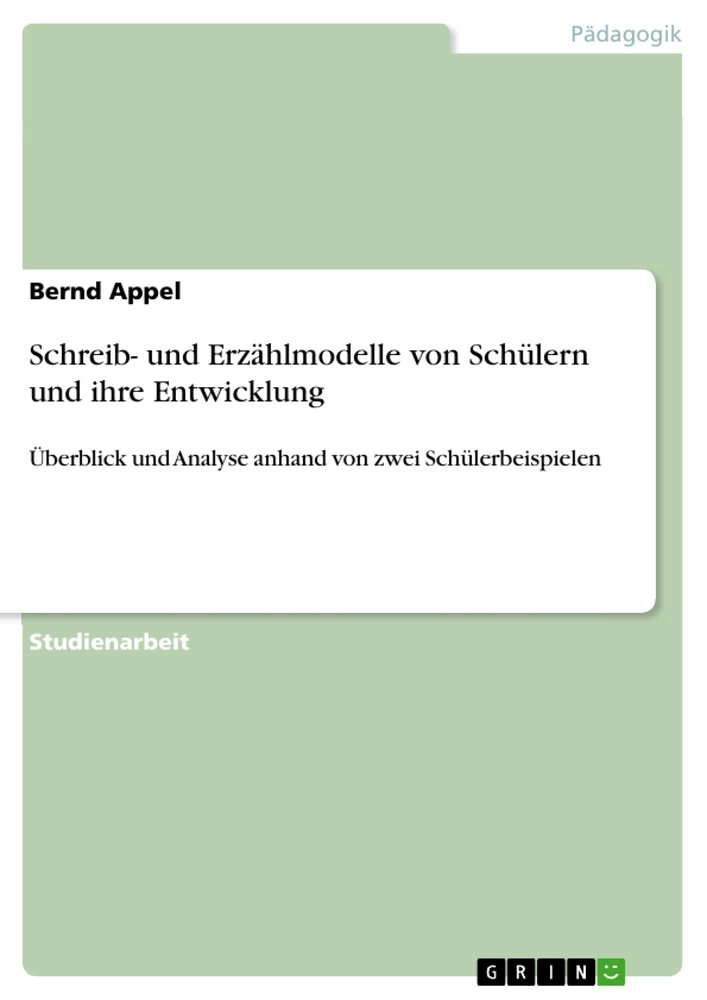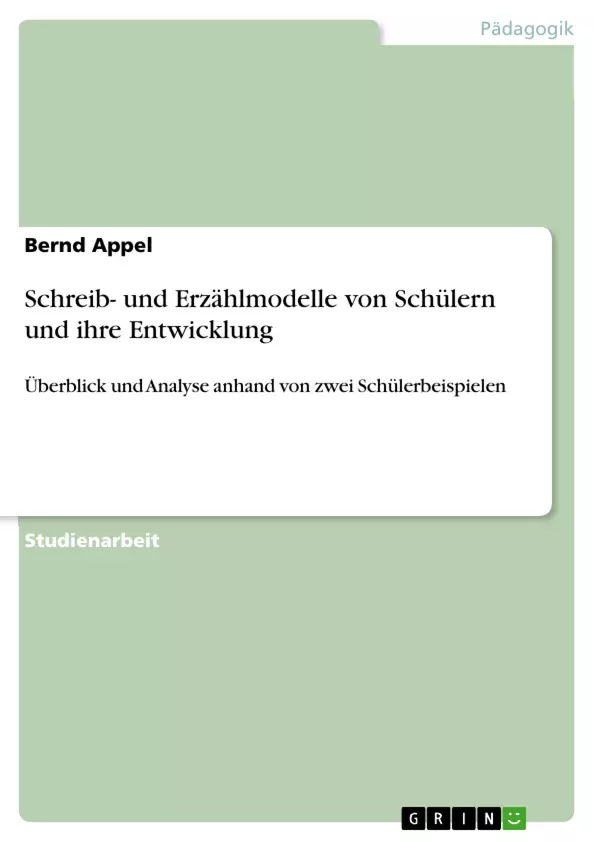Nach 1945 wurden im Verlauf der modernen Deutschdidaktik von zahlreichen Forschern umfangreiche Modelle zur Schreib- und Erzählentwicklung von Kindern entwickelt. Sie versuchen auf verschiedene Art und Weise die erzählerischen Fähigkeiten der Kinder zu strukturieren und zu systematisieren. Dies geschah mit dem Ziel, diejenigen Schüler zu erfassen, die über eine mangelnde Erzähl- und Schreibkompetenz verfügten, um sie besser fördern und unterstützen zu können, als dies bisher vor dem großen Paradigmen-Wechsel in der Deutschdidaktik der Fall gewesen war.
Im Laufe der hier vorliegenden Arbeit wird nun der Versuch unternommen, eines dieser Schreib- und Erzählmodelle genauer auf seine Aussagefähigkeit zu überprüfen. Dabei handelt es sich um das Modell zur Schreib- und Erzählentwicklung einer Forschungsgruppe um den Professor Dietrich Boueke, welches im Jahr 1995 vorgestellt wurde. Es beschreibt die Entwicklung der Erzähl- und Schreibkompetenz bei Kindern als vierstufiges Modell, bei dem alle Stufen dem Schreibalter entsprechend hierarchisch angeordnet sind. Die Aussagefähigkeit dieses Modells wird anhand von beispielhaft ausgewählten Schülertexten überprüft.
Zunächst werden in einem ersten Schritt mehrere bedeutende Forschungsmodell vorgestellt, mit denen bisher versucht wurde, die Erzähl- und Schreibentwicklung von Kindern nachzuvollziehen. In einem zweiten umfangreicheren Abschnitt werden anschließend zwei verschiedene Schülertexte analysiert und auf ihre Eigenschaften hin untersucht. Dabei dient das bereits erwähnte Schreib- und Erzählmodell nach Boueke u.a. als Grundlage für die Aussagen über die Schülertexte. Auf dessen Basis soll im Folgenden betrachtet werden, welche Erzählstrukturen, die Boueke als Grundlage seines Modells benutzt, von den Schülern verwendet werden und welche nicht. Ebenfalls soll der Versuch unternommen werden, die Schüler ihren jeweiligen Kompetenzstufen zuzuordnen und somit das Modell praktisch einzusetzen. Im dritten Teil der Arbeit soll dann auf Basis der Schülertexte nach der Sinnhaftigkeit des hier vorgestellten Modells zur Schreib- und Erzählentwicklung gefragt werden, um das Modell anhand der Ergebnisse kritisch zu reflektieren. Der letzte zusammenfassende Teil wird sich schließlich mit der Auswertung und einem Fazit beschäftigen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ein Überblick: Modelle zur Erzähl- und Schreibentwicklung
- Analyse von Schülertexten in Hinblick auf die Erzählkompetenzen
- „Eine Elster als Meisterdieb“ von Deike (Klasse 5) - Involvierendes Erzählen
- „Tierwelt“ von Sheala (Klasse 7) – Temporales und Ereignislogisches Erzählen
- Versuch einer Kritik am Erzähl- und Schreibmodell nach Boueke u.a. (1995)
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert das Erzähl- und Schreibmodell von Boueke u.a. (1995) und untersucht dessen Aussagekraft anhand von zwei Schülertexten. Ziel ist es, die Entwicklung der Erzählkompetenz bei Kindern zu beleuchten und das Modell in Bezug auf seine Praktikabilität und Aussagefähigkeit zu evaluieren.
- Modell der Schreib- und Erzählentwicklung nach Boueke u.a.
- Analyse von Schülertexten und ihre Einordnung in die Entwicklungsstufen
- Vergleich der Modellannahmen mit den Ergebnissen der Textanalyse
- Kritik und Reflexion des Modells auf Basis der Ergebnisse
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt das Thema der Hausarbeit vor und erläutert die Bedeutung von Erzähl- und Schreibmodellen in der Deutschdidaktik. Sie gibt einen Überblick über die Zielsetzung und den Aufbau der Arbeit.
- Ein Überblick: Modelle zur Erzähl- und Schreibentwicklung: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene Modelle zur Erzähl- und Schreibentwicklung von Kindern, insbesondere das Modell von Carl Bereiter und das Modell von Boueke u.a. Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Modelle werden beleuchtet.
- Analyse von Schülertexten in Hinblick auf die Erzählkompetenzen: In diesem Kapitel werden zwei Schülertexte analysiert und auf ihre Erzählstrukturen untersucht. Die Analyse erfolgt unter Bezugnahme auf das Modell von Boueke u.a., um die Schülertexte in die entsprechenden Entwicklungsstufen einzordnen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse von Erzähl- und Schreibmodellen, insbesondere auf das Modell von Boueke u.a., sowie die Untersuchung der Erzählkompetenz von Kindern anhand von Schülertexten. Weitere zentrale Begriffe sind: Entwicklungsstufen, Schreibalter, Textanalyse, Erzählstrukturen, Kompetenzstufen.
- Quote paper
- Bernd Appel (Author), 2011, Schreib- und Erzählmodelle von Schülern und ihre Entwicklung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/373260