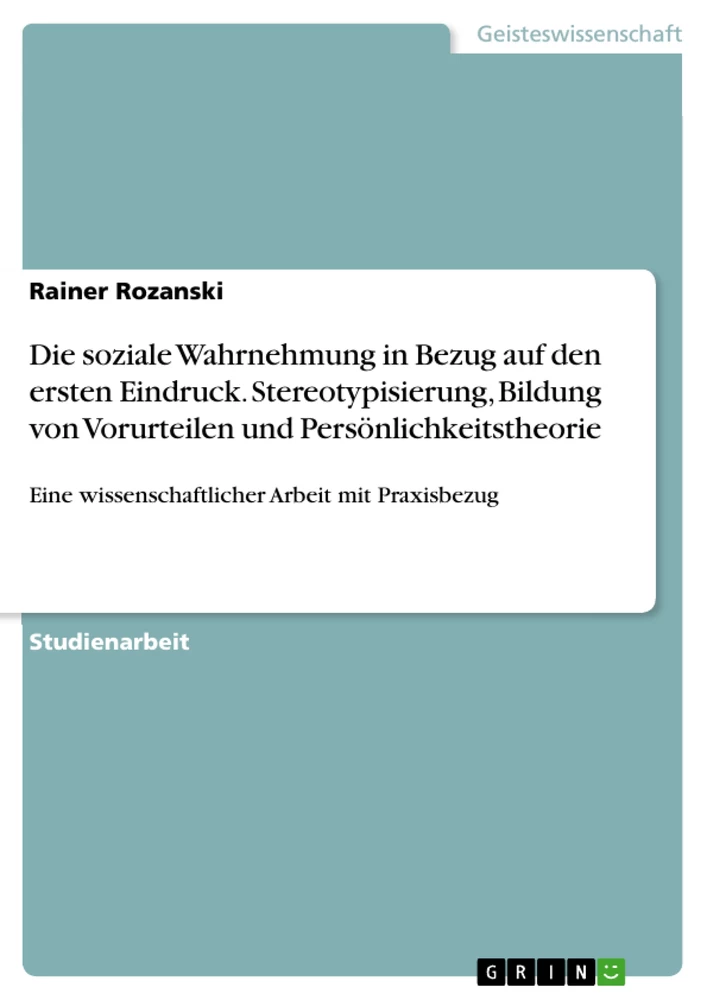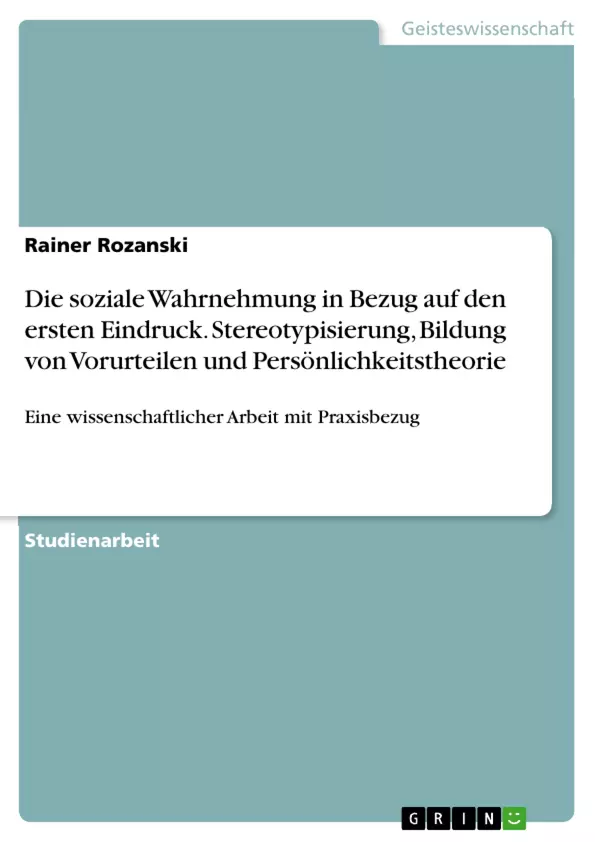Diese Hausarbeit untersucht die soziale Wahrnehmung in Bezug auf den ersten Eindruck. Doch ist das bereits Erlebte auch in der Wahrnehmung des ersten Eindruckes relevant? Wie kann der erste Eindruck so entscheidend sein und welche Prozesse durchläuft der Mensch in dem Moment des ersten Eindrucks? Diese Fragestellungen bilden den Kern dieser Arbeit und werden in Ihrem Verlauf beantwortet und kritisch hinterfragt.
„Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance.“ Diese oft sprichwörtlich genutzte Aussage trifft sowohl im beruflichen als auch im privaten Kontext immer wiederkehrend auf unseren Alltag zu. Die Persönlichkeit unseres Gegenübers lässt sich meist nicht anhand einer einzelnen Impression erkennen, dennoch bildet der Mensch sich im ersten Moment einen sofortigen und nachhaltigen Eindruck zu der ihm gegenüberstehenden Person. Um den Menschen aber vollständig richtig einschätzen oder bewerten zu können bedarf es aber einer Vielzahl weiterer Eindrücke, welche zum Teil bewusst und zum größten Teil unbewusst im menschlichen Gehirn verarbeitet werden. Das Gefühl auf Anhieb einen Menschen zu mögen oder bedeutende Sympathie für eine fremde Person zu empfinden kennen viele Menschen. Auf der anderen Seite ist das Gefühl, sein Gegenüber von dem ersten Kontaktmoment nicht zu mögen, ebenfalls ein bekanntes Phänomen. Hieraus lässt sich vermuten, dass die Mechanismen der menschlichen Wahrnehmung vielschichtig und komplex sind.
Durch die stetig wachsenden Anforderungen an die Menschen in der heutigen Gesellschaft, der damit verbundene Druck auf den Menschen direkt auf den ersten Moment an ein umfassendes und auch perfektes Bild abzugeben oder gar seinen Gegenüber nicht spüren zu lassen wie das persönliche Befinden aktuell ist, kann zu einer Charakterverzerrung führen welche in vielerlei Hinsicht beirren kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundgedanke
- Problemstellung und Zielsetzung
- Wissenschaftlicher Hintergrund
- Die soziale Wahrnehmung
- Stereotypisierung mit einhergehender Entstehung von Vorurteilen
- Eindrucksbildung nach dem Kontinuum-Modell von Fiske & Neuberg
- Nonverbale Kommunikation
- Implizite Persönlichkeitstheorie
- Attributionstheorie
- Kovariationstheorie
- Praxisbezug
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Frage, wie der erste Eindruck entsteht und welche Prozesse dabei im menschlichen Gehirn ablaufen. Es soll untersucht werden, inwiefern Stereotypen und Vorurteile die Wahrnehmung beeinflussen und wie die nonverbale Kommunikation den ersten Eindruck prägt. Darüber hinaus werden die Rolle von Persönlichkeits- und Attributionstheorien sowie die Möglichkeit, den ersten Eindruck positiv zu beeinflussen, beleuchtet.
- Die Entstehung des ersten Eindrucks und die Rolle der sozialen Wahrnehmung
- Der Einfluss von Stereotypen und Vorurteilen auf die Eindrucksbildung
- Die Bedeutung nonverbaler Kommunikation für den ersten Eindruck
- Die Anwendung von Persönlichkeits- und Attributionstheorien im Kontext der Eindrucksbildung
- Möglichkeiten, den ersten Eindruck zu verbessern und positiv zu beeinflussen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt den Leser in die Thematik des ersten Eindrucks ein und erläutert die Relevanz des Themas im beruflichen und privaten Kontext. Sie stellt die Forschungsfrage nach den Mechanismen der menschlichen Wahrnehmung und den Einflussfaktoren auf die Eindrucksbildung.
- Wissenschaftlicher Hintergrund: Dieser Abschnitt beleuchtet verschiedene wissenschaftliche Theorien und Konzepte, die relevant für die Untersuchung des ersten Eindrucks sind. Dazu gehören die soziale Wahrnehmung, Stereotypisierung und Vorurteile, das Kontinuum-Modell der Eindrucksbildung, die nonverbale Kommunikation, die implizite Persönlichkeitstheorie, die Attributionstheorie sowie die Kovariationstheorie.
Schlüsselwörter
Soziale Wahrnehmung, erster Eindruck, Stereotypisierung, Vorurteile, Eindrucksbildung, Kontinuum-Modell, nonverbale Kommunikation, Persönlichkeits- und Attributionstheorien, Einflussfaktoren, Informationsverarbeitung.
- Quote paper
- Rainer Rozanski (Author), 2016, Die soziale Wahrnehmung in Bezug auf den ersten Eindruck. Stereotypisierung, Bildung von Vorurteilen und Persönlichkeitstheorie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/373270