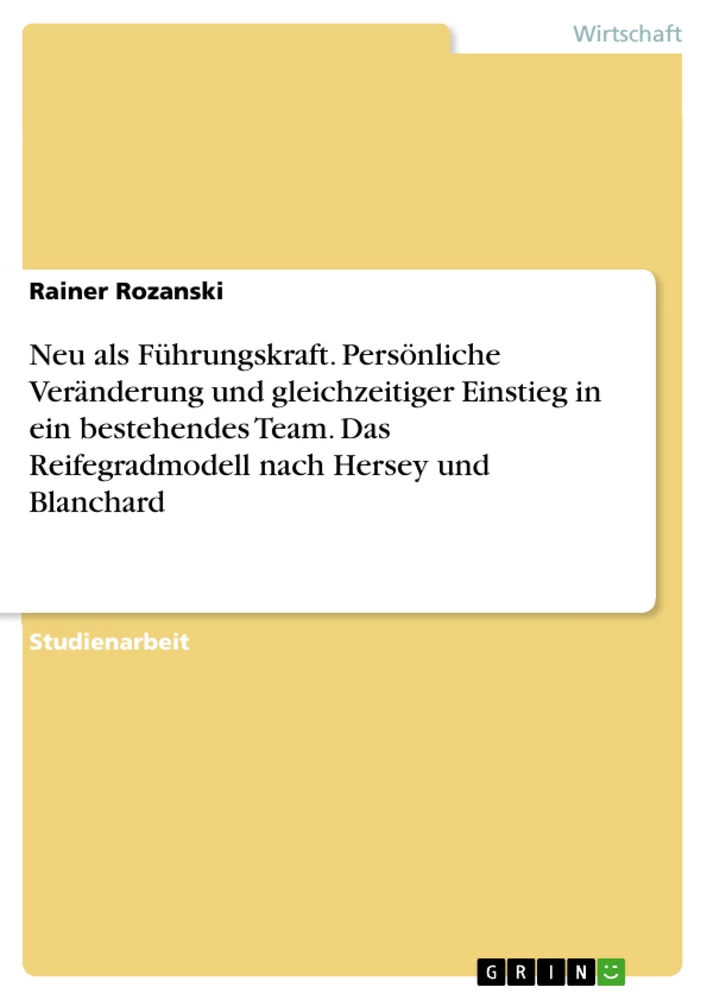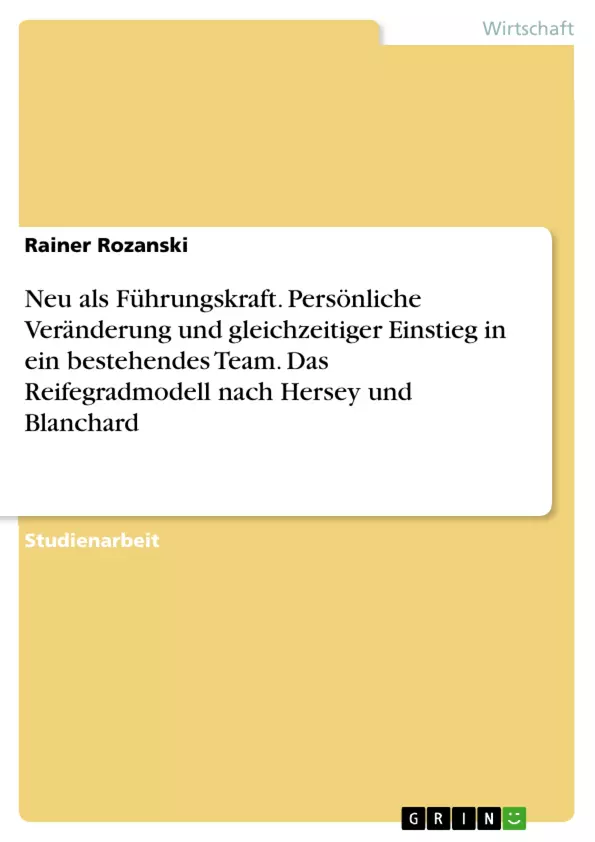In der Vergangenheit wurden Führungspositionen meist dem dienstältesten Mitarbeiter übergeben weil eine hohe fachliche und persönliche Kompetenz ohne ausgiebige Prüfung vergeben wurde. In der heutigen Zeit werden aber immer mehr junge Menschen Führungskräfte, die Betrachtung des Alters bekommt weniger Bedeutung, vielmehr ist es die persönliche und fachliche Reife, die nicht immer zwingend mit dem dem Alter in Verbindung stehen muss. Junge Führungskräfte sehen sich in ihrer ersten Führungsposition vielfältigen neuen Aufgaben aber auch vielen Chancen gegenübergestellt. Gerade in unteren Führungshierarchien stehen ihnen zahlreiche Fach- und Führungsaufgaben bevor. Diese ändern sich in einer zunehmend komplexer werdenden Unternehmenswelt immer schneller. Neben der neuen Verantwortung für die eigene Tätigkeit kommt die für die unterstellten Mitarbeiter hinzu. Neben der Erweiterung der sozio-emotionalen Kompetenzen, deren Vermittlung in klassischen Ausbildungs- und Studiengängen oftmals zu Gunsten des technischen und konzeptionellem Können vernachlässigt wird, bekommt der steigende Kommunikationsaufwand ebenfalls eine hohe Bedeutung. Ein stetiger Prozess des sich Weiter-Entwickelns läuft an um die wachsenden Erwartungen sowie dem multilateralen Interessenpluralismus mit einer geeigneten Strategie, dem persönlichen Führungsstil, gegenüber zu stehen. Doch gerade für den Führungsnachwuchs ist es schwierig, sich aus all den angepriesenen Theorien, die am besten auf die eigene Person und Situation passende auszuwählen und auch umzusetzen. Ziel dieser Arbeit ist es einen praxisbezogenen Einblick in eine Führungsmethode zu vermitteln. Die drei Führungsstile nach Lewin werden in dieser Arbeit bewusst nicht bearbeitet. Diese sind zwar historisch wichtig aber heute kaum noch anwendbar. In den letzten Jahren bekommt der situative Führungsstil, welcher auch in der folgenden Arbeit näher betrachtet wird, immer mehr Bedeutung zugesprochen. Im Zuge dieser Arbeit werden die Erwartungen und Probleme junger Führungskräfte erläutert, die Begriffe Führung und Führungsstil kurz betrachtet, das Reifegradmodell erläutert und ein Praxisbezug als Student Consulting Recherche anhand Erfahrungen einer jungen Führungskraft hergestellt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Führungskraft
- 2.1. Allgemeine Erwartungen und Probleme
- 2.2. Vom Mitarbeiter zur Führungskraft
- 3. Merkmale und Ausprägung von Führung
- 3.1. Der Begriff Führung
- 3.2. Der Begriff Führungsstil
- 4. Der situative Führungsstil nach Hersey & Blanchard
- 4.1. Die Entstehung des situativen Führungsstils
- 4.2. Der Reifegrad des Mitarbeiters
- 4.3. Die vier Führungsstile
- 4.4. Selbstbild der Führungskraft bei Anwendung des situa. Führungsstils
- 5. Kritische Betrachtung des Reifegradmodells
- 6. Praxisbeispiel
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht den Einstieg junger Führungskräfte in bestehende Teams und die damit verbundenen Herausforderungen. Sie fokussiert auf den situativen Führungsstil nach Hersey und Blanchard als ein mögliches Werkzeug zur Bewältigung dieser Herausforderungen. Die Arbeit vermittelt einen praxisorientierten Einblick in die Anwendung dieser Führungsmethode.
- Herausforderungen und Erwartungen an junge Führungskräfte
- Der situative Führungsstil nach Hersey & Blanchard
- Das Reifegradmodell und seine Anwendung
- Die verschiedenen Führungsstile im Modell
- Praxisbezogene Betrachtung des Modells
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung skizziert den Wandel in der Besetzung von Führungspositionen, weg von Seniorität hin zu fachlicher und persönlicher Reife. Sie hebt die komplexen Herausforderungen für junge Führungskräfte hervor, insbesondere den gestiegenen Kommunikationsaufwand und die Notwendigkeit, den eigenen Führungsstil an die Situation anzupassen. Der situative Führungsstil nach Hersey & Blanchard wird als Fokus der Arbeit vorgestellt, im Gegensatz zu den historisch bedeutsamen, aber heutzutage weniger relevanten Führungsstilen nach Lewin.
2. Die junge Führungskraft: Dieses Kapitel beleuchtet die anfängliche Orientierungslosigkeit junger Führungskräfte und die Überforderung durch die Vielzahl neuer Aufgaben. Es verdeutlicht die "Sandwich-Position" der Führungskraft zwischen den Erwartungen von Mitarbeitern, Vorgesetzten und dem privaten Umfeld. Das Kapitel betont den Druck, die Erwartungen aller Beteiligten zu erfüllen und gleichzeitig die eigenen Ziele zu verfolgen.
Schlüsselwörter
Junge Führungskraft, Situativer Führungsstil, Hersey & Blanchard, Reifegradmodell, Führung, Führungsstil, Mitarbeiterführung, Herausforderungen, Erwartungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Führung junger Führungskräfte
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit befasst sich mit den Herausforderungen, denen junge Führungskräfte beim Einstieg in bestehende Teams gegenüberstehen. Der Fokus liegt auf dem situativen Führungsstil nach Hersey & Blanchard als Methode zur Bewältigung dieser Herausforderungen. Die Arbeit bietet einen praxisorientierten Einblick in die Anwendung dieser Führungsmethode.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt unter anderem die Erwartungen und Herausforderungen an junge Führungskräfte, den situativen Führungsstil nach Hersey & Blanchard, das Reifegradmodell und dessen Anwendung, die verschiedenen im Modell enthaltenen Führungsstile sowie eine praxisbezogene Betrachtung des Modells. Zusätzlich werden der Wandel in der Besetzung von Führungspositionen und die damit verbundenen komplexen Herausforderungen beleuchtet.
Welche Führungsstile werden betrachtet?
Die Arbeit konzentriert sich hauptsächlich auf den situativen Führungsstil nach Hersey & Blanchard. Im Gegensatz dazu werden historisch bedeutsame, aber heutzutage weniger relevante Führungsstile nach Lewin kurz erwähnt.
Was ist das Reifegradmodell und wie wird es angewendet?
Das Reifegradmodell ist ein zentraler Bestandteil des situativen Führungsstils nach Hersey & Blanchard. Es dient zur Einschätzung des Reifegrades der Mitarbeiter und hilft, den passenden Führungsstil zu wählen. Die Arbeit beschreibt die Anwendung des Modells und die verschiedenen Führungsstile, die je nach Reifegrad des Mitarbeiters angewendet werden sollten.
Welche Herausforderungen für junge Führungskräfte werden angesprochen?
Die Arbeit beschreibt die anfängliche Orientierungslosigkeit, die Überforderung durch neue Aufgaben und die "Sandwich-Position" zwischen den Erwartungen von Mitarbeitern, Vorgesetzten und dem privaten Umfeld. Der Druck, alle Erwartungen zu erfüllen und gleichzeitig die eigenen Ziele zu verfolgen, wird ebenfalls thematisiert.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zur jungen Führungskraft und den Merkmalen von Führung, ein Kapitel zum situativen Führungsstil nach Hersey & Blanchard, eine kritische Betrachtung des Reifegradmodells, ein Praxisbeispiel, und abschließend ein Fazit. Ein detailliertes Inhaltsverzeichnis ist verfügbar.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für die Seminararbeit?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Junge Führungskraft, Situativer Führungsstil, Hersey & Blanchard, Reifegradmodell, Führung, Führungsstil, Mitarbeiterführung, Herausforderungen, Erwartungen.
Welche Zielsetzung verfolgt die Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht den Einstieg junger Führungskräfte in bestehende Teams und die damit verbundenen Herausforderungen. Sie vermittelt einen praxisorientierten Einblick in die Anwendung des situativen Führungsstils nach Hersey & Blanchard als Werkzeug zur Bewältigung dieser Herausforderungen.
- Quote paper
- Rainer Rozanski (Author), 2016, Neu als Führungskraft. Persönliche Veränderung und gleichzeitiger Einstieg in ein bestehendes Team. Das Reifegradmodell nach Hersey und Blanchard, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/373271