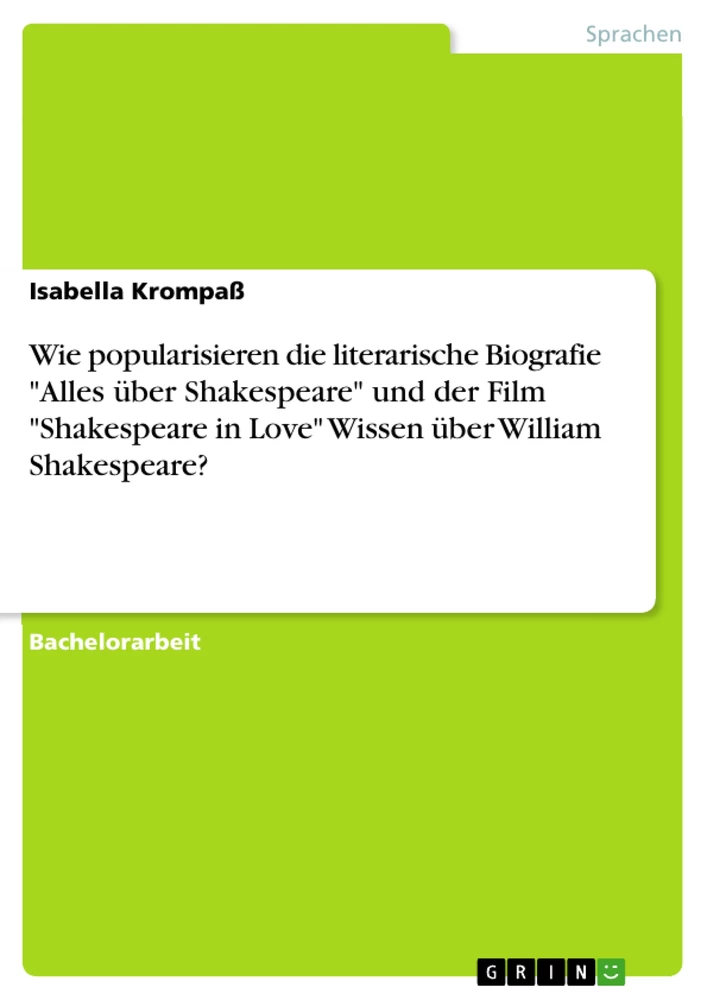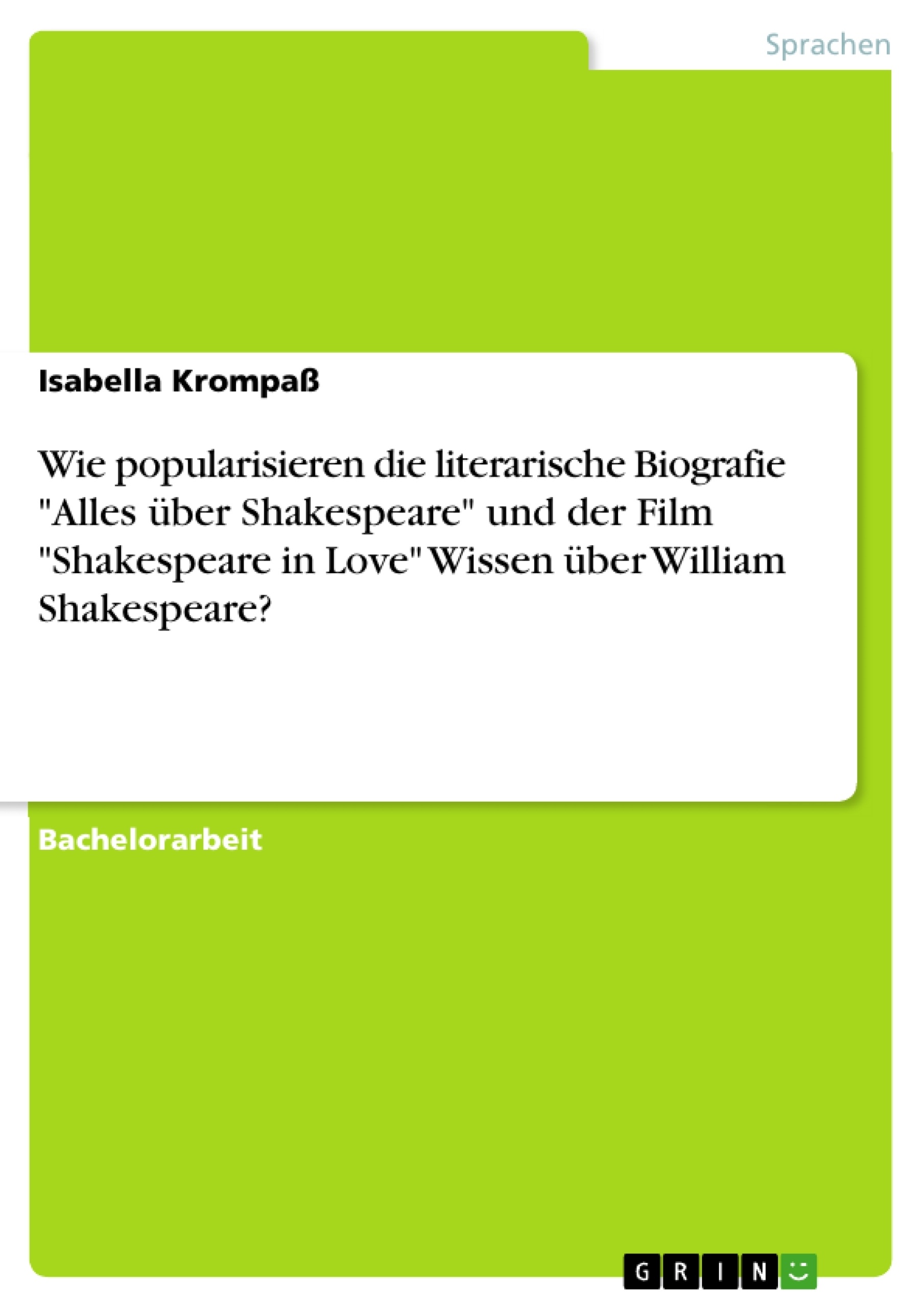„Sein oder Nichtsein“ (Shakespeare, Hamlet, III. Akt – 1. Szene), das ist eine Frage, die in vielen Lebensfragen unbeantwortet bleiben muss, möchte man Einzelheiten erfahren zu Vita und Charakter eines heute doch so populären Autors: William Shakespeare. Denn: „Im 16. und 17. Jahrhundert bestand in England ein sehr geringes Interesse an der Aufzeichnung des Lebens von Schriftstellern“ (Engel 2013, Seite 127), was bedeutet, dass den allgemeinen kulturellen Umständen der vergangenen Lebenswirklichkeit Shakespeares zugrunde liegend, heute zugängliche, dokumentierte Informationen zur Person William Shakespeare rar sind. Diese Rarität steht jedoch nur in Diskrepanz zu der Wissensmenge von gesellschaftlich bekannten Autoren des 21. Jahrhunderts, nicht aber zu den etablierten Gepflogenheiten der Lebenswelt Shakespeares.
Und auch David Bevington manifestiert: „A central problem is that Shakespeare wrote essentially nothing about himself“ (Bevington 2010, S. 5). Shakespeare hat also weder persönlich seine Lebensstationen und die damit verbundenen Gedanken und Gefühle aufgeschrieben, noch wurden diese an anderer Stelle zu Papier gebracht und aufbewahrt. Die wenigen urkundlichen Beweise liefern lediglich einen groben Umriss der Biografie Shakespeares (vgl. ebd. S. 4). Dazwischen bleibt viel Raum für Spekulationen – „Sein oder Nichtsein, das ist hier die Frage“ (Shakespeare, Hamlet, III. Akt – 1. Szene).
Inhaltsverzeichnis
- „Sein oder Nichtsein“: Mangel an überlieferten Wissensbeständen zur Person William Shakespeare
- „Wo Worte selten sind, haben sie Gewicht“: Wissenspopularisierung in der literarischen Biografie Alles über Shakespeare (2009) sowie im Film SHAKESPEARE IN LOVE (USA 1998)
- Intertextuelle Funktionalisierung von Shakespeares Werken
- Direkte Adaptionen
- Schlussfolgerungen auf die Person William Shakespeare
- Narrative Strukturen in Alles über Shakespeare und SHAKESPEARE IN LOVE
- Biografie als gedankliche Reise durch Shakespeares Lebensjahre
- Film als konkreter Lebensabschnitt Shakespeares
- Faktuales Wissen zur Lebenswelt Shakespeares
- Allgemein bekannte historische Umstände
- Spärliche Fakten zur persönlichen Lebenssituation
- Medial konstruierte Wissensmengen über Shakespeare
- Alles über Shakespeare
- Literarische Authentizitätssignale
- Textuell reflektierte Betrachtungsweise
- SHAKESPEARE IN LOVE
- Filmische Fiktionssignale
- Suggestionskraft des Films
- Alles über Shakespeare
- Intertextuelle Funktionalisierung von Shakespeares Werken
- „Dein Wunsch war des Gedankens Vater“: Faszinosum Shakespeare und seine Auswirkungen bis in die Gegenwart
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, wie die literarische Biografie "Alles über Shakespeare" (2009) und der Film "Shakespeare in Love" (1998) auf Basis intertextueller Referenzen Wissen über William Shakespeare popularisieren. Sie analysiert die Strategien, mit denen beide Medien trotz des Mangels an historischen Quellen ein Bild des berühmten Dramatikers konstruieren. Die Arbeit beleuchtet dabei die narrative Gestaltung, die Verwendung von Fakten und Fiktion und die Wirkung dieser Darstellungen auf das Publikum.
- Mangel an historischen Informationen über William Shakespeare
- Strategien der Wissenspopularisierung in Literatur und Film
- Intertextuelle Beziehungen und ihre Rolle bei der Konstruktion von Shakespeares Bild
- Narrative Strukturen in Biografien und Filmen
- Verhältnis von Fakten und Fiktion in der Darstellung Shakespeares
Zusammenfassung der Kapitel
„Sein oder Nichtsein“: Mangel an überlieferten Wissensbeständen zur Person William Shakespeare: Dieses Kapitel untersucht den Mangel an verlässlichen historischen Informationen über William Shakespeare. Es wird dargelegt, dass das geringe Interesse an der Aufzeichnung des Lebens von Schriftstellern im 16. und 17. Jahrhundert, verbunden mit historischen Ereignissen wie dem Brand des Globe-Theaters, zu einer spärlichen Quellenlage geführt hat. Die Arbeit betont, dass die wenigen vorhandenen Dokumente nur einen groben Umriss von Shakespeares Leben liefern und viel Raum für Spekulationen lassen. Die zentrale These ist die Knappheit von biografischen Fakten als Ausgangspunkt für die mediale Konstruktion von Shakespeares Bild.
„Wo Worte selten sind, haben sie Gewicht“: Wissenspopularisierung in der literarischen Biografie Alles über Shakespeare (2009) sowie im Film SHAKESPEARE IN LOVE (USA 1998): Dieses Kapitel analysiert, wie die literarische Biografie "Alles über Shakespeare" und der Film "Shakespeare in Love" trotz der mangelnden historischen Informationen ein Bild des Schriftstellers konstruieren. Es wird untersucht, wie beide Medien auf Shakespeares Werke zurückgreifen und diese intertextuell funktionalisieren, um eine Vorstellung von seinem Leben und Charakter zu vermitteln. Das Kapitel beleuchtet die unterschiedlichen narrativen Strategien und die Verwendung von Fakten und Fiktion in beiden Medien und untersucht deren Wirkung auf den Rezipienten. Die zentrale Frage ist, wie die Popularisierung von Wissen über Shakespeare funktioniert und welche Methoden dabei eingesetzt werden.
Schlüsselwörter
William Shakespeare, Wissenspopularisierung, Biografie, Film, Intertextualität, "Alles über Shakespeare", "Shakespeare in Love", historische Quellen, fiktionale Konstruktion, mediale Darstellung, Authentizität, Narrative Strukturen.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse von Wissenspopularisierung über William Shakespeare in "Alles über Shakespeare" und "Shakespeare in Love"
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Diese Arbeit analysiert, wie die literarische Biografie "Alles über Shakespeare" (2009) und der Film "Shakespeare in Love" (1998) trotz des Mangels an historischen Quellen ein Bild von William Shakespeare konstruieren und Wissen über ihn popularisieren. Im Fokus stehen die Strategien, die narrativen Strukturen, der Umgang mit Fakten und Fiktion sowie die Wirkung dieser Darstellungen auf das Publikum.
Welche zentralen Themen werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit dem Mangel an historischen Informationen über Shakespeare, den Strategien der Wissenspopularisierung in Literatur und Film, intertextuellen Beziehungen und ihrer Rolle bei der Konstruktion von Shakespeares Bild, narrativen Strukturen in Biografien und Filmen sowie dem Verhältnis von Fakten und Fiktion in der Darstellung Shakespeares.
Welche Quellen werden untersucht?
Die Hauptquellen der Analyse sind die literarische Biografie "Alles über Shakespeare" (2009) und der Film "Shakespeare in Love" (1998). Die Arbeit untersucht, wie diese Medien intertextuell auf Shakespeares Werke zurückgreifen, um ein Bild seines Lebens und Charakters zu vermitteln.
Wie wird der Mangel an historischen Informationen über Shakespeare behandelt?
Das erste Kapitel widmet sich explizit dem Problem der spärlichen historischen Quellenlage zu Shakespeares Leben. Es wird erklärt, warum nur wenige verlässliche Informationen existieren und wie dieser Mangel die mediale Konstruktion seines Bildes beeinflusst.
Welche Methoden werden zur Analyse verwendet?
Die Arbeit analysiert die narrativen Strategien, die Verwendung von Fakten und Fiktion, die intertextuellen Referenzen und die Wirkung der Darstellungen auf den Rezipienten in beiden Medien ("Alles über Shakespeare" und "Shakespeare in Love"). Es wird untersucht, wie Wissen über Shakespeare popularisiert wird und welche Methoden dabei zum Einsatz kommen.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zeigt auf, wie "Alles über Shakespeare" und "Shakespeare in Love" trotz der beschränkten historischen Quellenlage ein Bild Shakespeares konstruieren. Analysiert werden die unterschiedlichen Strategien, die beide Medien verwenden, um Wissen über den Dramatiker zu vermitteln und wie diese Darstellungen beim Publikum wirken. Die genaue Schlussfolgerung ist im Text selbst detailliert dargestellt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
William Shakespeare, Wissenspopularisierung, Biografie, Film, Intertextualität, "Alles über Shakespeare", "Shakespeare in Love", historische Quellen, fiktionale Konstruktion, mediale Darstellung, Authentizität, Narrative Strukturen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel, die sich mit dem Mangel an historischen Informationen, der Analyse von "Alles über Shakespeare" und "Shakespeare in Love" und der Bedeutung Shakespeares bis heute befassen. Jedes Kapitel hat einen eigenen Fokus und trägt zur Gesamtbetrachtung bei.
- Quote paper
- Isabella Krompaß (Author), 2013, Wie popularisieren die literarische Biografie "Alles über Shakespeare" und der Film "Shakespeare in Love" Wissen über William Shakespeare?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/373338