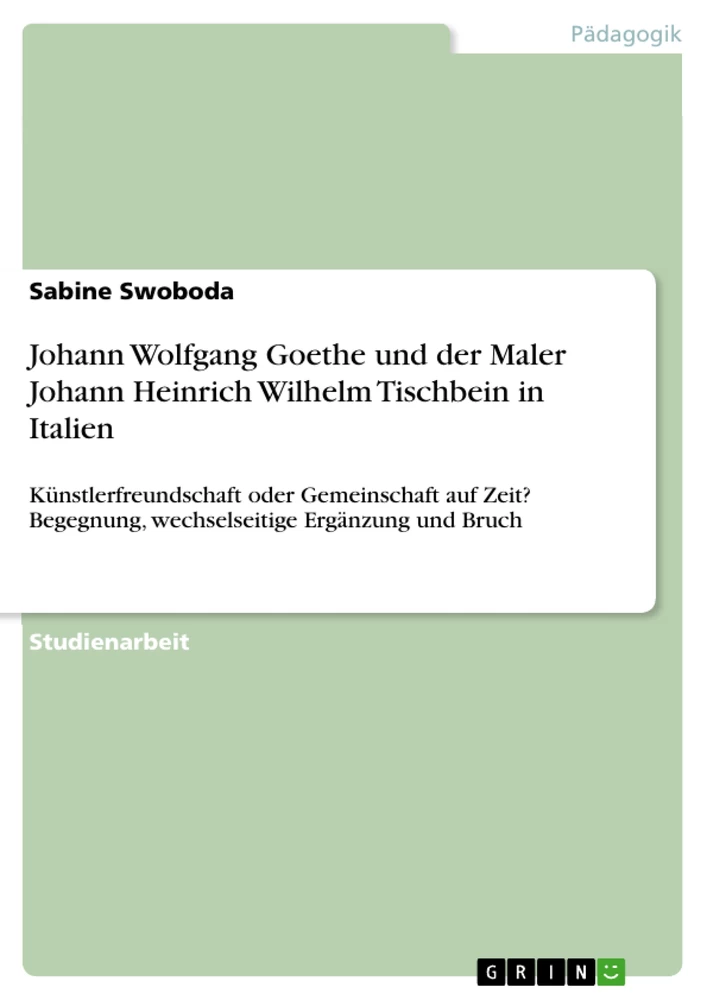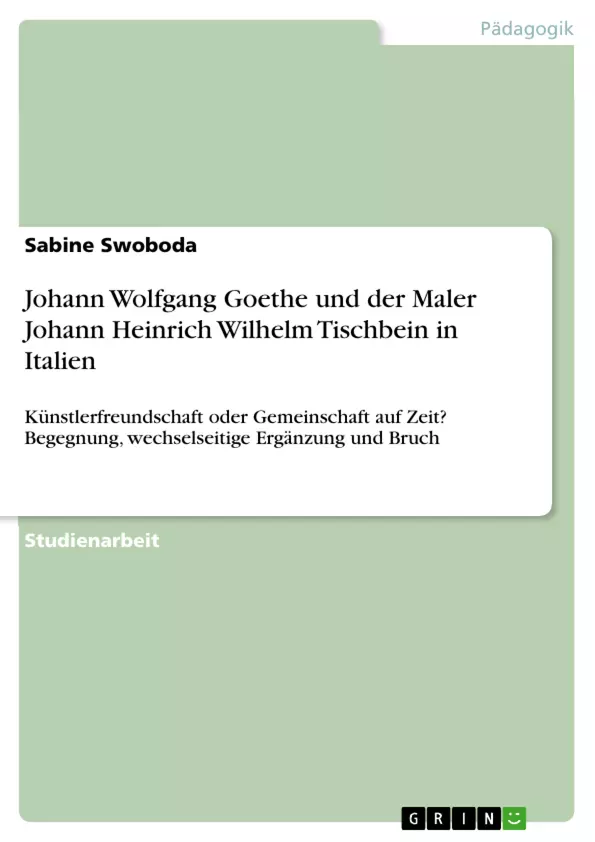Die vorliegende Arbeit, die Goethes „Italienische Reise“ als zentralen Text zum Gegenstand hat, untersucht die Gemeinschaft der Künstler hinsichtlich der Berechtigung des Begriffs der Künstlerfreundschaft für diese spezielle, zeitlich begrenzte Verbindung. Um die Gemeinschaft Goethes und Tischbeins sowie den Bruch näher zu definieren und zu gewichten, existieren in der Forschungsliteratur unterschiedliche Deutungsansätze, welche dargelegt und diskutiert werden sollen. Die Arbeit stellt zunächst die gemeinsamen Reise-Lehr- und (Er-) Lebensphasen Goethes und Tischbeins dar; untersucht werden weiterhin die wechselseitigen Zeugnisse der Künstler und ihre Sicht aufeinander, Momente der Überschneidung, Ergänzung, Vervollständigung durch den anderen bis hin zum Bruch. Dazu zählt neben der Auswertung der IR, der Briefe Goethes an Freunde in Weimar und biografischer Aufzeichnungen Tischbeins auch die Darstellung der Freundschaft und das Zeugnis der künstlerischen Gemeinschaft in und durch das Bild. Außerdem wird Bezug nehmen zu sein auf die gemeinsame „Vorgeschichte“ der Künstler, um beider Vorbegriffe voneinander sowie diesbezügliche Erwartungshaltungen zu konkretisieren und zu begründen.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Goethe und Tischbein: Verlauf einer „Künstlerfreundschaft“
- Standort Rom: die Künstlerkolonie
- Gemeinschaft im Alltag, Gemeinschaft in der Kunst: Goethes erster römischer Aufenthalt mit Tischbein
- Die Reise nach Neapel
- Distanzierung der Künstler und Bruch
- Wechselseitige Wahrnehmung der Künstler
- Vorgeschichte: Zürich-Weimar
- Wechselseitige Zeugnisse der Freundschaft
- Die gegenseitige Vervollständigung der künstlerischen Persönlichkeit
- Zeugnisse im Bild: Tischbein sieht Goethe
- Der Bruch: Distanzierung und Neubestimmung der Wege
- Exkurs: zu Tischbeins familiärem Hintergrund
- Goethe und Tischbein: eine „Künstlerfreundschaft“?
- Zum Begriff der Freundschaft
- Erwartung und Bedingung: was bietet der Moment?
- Das Verhalten der Künstler im Moment der Trennung
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Beziehung zwischen Johann Wolfgang Goethe und Johann Heinrich Wilhelm Tischbein während Goethes Italienreise. Die zentrale Fragestellung befasst sich mit der Berechtigung des Begriffs „Künstlerfreundschaft“ für die spezifische, zeitlich begrenzte Verbindung der beiden Künstler. Die Arbeit analysiert die gemeinsame Zeit, die wechselseitige Wahrnehmung und den letztendlichen Bruch der Beziehung, unter Berücksichtigung verschiedener Forschungsansätze.
- Die Entwicklung und der Verlauf der Beziehung zwischen Goethe und Tischbein.
- Die wechselseitige Beeinflussung und künstlerische Ergänzung der beiden.
- Der Bruch der Beziehung und dessen Ursachen.
- Die Definition und Anwendung des Begriffs „Künstlerfreundschaft“ im Kontext dieser Beziehung.
- Die Rolle des sozialen und künstlerischen Umfelds in Rom.
Zusammenfassung der Kapitel
Einführung: Die Einleitung beschreibt Goethes Italienreise als eine etwa eineinhalb Jahre dauernde Flucht aus den Weimarer Verhältnissen, angetrieben von künstlerischen und persönlichen Motiven. Sie stellt die Beziehung zu Tischbein als eine zentrale Thematik der Arbeit vor und skizziert unterschiedliche Forschungsansätze zum Verhältnis der beiden Künstler, wobei die Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich der Gründe für den Bruch hervorgehoben werden.
Goethe und Tischbein: Verlauf einer „Künstlerfreundschaft“: Dieses Kapitel bietet einen chronologischen Überblick über die gemeinsame Zeit Goethes und Tischbeins in Rom und Neapel. Es beschreibt ihre Zusammenarbeit, den Alltag und die gemeinsamen künstlerischen Aktivitäten während dieser Phase. Die Kapitelteile fokussieren auf die Stationen der Reise und die Entwicklung der Beziehung bis hin zu dem überraschenden Ende Mitte 1787. Der Fokus liegt auf der gemeinsamen Zeit, den Erlebnissen und der künstlerischen Interaktion, die als produktiv aber letztendlich zerbrechlich dargestellt wird.
Wechselseitige Wahrnehmung der Künstler: Dieser Abschnitt analysiert die gegenseitige Wahrnehmung und den Einfluss der beiden Künstler aufeinander. Er untersucht Zeugnisse ihrer Freundschaft, sowohl schriftlich als auch bildlich, um die Entwicklung ihrer Beziehung und die Gründe für den Bruch aufzuzeigen. Die Kapitelteile betrachten die gemeinsame „Vorgeschichte“, die wechselseitigen Erwartungen und die Bedeutung der künstlerischen Zusammenarbeit für beide Individuen. Der Exkurs zu Tischbeins familiärem Hintergrund beleuchtet die sozialen und wirtschaftlichen Faktoren, die seine Situation beeinflusst haben könnten.
Goethe und Tischbein: eine „Künstlerfreundschaft“?: Das Kapitel diskutiert die Frage, ob die Beziehung zwischen Goethe und Tischbein als „Künstlerfreundschaft“ bezeichnet werden kann. Es analysiert den Begriff der Freundschaft selbst und setzt ihn in Beziehung zu den Ereignissen und Beobachtungen aus den vorherigen Kapiteln. Die Analyse konzentriert sich auf die Motive der Übereinstimmung und der Distanzierung, um die Eingangsfrage abschließend zu beantworten. Die Untersuchung konzentriert sich auf die Dynamik der Beziehung und die Faktoren, die zu ihrer Entwicklung und ihrem Ende geführt haben.
Schlüsselwörter
Goethe, Tischbein, Italienreise, Künstlerfreundschaft, Rom, Neapel, Künstlerkolonie, wechselseitige Wahrnehmung, künstlerische Zusammenarbeit, Bruch, Freundschaft, Bildanalyse, Biografien.
Goethe und Tischbein: Eine „Künstlerfreundschaft“? - FAQ
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Hausarbeit untersucht die Beziehung zwischen Johann Wolfgang Goethe und Johann Heinrich Wilhelm Tischbein während Goethes Italienreise (ca. 1,5 Jahre). Die zentrale Frage ist, ob man die Verbindung der beiden Künstler als „Künstlerfreundschaft“ bezeichnen kann.
Welche Aspekte der Beziehung zwischen Goethe und Tischbein werden analysiert?
Die Arbeit analysiert die gemeinsame Zeit der beiden Künstler in Rom und Neapel, ihre wechselseitige Wahrnehmung und den letztendlichen Bruch ihrer Beziehung. Es werden verschiedene Forschungsansätze berücksichtigt, um die Entwicklung und das Ende der Beziehung zu verstehen.
Welche Themenschwerpunkte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung und den Verlauf der Beziehung, die wechselseitige Beeinflussung und künstlerische Ergänzung der beiden Künstler, die Ursachen des Beziehungsbruchs, die Definition und Anwendung des Begriffs „Künstlerfreundschaft“ im Kontext dieser Beziehung und die Rolle des sozialen und künstlerischen Umfelds in Rom.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einführung, drei Hauptkapitel und ein Kapitel mit Schlussfolgerungen. Das erste Kapitel beschreibt den chronologischen Verlauf der Beziehung. Das zweite Kapitel analysiert die wechselseitige Wahrnehmung der Künstler. Das dritte Kapitel diskutiert die Frage nach der "Künstlerfreundschaft".
Welche Quellen werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf schriftliche und bildliche Zeugnisse der Freundschaft zwischen Goethe und Tischbein. Genauer wird auf die schriftlichen Zeugnisse und die bildliche Darstellung von Tischbein eingegangen. Ein Exkurs beleuchtet Tischbeins familiären Hintergrund.
Was ist die zentrale Forschungsfrage der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage ist, ob die Beziehung zwischen Goethe und Tischbein als „Künstlerfreundschaft“ im eigentlichen Sinne bezeichnet werden kann. Die Arbeit untersucht, ob die Kriterien einer Freundschaft erfüllt waren und wie die Dynamik der Beziehung zu verstehen ist.
Welche Schlussfolgerungen werden in der Arbeit gezogen?
Die Arbeit kommt zu einer abschließenden Bewertung der Beziehung zwischen Goethe und Tischbein im Hinblick auf den Begriff der „Künstlerfreundschaft“. Die Analyse der Motive der Übereinstimmung und der Distanzierung soll die Eingangsfrage beantworten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Goethe, Tischbein, Italienreise, Künstlerfreundschaft, Rom, Neapel, Künstlerkolonie, wechselseitige Wahrnehmung, künstlerische Zusammenarbeit, Bruch, Freundschaft, Bildanalyse, Biografien.
Gibt es einen Überblick über die Kapitel?
Ja, die Arbeit bietet Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel: Die Einleitung beschreibt Goethes Italienreise und die Beziehung zu Tischbein. Kapitel 2 bietet einen chronologischen Überblick über die gemeinsame Zeit in Rom und Neapel. Kapitel 3 analysiert die wechselseitige Wahrnehmung und den Einfluss der beiden Künstler. Kapitel 4 diskutiert die Frage nach der "Künstlerfreundschaft".
Wo finde ich das Inhaltsverzeichnis?
Das Inhaltsverzeichnis befindet sich am Anfang der Arbeit und listet die einzelnen Kapitel und Unterkapitel auf (siehe HTML-Code).
- Citar trabajo
- Sabine Swoboda (Autor), 2015, Johann Wolfgang Goethe und der Maler Johann Heinrich Wilhelm Tischbein in Italien, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/373392