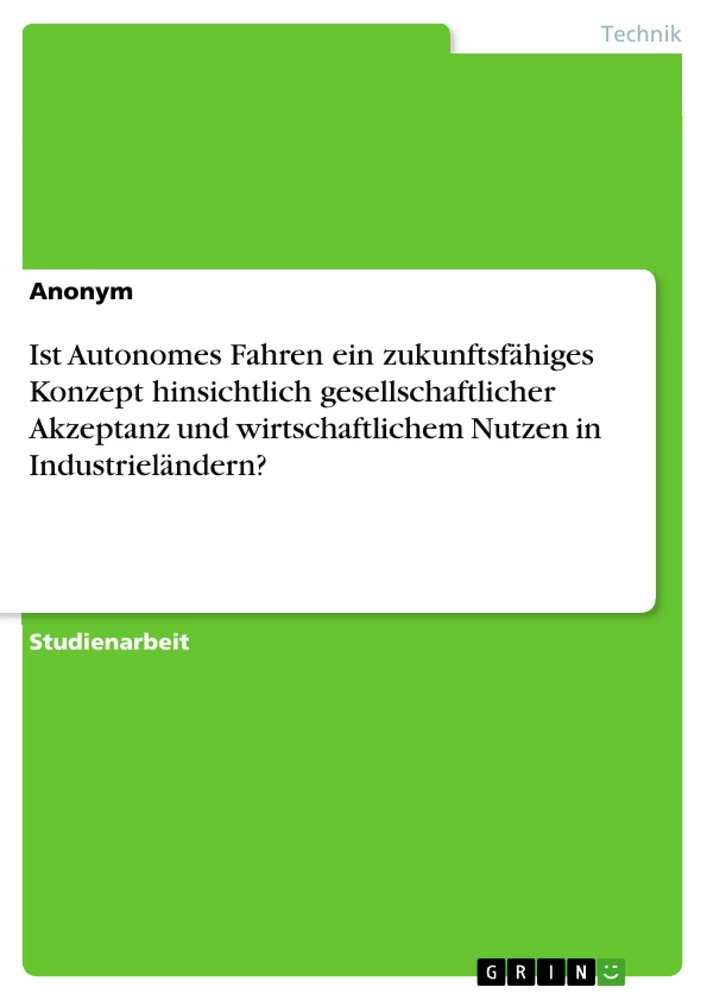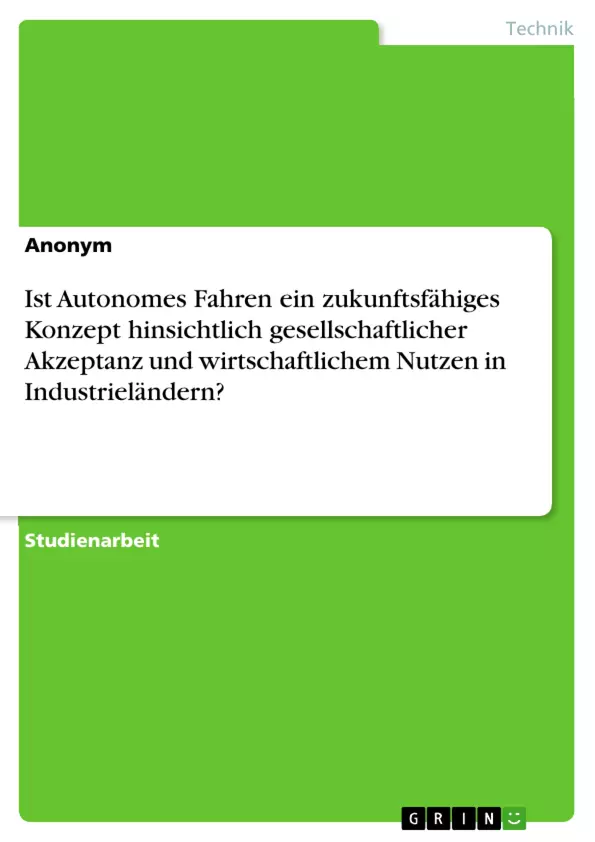Bereits 1885 staunte die Welt über das erste Automobil von Carl Benz, das sich über die Jahre hinweg technisch als auch optisch stetig weiterentwickelte.
Die ersten umgesetzten Visionen eines autonom fahrenden Autos führten bereits in den 1980er Jahren in zahlreichen Experimenten zum Erfolg. Außerdem wurde im Jahr 1986 das EUREKA-PROMETHEUS-Großprojekt vom Staat und mehreren Unternehmen begonnen. Das Ziel war Effizienz, Umweltverträglichkeit und die Sicherheit im Straßenverkehr zu verbessern. Mit Erfolg bestand das getestete Auto mehrere Experimente und legte über 1000 km mit einer Geschwindigkeit von bis zu 130 km/h zurück.
Trotz der jahrelangen Entwicklung des AF, zeigte eine Studie der puls Marktforschung GmbH im Jahr 2015, dass knapp 50 Prozent der befragten Personen immer noch Skepsis gegenüber den Zukunftsvisionen zeigen. Neben der Gesellschaft müssen sich auch Unternehmen mit den kommenden Veränderungen auseinandersetzen und gegebenenfalls ihr Konzept verändern. Die ungeklärten Problematiken führen zu folgender Leitfrage: „Ist AF ein zukunftsfähiges Konzept hinsichtlich gesellschaftlicher Akzeptanz und wirtschaftlichem Nutzen in Industrieländern?“
AF hat einen relativ komplexen Themenumfang, weshalb nur die relevantesten grundlegend erläutert werden. Passend zum Profilfach (TuM) wird das Fachkapitel mit dem technischen Grundverständnis und einem Überblick der wichtigsten Autonomiestufen beginnen. Sensoren und Assistenzsysteme werden die technische Seite des AF abdecken. Ziel des Fachkapitels ist es, den aktuellen technischen Forschungsstand einzuordnen und festzustellen, ab wann AF wie geplant umgesetzt werden kann. Nach dem technischen Grundverständnis wird die Seminararbeit sich mit den ethischen Problematiken beschäftigen und verschiedene Lösungsansätze charakterisieren. Die Problematiken beschäftigen sich vor allem mit ethischen Entscheidungen der verwendeten Computer für das AF, beziehungsweise der vom Unternehmen, Land oder Gesellschaft geforderten Entscheidungen in Extremsituationen. Abschließend werden mögliche Veränderungen und daraus resultierende Problematiken für Unternehmen und Gesellschaft erläutert und beantwortet.
Durch die Aktualität des Themas bietet es sich an, die Leitfrage mithilfe von Literatur, Videoreportagen und dem Internet bestmöglich zu beantworten. Um ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erzielen, werden alle Methoden stets miteinander verglichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition des autonomen Fahrens - Automatisierungsgrade
- Aktuelle Technik eines autonomen Fahrzeugs
- Sensoren
- Radar Sensor
- LIDAR Sensor
- Kamera - Sensor
- Fahrerassistenzsysteme
- Sensoren
- Ethik
- Das ,,Trolley-Problem"
- Die Bedeutung der Gesellschaft bei ethischen Fragen
- Lösungsansätze der ethischen Probleme
- Wirtschaft und Gesellschaft
- Gesellschaft
- Bedenken und Wünsche der Gesellschaft
- Recht & Haftung
- Automobilindustrie
- Auswirkungen von AF auf die Branchen der Automobilindustrie
- Gesellschaft
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Frage, ob autonomes Fahren (AF) ein zukunftsfähiges Konzept hinsichtlich gesellschaftlicher Akzeptanz und wirtschaftlichem Nutzen in Industrieländern darstellt. Der Fokus liegt dabei auf der technischen Entwicklung, den ethischen Implikationen und den Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft.
- Technisches Grundverständnis von autonom fahrenden Autos
- Ethische Fragestellungen und Herausforderungen
- Gesellschaftliche Akzeptanz und Regulierungsfragen
- Wirtschaftspolitische Folgen und Auswirkungen auf die Automobilindustrie
- Zukünftige Entwicklungen und Herausforderungen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung beleuchtet die historische Entwicklung des autonomen Fahrens und stellt die Relevanz des Themas im Kontext aktueller gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Debatten heraus. Sie führt die Leitfrage der Arbeit ein und skizziert den Aufbau und die Methodik der Untersuchung.
Definition des autonomen Fahrens - Automatisierungsgrade
Dieses Kapitel definiert den Begriff des autonomen Fahrens und beschreibt die verschiedenen Automatisierungsgrade, die von Teilautomatisierung bis hin zu Vollautomatisierung reichen. Es zeigt die Komplexität der Entwicklung und die Herausforderungen, die mit der Umsetzung der verschiedenen Stufen verbunden sind.
Aktuelle Technik eines autonomen Fahrzeugs - Sensoren
Das Kapitel erläutert die wichtigsten technischen Komponenten eines autonomen Fahrzeugs, insbesondere die Sensoren. Es geht dabei auf die Funktionsweise und die unterschiedlichen Einsatzbereiche von Radar, LIDAR und Kamerasensoren ein und betont die Bedeutung der Zusammenführung dieser Technologien für ein funktionierendes System.
Ethik
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den ethischen Herausforderungen, die mit dem autonomen Fahren verbunden sind. Es stellt das „Trolley-Problem“ als Beispiel für moralische Dilemmata vor und analysiert die Rolle der Gesellschaft bei der Entwicklung ethischer Richtlinien für das autonome Fahren. Darüber hinaus werden verschiedene Lösungsansätze für die ethischen Probleme präsentiert.
Wirtschaft und Gesellschaft
Das Kapitel beleuchtet die Auswirkungen des autonomen Fahrens auf Wirtschaft und Gesellschaft. Es betrachtet die gesellschaftlichen Bedenken und Wünsche, die rechtlichen und haftungsrechtlichen Aspekte sowie die Folgen für die Automobilindustrie. Insbesondere werden die Auswirkungen auf verschiedene Branchen der Automobilindustrie diskutiert.
Schlüsselwörter
Autonomes Fahren, Automatisierungsgrade, Sensoren, Radar, LIDAR, Kamerasensoren, Fahrerassistenzsysteme, Ethik, Trolley-Problem, Gesellschaftliche Akzeptanz, Recht & Haftung, Automobilindustrie, Zukunftsvisionen, Wirtschaftlicher Nutzen, Industrieländer.
Häufig gestellte Fragen
Welche Automatisierungsgrade gibt es beim autonomen Fahren?
Es wird zwischen verschiedenen Stufen unterschieden, die von der Teilautomatisierung über die Hochautomatisierung bis hin zur Vollautomatisierung (autonomes Fahren) reichen.
Was ist das „Trolley-Problem“ in der Ethik des autonomen Fahrens?
Es beschreibt ein moralisches Dilemma, bei dem ein Computer in einer Extremsituation entscheiden muss, welches Leben im Falle eines unvermeidbaren Unfalls geschützt wird.
Welche Sensoren benötigt ein autonomes Fahrzeug?
Die wichtigste Technik umfasst Radar-Sensoren für die Distanzmessung, LIDAR für die 3D-Umgebungserfassung und Kamerasensoren zur Bilderkennung.
Wie hoch ist die gesellschaftliche Akzeptanz für autonomes Fahren?
Studien zeigen, dass immer noch knapp 50 Prozent der Befragten Skepsis gegenüber autonom fahrenden Autos äußern, vor allem wegen Sicherheitsbedenken.
Wer haftet bei einem Unfall mit einem autonomen Auto?
Die Klärung von Recht und Haftung ist eine der größten Herausforderungen; es muss entschieden werden, ob der Fahrer, der Hersteller oder der Softwareentwickler verantwortlich ist.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2017, Ist Autonomes Fahren ein zukunftsfähiges Konzept hinsichtlich gesellschaftlicher Akzeptanz und wirtschaftlichem Nutzen in Industrieländern?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/373444