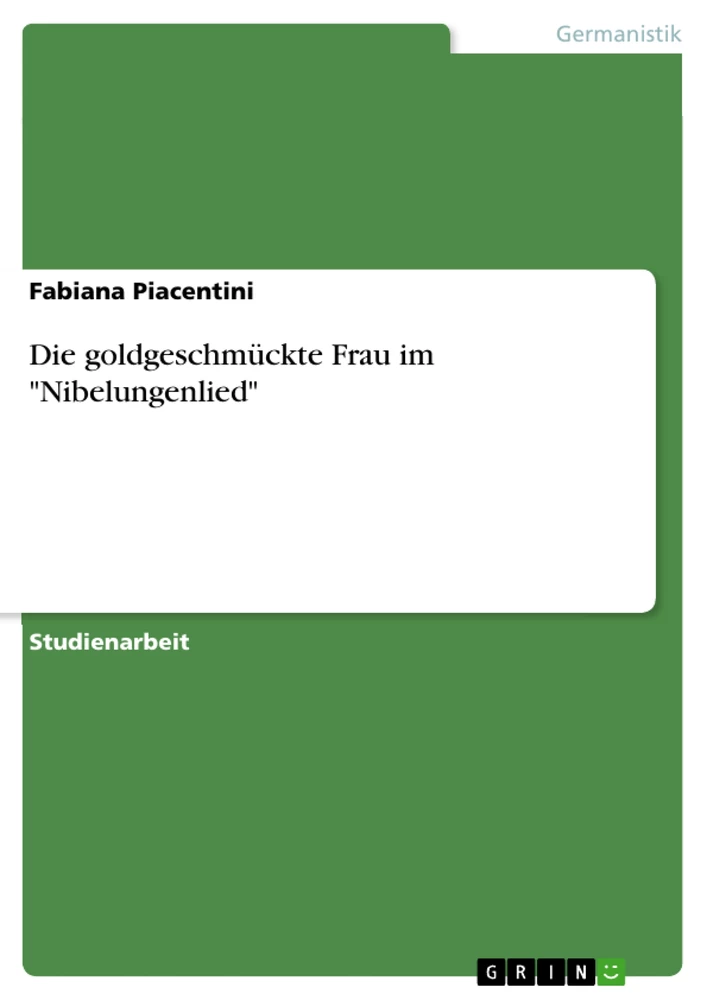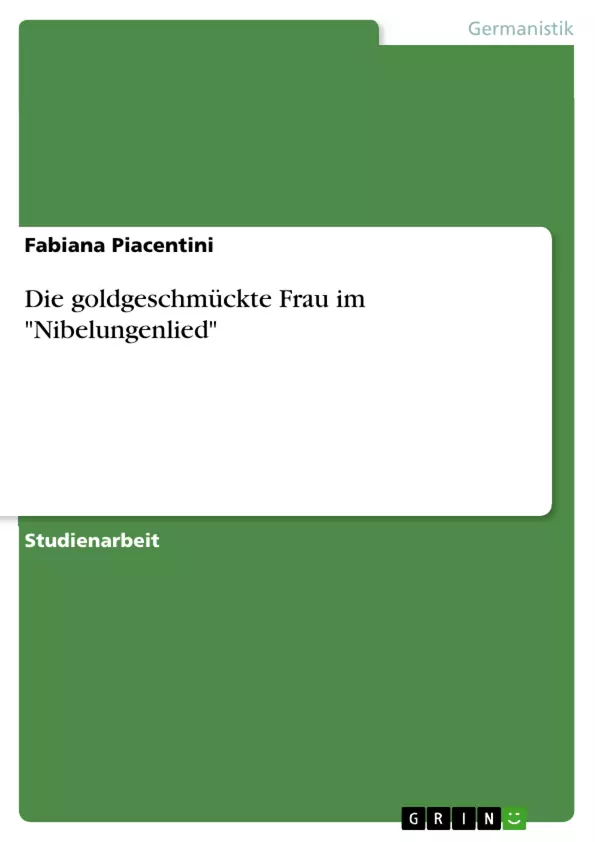Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Erörterung des von Heike Sahm in ihrem Aufsatz zum Themenkomplex „Gold im Nibelungenlied“ geprägten Motivs der goldgeschmückten Frau, unter besonderer Berücksichtigung des Gegenstandes Gold, welchem im Mittelalter ein insgesamt hoher Stellenwert zukommt.
Da das Gold zumeist dem ästhetischen Bereich zugeordnet wird, erfolgt zu Beginn der Arbeit eine Vorstellung grundlegender Körper- und Kleiderbeschreibungen in der Epik um 1200, wobei besonderes Augenmerk auf die Schönheitsdarstellung der edlen Dame in der hochmittelalterlichen Literatur gerichtet wird.
Im weiteren Verlauf geht es zunächst darum, die Golddeskriptionen vor dem Hintergrund der auf Visualität und Materialität ausgelegten Literatur des Hochmittelalters in ihren wesentlichen Grundzügen zu skizzieren und die über den rein ästhetischen, dekorativen Effekt hinausgehende Semantik des Goldes zu erschließen. Zu zeigen gilt es in diesem Zusammenhang, dass Gold und dessen Glanz auch dezidiert als Instrument der Identitätskonstruktion verwendet werden können. Ein weiteres Unterkapitel widmet sich der Darstellung der wehrhaften, geradezu heroischen Dame in der epischen Literatur, um im Folgenden das der Heldenepik zugehörige anonym überlieferte „Nibelungenlied“ auf die Bedeutung des Phänomens weiblichen Goldglanzes, wie auch auf die jeweilige Goldsymbolik, hin zu untersuchen. Wesentliche Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang der dem Goldenen impliziten Zeichenfunktion zu, über die der weiblichen Figur und somit ihrer körperlichen Schönheit eine eigene Semantik zugeschrieben wird.
Ziel dieser Arbeit ist es, die Detaillierung höfischen Lebens im Kontext der Verhandlung von Herrschaft näher zu erörtern und die entsprechend literarische Aufarbeitung der dieser Analyse vorangestellten theoretischen Erläuterungen zu mittelalterlichen Vorstellungen von Schönheit und Ästhetik im „Nibelungenlied“ anhand der Brünhild-Figur zu erfassen. Dabei sollen die theoretischen Erörterungen zwar als Grundlage der Textlektüre dienen, aber durch die Analyse nicht bloß bestätigt oder zurückgewiesen werden. Vielmehr gilt es, neue Dimensionen aufzuzeigen, die in dem Heldenepos durch die literarische Illustration der Frauenschönheit beschrieben werden. Dazu sind auch der Deutungskontext und das ambivalente Bedeutungsspektrum des Goldes näher zu betrachten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die goldene Dingkultur im „Nibelungenlied“
- Zum Verhältnis von Goldbesitz und Herrschaft im „Nibelungenlied“
- Höfische Körpersemiotik: Die Autorität der Äußerlichkeiten
- Geläufige Darstellungskonventionen für weibliche Figuren in der mittelalterlichen Literatur
- Zum Topos der idealen Frauenschönheit: Die literarische Inszenierung von Körper und Kleid
- Semantiken und Funktionen des Glanzes in der Konzeption schöner Frauenkörper
- „Die Dame als Ritter“: „Der Gürtel“
- Die goldgeschmückte Frau im „Nibelungenlied“
- Brünhild – Die Goldschmuck tragende Herrscherin
- Der fatale Glanz - Brünhilds Stärke und Kampffähigkeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Erörterung des Motivs der goldgeschmückten Frau im „Nibelungenlied“, welches Heike Sahm in ihrem Aufsatz zum Themenkomplex „Gold im Nibelungenlied“ geprägt hat. Das Gold spielt im Mittelalter eine bedeutende Rolle und wird hauptsächlich dem ästhetischen Bereich zugeordnet. Daher erfolgt zu Beginn der Arbeit eine Vorstellung grundlegender Körper- und Kleiderbeschreibungen in der Epik um 1200. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei der Schönheitsdarstellung der edlen Dame in der hochmittelalterlichen Literatur. Die Arbeit untersucht die Golddeskriptionen vor dem Hintergrund der auf Visualität und Materialität ausgelegten Literatur des Hochmittelalters, um die Semantik des Goldes jenseits des rein ästhetischen, dekorativen Effekts zu erschließen. Im weiteren Verlauf wird gezeigt, dass Gold und dessen Glanz als Instrument der Identitätskonstruktion verwendet werden können. Ein weiteres Unterkapitel widmet sich der Darstellung der wehrhaften, geradezu heroischen Dame in der epischen Literatur, um das anonym überlieferte „Nibelungenlied“ hinsichtlich der Bedeutung des Phänomens weiblichen Goldglanzes und der jeweiligen Goldsymbolik zu untersuchen. Die Arbeit konzentriert sich auf die Zeichenfunktion des Goldenen, die der weiblichen Figur und damit ihrer körperlichen Schönheit eine eigene Semantik zuschreibt.
- Detaillierung höfischen Lebens im Kontext der Verhandlung von Herrschaft
- Literarische Aufarbeitung von theoretischen Erläuterungen zu mittelalterlichen Vorstellungen von Schönheit und Ästhetik im „Nibelungenlied“ anhand der Brünhild-Figur
- Neuinterpretation der Frauenschönheit im Heldenepos
- Deutungskontext und ambivalentes Bedeutungsspektrum des Goldes
- Beziehung von Goldbesitz und Herrschaft
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt das Thema und die Zielsetzung vor, wobei besonderes Augenmerk auf die Relevanz des Motivs der goldgeschmückten Frau und die Bedeutung des Goldes im Mittelalter gelegt wird.
- Die goldene Dingkultur im „Nibelungenlied“: Dieses Kapitel beleuchtet die auf Materialität basierende mittelalterliche Adelskultur und die Visualisierung der adeligen Qualität als kulturhistorische Voraussetzung für ein besseres Verständnis der höfischen Lebensform des Adels im Mittelalter.
- Zum Verhältnis von Goldbesitz und Herrschaft im „Nibelungenlied“: Hier werden die Beziehungen zwischen Goldbesitz und Macht, die Bedeutung des Materials und die Symbolik des Goldes im Kontext von Herrschaft und Königswürde untersucht.
- Höfische Körpersemiotik: Die Autorität der Äußerlichkeiten: Dieses Kapitel fokussiert auf die Beschreibung und Funktion von Kleidung in der Literatur, insbesondere für die Darstellung des weiblichen höfischen Körpers.
- Geläufige Darstellungskonventionen für weibliche Figuren in der mittelalterlichen Literatur: Hier werden allgemeine Konventionen der Darstellung weiblicher Figuren in der mittelalterlichen Literatur, insbesondere der Topos der idealen Frauenschönheit, analysiert.
- Zum Topos der idealen Frauenschönheit: Die literarische Inszenierung von Körper und Kleid: Dieser Abschnitt befasst sich mit der literarischen Inszenierung des Körpers und Kleides in Bezug auf den Topos der idealen Frauenschönheit.
- Semantiken und Funktionen des Glanzes in der Konzeption schöner Frauenkörper: Dieses Kapitel erörtert die Semantiken und Funktionen des Glanzes in der Darstellung weiblicher Schönheit in der Literatur.
- „Die Dame als Ritter“: „Der Gürtel“: Hier wird die Darstellung der wehrhaften, geradezu heroischen Dame in der epischen Literatur behandelt, wobei der „Gürtel“ als Symbol für die Stärke und Rolle der Frau im Kampf analysiert wird.
- Die goldgeschmückte Frau im „Nibelungenlied“: Dieses Kapitel untersucht das „Nibelungenlied“ im Hinblick auf die Bedeutung des weiblichen Goldglanzes und die jeweilige Goldsymbolik.
- Brünhild – Die Goldschmuck tragende Herrscherin: Dieser Abschnitt beleuchtet die Figur der Brünhild als goldgeschmückte Herrscherin und analysiert ihre Rolle und Bedeutung im Epos.
- Der fatale Glanz - Brünhilds Stärke und Kampffähigkeit: Hier wird der Zusammenhang zwischen Brünhilds Goldschmuck, ihrer Stärke und Kampffähigkeit untersucht und die Doppeldeutigkeit des Glanzes erörtert.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Thema „Gold“ in der mittelalterlichen Literatur und fokussiert auf die Figur der goldgeschmückten Frau im „Nibelungenlied“. Die Arbeit untersucht die Semantik des Goldes, die Beziehung zwischen Goldbesitz und Herrschaft und die Bedeutung des Goldglanzes in der Konstruktion von weiblicher Identität und Macht. Besondere Aufmerksamkeit wird der Darstellung von Körper und Kleid im Kontext der idealen Frauenschönheit und der Rolle des Goldes in der literarischen Inszenierung weiblicher Stärke und Kampffähigkeit gewidmet.
Häufig gestellte Fragen zur goldgeschmückten Frau im Nibelungenlied
Welche Bedeutung hat Gold im Nibelungenlied?
Gold dient im Nibelungenlied nicht nur als ästhetischer Schmuck, sondern ist ein zentrales Instrument zur Identitätskonstruktion und Visualisierung von Macht und Herrschaftsansprüchen.
Wer prägte das Motiv der „goldgeschmückten Frau“?
Das Motiv wurde von der Literaturwissenschaftlerin Heike Sahm in ihrem Aufsatz zum Themenkomplex „Gold im Nibelungenlied“ geprägt.
Wie wird Brünhild durch Gold charakterisiert?
Brünhild wird als goldgeschmückte Herrscherin dargestellt, wobei ihr Glanz sowohl ihre Schönheit als auch ihre heroische Stärke und Kampffähigkeit symbolisiert.
Was ist der „Topos der idealen Frauenschönheit“ im Mittelalter?
Es handelt sich um literarische Konventionen, die den Körper und die Kleidung edler Damen inszenieren, wobei Materialität und Glanz eine wesentliche Rolle spielen.
Welche Rolle spielt der Gürtel in der Heldenepik?
Der Gürtel wird oft als Symbol für die Stärke und die Rolle der Frau (z. B. als „Dame als Ritter“) im Kontext von Herrschaft und Kampf analysiert.
- Quote paper
- Fabiana Piacentini (Author), 2015, Die goldgeschmückte Frau im "Nibelungenlied", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/373446