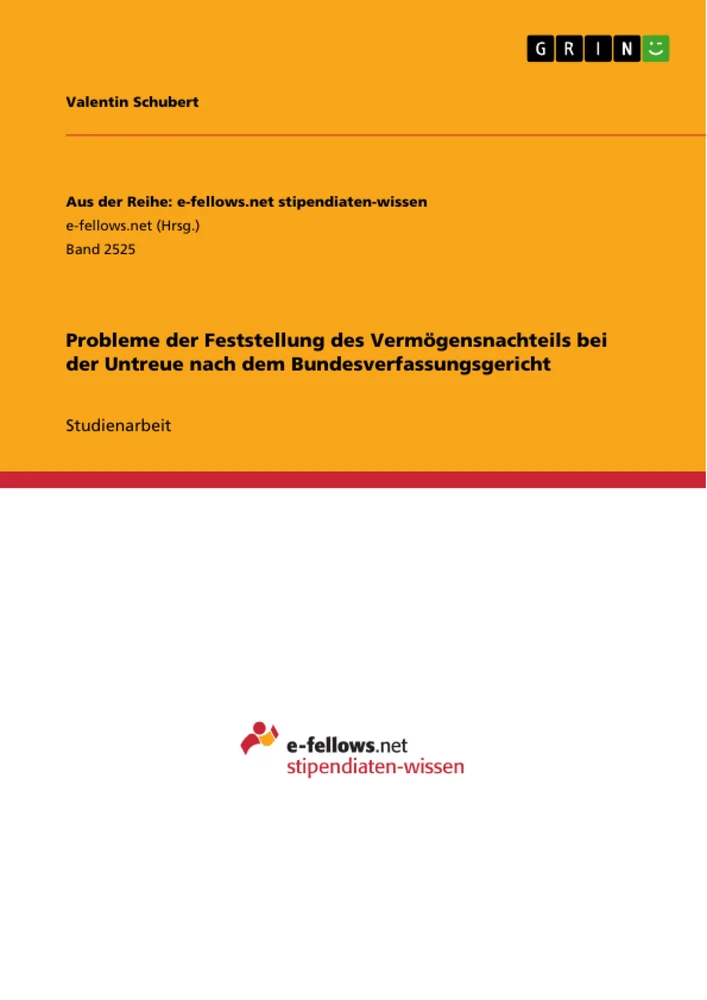In dieser Arbeit gilt es die Vermögensbetreuungspflicht genau zu definieren und im Einzelfall zu eruieren, eine Verletzung derselben festzustellen, eventuelle Einwilligungen zu prüfen und einen Vermögensnachteil beim Treugeber zu ermitteln. Auch wenn man zunächst denken könnte, die Feststellung, ob ein Nachteil vorliegt oder nicht, sei eine der einfacher zu lösenden Aufgaben der Untreuefälle, offenbart sich bei näherem Hinsehen ein weites Feld an unterschiedlichen Konstellationen, die es erschweren, eine eindeutige Antwort auf diese vermeintlich leichte Frage zu geben. Orientierung bietet dabei oftmals das übereinstimmend als einziges Schutzgut des § 266 StGB erkannte individuelle Vermögen des Treugebers. Doch sogar hier wird in Einzelfällen gestritten, wie weit dieses reicht und welche anderen Rechte und Freiheiten es womöglich umfasst. Zu einer zunehmenden Verkomplizierung trägt auch das heutige Wirtschaftssystem bei, das auf Laien teilweise unverständlich wirkt und nicht umsonst eigene Forschungsfelder wie die Finanzmathematik beschäftigt.
In jüngster Zeit standen Skandale in Politik und Wirtschaft im Fokus der Öffentlichkeit, die auch das Interesse der Strafverfolgungsbehörden weckten; seien es Vorgänge in der Parteienlandschaft, wo mit fragwürdigen Methoden versucht wurde, Zuwendungen vom Staat zu „erschleichen“, oder langjährige Bestechungspraktiken von kleineren Betrieben bis hin zu marktführenden Weltunternehmen, um an Aufträge zu gelangen. Während zunächst oft andere Delikte wie Betrug nach § 263 StGB oder Bestechung und Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr nach § 299 StGB ins Auge fallen, spielt auch die Untreue gem. § 266 StGB häufig eine Rolle. Da heutzutage Vermögensinhaberschaft und beauftragte Verfügungsmacht meist auseinanderfallen, kommt abhängig vom Wissensstand der Vermögensinhaber und Treugeber auch eine Schädigung eben jener durch die Treunehmer in Betracht. Andere Fälle wie die Affäre rund um die Pläne des Nürburgrings oder die Bankenkrise der 2000er Jahre deuten angesichts verschwenderischen oder rücksichtslosen Umgangs mit Geld schon eher auf eine Untreuestrafbarkeit hin. Oftmals weisen solche Fälle mehrere Problemfelder auf
Inhaltsverzeichnis
- A. Relevanz der Untreue in Zeiten moderner Marktwirtschaft
- B. Der Untreueparagraph in der Kritik
- C. Die Entscheidung des BVerfG vom 23. Juni 2010
- I. Drei Verfassungsbeschwerden
- II. Das Bestimmtheitsgebot aus Art. 103 II GG
- III. Der Nachteil in § 266 StGB
- 1. Differenz aus Vergleich von Vermögenslagen
- 2. Verschleifungsverbot
- 3. Entscheidung zu „Schwarzen Kassen“ und Kreditvergabe
- 4. Anforderungen an die Schadensfeststellung
- a) Bezifferungsgebot
- b) Rechtscharakter des Bezifferungsgebots
- c) Bilanzrecht
- D. Gefährdungsschaden
- I. Beschriebene Situation
- II. Erforderlichkeit der Bezeichnung dieser Situation
- III. Terminologie
- E. Ermittlung des Nachteils mittels Bilanzrecht und Sachverständigengutachten
- I. Handelsbilanzrecht
- 1. Einzelwertberichtigung und Rückstellungen
- 2. Vorsichtsprinzip versus „in dubio pro reo“
- II. Bestimmtheitsgewinn
- III. Probleme in Praxis und Verfahren
- 1. Sachverständigenrecht
- 2. Vermehrte Absprachen oder Verfahrenseinstellungen
- IV. Evidenzkriterium
- V. IAS und IFRS
- VI. Alternativvorschläge zur Wertbestimmung
- I. Handelsbilanzrecht
- F. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Problem der Feststellung des Vermögensnachteils bei der Untreue im Lichte des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts vom 23. Juni 2010. Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse der verfassungsrechtlichen Vorgaben zur Bestimmung des Vermögensschadens und der daraus resultierenden Herausforderungen für die Strafrechtsdogmatik und -praxis.
- Bestimmtheitsgebot des Art. 103 II GG im Zusammenhang mit § 266 StGB
- Differenzierung zwischen tatsächlichem und rechtlich relevantem Vermögensschaden
- Anwendung von Bilanzrecht und Sachverständigengutachten bei der Schadensfeststellung
- Die Rolle des Gefährdungsschadens in der Untreue-Dogmatik
- Bedeutung von IAS und IFRS in der Strafrechtspraxis
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel A beleuchtet die Relevanz des Untreuetatbestandes im Kontext der modernen Marktwirtschaft. Es wird auf die Bedeutung von Unternehmensethik und die Notwendigkeit einer effektiven Strafverfolgung von Vermögensdelikten eingegangen.
- Kapitel B befasst sich mit den Kritikpunkten am Untreueparagrafen. Es werden insbesondere die Schwierigkeiten bei der Definition und Feststellung des Vermögensschadens sowie die potenzielle Gefahr von Rechtsunsicherheit diskutiert.
- Kapitel C analysiert die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 23. Juni 2010, die sich mit der Frage des Bestimmtheitsgebots im Zusammenhang mit § 266 StGB auseinandersetzte. Die Arbeit geht auf die drei Verfassungsbeschwerden und deren Begründetheit ein.
- Kapitel D beleuchtet den Begriff des Gefährdungsschadens im Kontext des Untreuetatbestandes. Die Arbeit untersucht die Definition, die Erforderlichkeit und die Terminologie des Gefährdungsschadens in der Rechtsprechung und Literatur.
- Kapitel E befasst sich mit der Ermittlung des Vermögensschadens anhand von Bilanzrecht und Sachverständigengutachten. Es werden die Anwendung von handelsrechtlichen Normen, insbesondere Einzelwertberichtigung und Rückstellungen, im Strafrecht untersucht sowie die Probleme in Praxis und Verfahren diskutiert.
Schlüsselwörter
Untreue, Vermögensschaden, Bestimmtheitsgebot, Art. 103 II GG, § 266 StGB, Bilanzrecht, Handelsbilanzrecht, Sachverständigengutachten, Gefährdungsschaden, IAS, IFRS, Strafrechtsdogmatik, Strafrechtspraxis, Vermögensdelikte, Unternehmensethik
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Problem bei der Feststellung des Vermögensnachteils bei Untreue?
Die Bestimmung eines Schadens ist in komplexen Wirtschaftssystemen schwierig, da oft unklar ist, wie weit das individuelle Vermögen reicht und welche Risiken bereits als Nachteil gelten.
Welche Bedeutung hat das BVerfG-Urteil vom 23. Juni 2010?
Das Bundesverfassungsgericht forderte eine genauere Bezifferung des Schadens, um dem Bestimmtheitsgebot des Grundgesetzes (Art. 103 II GG) gerecht zu werden.
Was versteht man unter einem „Gefährdungsschaden“?
Ein Gefährdungsschaden liegt vor, wenn das Vermögen bereits durch die bloße Verlustgefahr so konkret beeinträchtigt ist, dass dies einer Minderung gleichkommt.
Wie hilft das Bilanzrecht bei der Schadensermittlung?
Handelsrechtliche Prinzipien wie Einzelwertberichtigungen und Rückstellungen werden genutzt, um Vermögenslagen objektiv zu vergleichen und Nachteile zu beziffern.
Was ist das „Verschleifungsverbot“?
Es besagt, dass die Verletzung der Treuepflicht und der Eintritt des Schadens getrennt voneinander festgestellt werden müssen; die Pflichtverletzung allein begründet noch keinen Schaden.
Welche Rolle spielen Sachverständige in Untreue-Verfahren?
Aufgrund der Komplexität (z.B. Finanzmathematik) sind Gerichte oft auf Gutachten angewiesen, um den tatsächlichen Vermögensnachteil rechtssicher festzustellen.
- Quote paper
- Valentin Schubert (Author), 2017, Probleme der Feststellung des Vermögensnachteils bei der Untreue nach dem Bundesverfassungsgericht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/373507