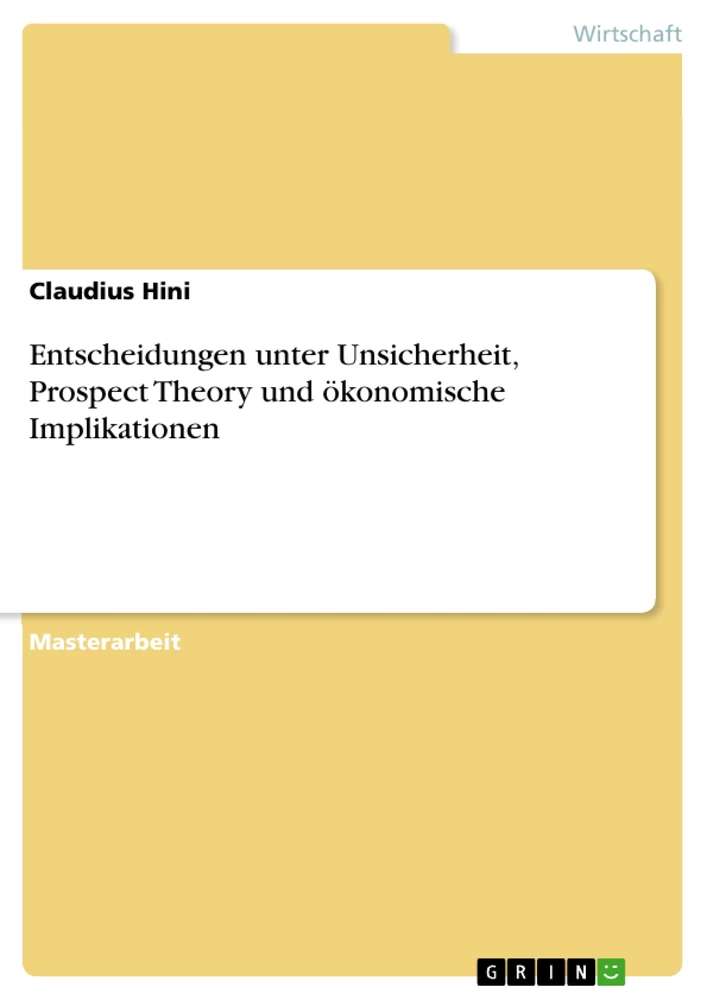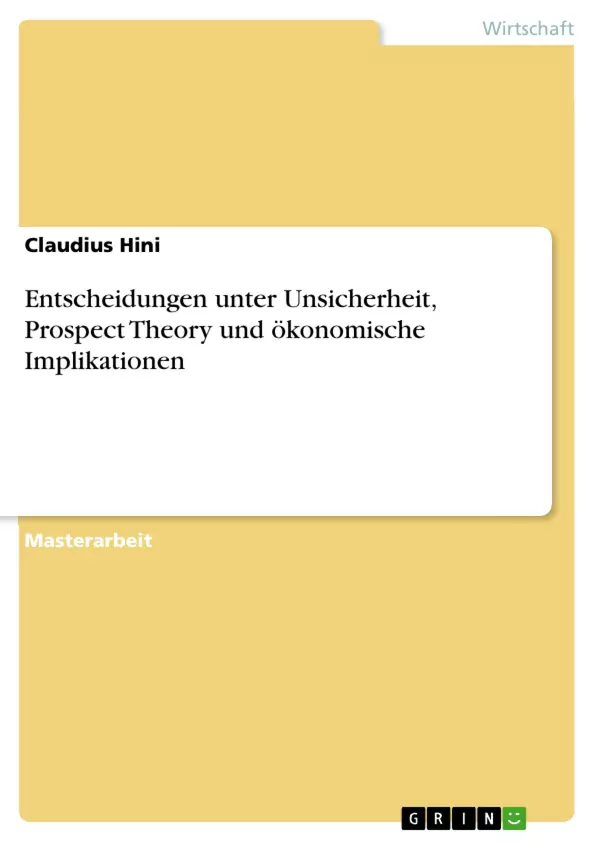Fast vierzig Jahre nach ihrem Erscheinen gilt die Prospect Theorie einschließlich ihrer Erweiterung, die kumulative Prospect Theorie aus dem Jahr 1992, gemeinhin als wichtigster Vertreter deskriptiver Entscheidungstheorien. Ihre Bedeutung spiegelt sich dabei nicht nur in zahlreichen Zitierungen in Fachzeitschriften, sondern auch in der Verleihung des Nobelpreises an Daniel Kahneman im Jahr 2002 wider.
Ein Ziel dieser Arbeit soll sein, die Entwicklung und Wandlung der Prospect Theorie über die Jahre hinweg herauszuarbeiten und Unterschiede zur Erwartungsnutzentheorie zu verdeutlichen. Im Fokus des nachfolgenden zweiten Kapitels steht daher zunächst die Entwicklung eines formalen Grundgerüsts, um anschließend die Funktionsweise der Erwartungsnutzentheorie sowie deren Annahmen erläutern zu können. Inwiefern es in der Realität zu Verletzungen dieser Annahmen kommt, soll ebenfalls Teil dieses Abschnitts sein.
Aufbauend darauf wird im dritten Kapitel die Prospect Theorie in ihrer ursprünglichen Fassung aus dem Jahr 1979 vorgestellt. Neben einer detaillierten Analyse der Funktionsweise sowie einer Abgrenzung des Modells zur Erwartungsnutzentheorie soll dabei auch auf formale Kritik am Modell eingegangen werden. In Folge dieser Kritik haben Kahneman und Tversky das ursprüngliche Modell der Prospect Theorie zur kumulativen Prospect Theorie weiterentwickelt. Welche Unterschiede diese Weiterentwicklung aufweist, wird im vierten Kapitel aufgezeigt. Am Ende des vierten Kapitels erfolgt eine Diskussion über bestehende Kritikpunkte an der Prospect Theorie. Dabei soll besonders die Frage im Mittelpunkt stehen, weshalb trotz der Popularität der Prospect Theorie lange Zeit nur relativ wenige ökonomische Anwendungsbeispiele bekannt wurden. Im letzten Kapitel des Hauptteils sollen dann Anwendungsbeispiele vorgestellt und einer kritischen Untersuchung unterzogen werden. Den Abschluss der Arbeit bildet ein Diskussionsteil, in welchem die Ergebnisse zusammengefasst werden und zukünftige Forschungsschwerpunkte der Prospect Theorie erläutert werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Grundlagen der Prospect Theorie
- 2.1 Präferenzrelationen
- 2.2 Nutzenfunktion
- 2.3 Entscheidungen unter Unsicherheit
- 2.4 Erwartungsnutzentheorie
- 2.5 Kritik an der Erwartungsnutzentheorie
- 2.5.1 Sicherheits- und Möglichkeitseffekt
- 2.5.2 Spiegelungseffekt
- 2.5.3 Referenzpunktabhängigkeit
- 3. Ursprüngliche Formulierung der Prospect Theorie 1979
- 3.1 Editierungsphase
- 3.2 Bewertungsphase
- 3.3 Das viergeteilte Muster
- 3.4 Formale Kritik an der Prospect Theorie
- 4. Kumulative Prospect Theorie 1992
- 4.1 Wahrscheinlichkeitsgewichtungsfunktion der kumulativen Prospect Theorie
- 4.2 Verlauf der Wahrscheinlichkeitsgewichtungsfunktion
- 4.3 Wahrscheinlichkeitsgewichtung unter Ungewissheit
- 4.4 Kritik an der (kumulativen) Prospect Theorie
- 5. Anwendungen der Prospect Theorie
- 5.1 Endowment-Effekt
- 5.2 Versicherungswesen
- 5.3 Dispositionseffekt
- 5.4 Save More Tomorrow
- 6. Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit befasst sich mit der Prospect Theorie, einem wichtigen Konzept der Verhaltensökonomie, das Entscheidungen unter Unsicherheit erklärt. Sie analysiert die theoretischen Grundlagen der Prospect Theorie und ihre empirischen Anwendungen.
- Die Prospect Theorie als Alternative zur Erwartungsnutzentheorie
- Die psychologischen Annahmen der Prospect Theorie, wie z.B. die Verlust-Aversion
- Die Anwendung der Prospect Theorie in verschiedenen Bereichen, z.B. im Versicherungswesen und im Finanzmarkt
- Kritikpunkte und Weiterentwicklungen der Prospect Theorie
- Ökonomische Implikationen der Prospect Theorie
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
- Kapitel 2: Grundlagen der Prospect Theorie
- Kapitel 3: Ursprüngliche Formulierung der Prospect Theorie 1979
- Kapitel 4: Kumulative Prospect Theorie 1992
- Kapitel 5: Anwendungen der Prospect Theorie
Dieses Kapitel führt in die Thematik der Masterarbeit ein und stellt die Relevanz der Prospect Theorie für die ökonomische Entscheidungsfindung heraus. Es wird auch der Aufbau der Arbeit erläutert.
Dieses Kapitel behandelt die theoretischen Grundlagen der Prospect Theorie. Es werden die Kernelemente der Theorie, wie z.B. die Präferenzrelationen, die Nutzenfunktion und die Entscheidung unter Unsicherheit, vorgestellt.
Dieses Kapitel beschreibt die ursprüngliche Formulierung der Prospect Theorie von Kahneman und Tversky. Es werden die Editierungsphase, die Bewertungsphase und das viergeteilte Muster der Theorie erläutert.
Dieses Kapitel behandelt die Weiterentwicklung der Prospect Theorie, die kumulative Prospect Theorie. Es werden die Wahrscheinlichkeitsgewichtungsfunktion und ihre Anwendungen erläutert.
Dieses Kapitel untersucht die Anwendung der Prospect Theorie in verschiedenen Bereichen der Wirtschaft. Es werden Beispiele aus dem Versicherungswesen, dem Finanzmarkt und dem Konsumentenverhalten gegeben.
Schlüsselwörter
Prospect Theorie, Verhaltensökonomie, Entscheidung unter Unsicherheit, Verlust-Aversion, Erwartungsnutzentheorie, Framing-Effekt, Endowment-Effekt, Dispositionseffekt, Save More Tomorrow, Wahrscheinlichkeitsgewichtungsfunktion, Kumulative Prospect Theorie
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Kern der Prospect Theorie?
Die Prospect Theorie ist eine deskriptive Entscheidungstheorie, die erklärt, wie Menschen unter Unsicherheit entscheiden, wobei sie Verluste stärker gewichten als Gewinne (Verlust-Aversion).
Wie unterscheidet sie sich von der Erwartungsnutzentheorie?
Im Gegensatz zur klassischen Theorie berücksichtigt sie psychologische Effekte wie Referenzpunktabhängigkeit, den Framing-Effekt und die ungleiche Gewichtung von Wahrscheinlichkeiten.
Was ist die kumulative Prospect Theorie (1992)?
Es ist eine Weiterentwicklung, die eine verbesserte Wahrscheinlichkeitsgewichtungsfunktion nutzt und Kritikpunkte am ursprünglichen Modell von 1979 behebt.
Was versteht man unter dem Endowment-Effekt?
Dies ist ein Anwendungsbeispiel der Theorie, bei dem Menschen Dinge, die sie bereits besitzen, einen höheren Wert beimessen als Dingen, die sie nicht besitzen.
In welchen wirtschaftlichen Bereichen findet die Theorie Anwendung?
Anwendungsgebiete sind unter anderem das Versicherungswesen, das Verhalten an Finanzmärkten (Dispositionseffekt) und Sparprogramme wie "Save More Tomorrow".
- Citation du texte
- Claudius Hini (Auteur), 2017, Entscheidungen unter Unsicherheit, Prospect Theory und ökonomische Implikationen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/373518