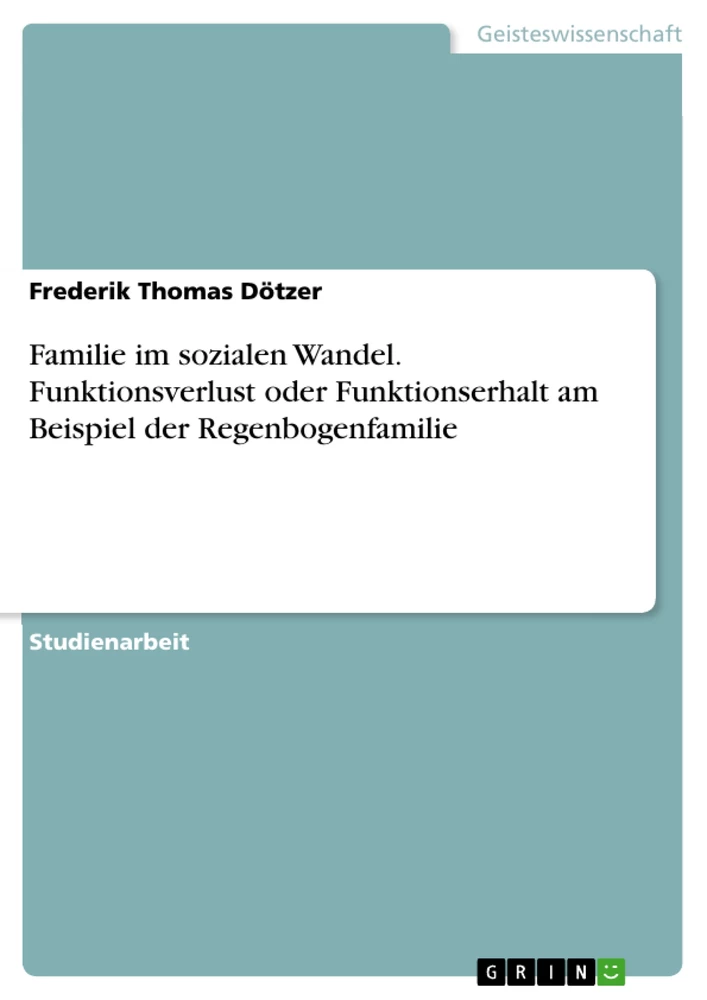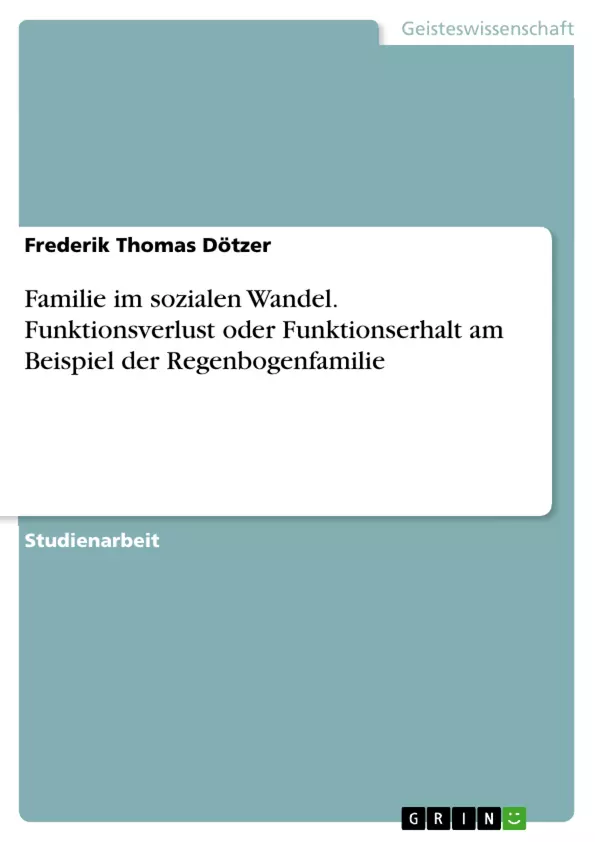In dieser wissenschaftlichen Arbeit wird der Funktionsverlust von Familien erklärt und beschrieben und im Nachhinein kritisch am Beispiel der Regenbogenfamilie dargestellt. Dabei wird auch überprüft, ob wirklich von einem Funktionsverlust die Rede sein kann und ob die Regenbogenfamilie eine gleichwertige Familienform ist.
Inhaltsverzeichnis
- Hinführung
- Geschichte der Familie
- Begriffsbestimmung
- Historische Entwicklung der Familie
- Familie im sozialen Wandel
- Erklärungsversuch nach Ulrich Beck (Individualisierungsthese)
- Pluralisierung der Lebensformen
- Funktionserhalt oder Funktionsverlust? Am Beispiel der Regenbogenfamilie
- zentrale Funktionen der Familie
- Charakteristika und Formen der Regenbogenfamilie
- Herausforderung an die Regenbogenfamilie
- Funktionserhalt oder Funktionsverlust?
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht den Funktionsverlust von Familien im Kontext des sozialen Wandels und analysiert kritisch, ob die Regenbogenfamilie trotz ihrer Besonderheiten als gleichwertige Familienform betrachtet werden kann. Die Arbeit beleuchtet die historischen Entwicklungen der Familie und die Herausforderungen, die der Wandel an traditionelle Familienmodelle stellt.
- Der soziale Wandel der Familie und seine Ursachen
- Die Pluralisierung von Lebensformen
- Die Funktionen der Familie im Wandel
- Die Regenbogenfamilie als neue Familienform
- Funktionserhalt oder Funktionsverlust in der Regenbogenfamilie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Hinführung zum Thema und stellt die wachsende Präsenz von Regenbogenfamilien in Deutschland dar. Anschließend wird die Geschichte der Familie anhand von Begriffsbestimmung und historischer Entwicklung beleuchtet. Hierbei wird die Entwicklung von der Großfamilie zur Kernfamilie und die Entstehung von neuen Familienformen im Zuge des sozialen Wandels erläutert. Das dritte Kapitel befasst sich mit dem sozialen Wandel der Familie und betrachtet die Individualisierungsthese von Ulrich Beck als ein zentrales Erklärungsmodell. Das vierte Kapitel widmet sich dem Thema Funktionserhalt oder Funktionsverlust am Beispiel der Regenbogenfamilie. Es werden zentrale Funktionen der Familie sowie Charakteristika und Formen der Regenbogenfamilie analysiert, um die Herausforderungen und die Frage nach dem Funktionserhalt oder Funktionsverlust in dieser Familienform zu untersuchen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert sich auf die Themen Familie, sozialer Wandel, Regenbogenfamilie, Pluralisierung von Lebensformen, Funktionsverlust, Funktionserhalt, Individualisierungsthese, Familienformen und Familienfunktionen.
- Citation du texte
- Frederik Thomas Dötzer (Auteur), 2014, Familie im sozialen Wandel. Funktionsverlust oder Funktionserhalt am Beispiel der Regenbogenfamilie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/373578